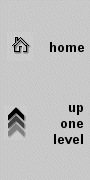 |
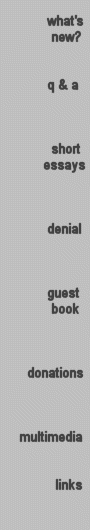 |
Auschwitz-Prozess - Urteil
LG Frankfurt/Main vom 19./20.8.1965, 4 Ks 2/63
1. Abschnitt:
Die Einrichtung und Entwicklung der Konzentrationslager im NS-Staat
2. Abschnitt:
Das Konzentrationslager Auschwitz
I. Allgemeines
II. Beschreibung des Konzentrationslagerbereiches
1. Das Stammlager
2. Das Lager Birkenau
3. Das Lager Monowitz mit seinen Nebenlagern
III. Die innere Organisation des Konzentrationslagers Auschwitz
1. Die Lagerkommandantur (Abteilung I)
2. Die Politische Abteilung (Abteilung II)
a. Die Aufnahmeabteilung
b. Die Vernehmungsabteilung
c. Das Standesamt
d. Der Erkennungsdienst
e. Die Fürsorgeabteilung
3. Die Schutzhaftlagerführung (Abteilung III)
a. Der Schutzhaftlagerführer
b. Der Rapportführer
c. Der Blockführer
4. Die Abteilung Verwaltung (Abteilung IV)
5. Der ärztliche Dienst (Abteilung V)
6. Der Arbeitseinsatz
7. Die Häftlingsfunktionäre
8. Der Wachsturmbann
IV. Unterstellungsverhältnisse, Befehlsweg
V. Die Lebensverhältnisse der Schutzhaftgefangenen
1. Unterbringung
2. Sanitäre und hygienische Verhältnisse im Lager
3. Bekleidung
4. Ernährung
5. Die Arbeitsfron der Gefangenen
6. Krankheiten und Seuchen
7. Richtlinien für die Behandlung der Häftlinge
8. Die tatsächliche Behandlung der Gefangenen im KL Auschwitz durch die SS-Angehörigen und die Häftlingsfunktionäre
VI. Die Disziplin der SS-Angehörigen in Auschwitz
VII. Das KL Auschwitz als Vernichtungslager
1. Das KL Auschwitz als Hinrichtungsstätte für Polen
2. Das KL Auschwitz als Exekutionsstätte für polnische Geiseln
3. Das KL Auschwitz als Exekutionsstätte für russische Kriegsgefangene
4. Das Konzentrationslager Auschwitz als Vernichtungsstätte kranker und entkräfteter Lagerinsassen
5. Das KL Auschwitz als Massenvernichtungsanstalt für die Tötung jüdischer Menschen
Zwischenstück:
Beweismittel und Beweisgrundlagen für die im ersten und
zweiten Abschnitt getroffenen Feststellungen
3. Abschnitt:
Die Straftaten der Angeklagten
A. Die Straftaten des Angeklagten Mulka
I. Lebenslauf des Angeklagten Mulka
II. Die Mitwirkung des Angeklagten Mulka an der Massentötung
jüdischer Menschen in Auschwitz (Tatsächliche Feststellungen)
III. Die Einlassung des Angeklagten Mulka
IV. Beweiswürdigung
1. Allgemeine Vorbemerkung zur Beweiswürdigung
2. Beweisgrundlagen und Beweiswürdigung zu den allgemeinen
Feststellungen über die Abwicklung der sog. RSHA-Transporte
3. Beweiswürdigung im Falle Mulka
V. Rechtliche Würdigung
1. Taten und Strafbarkeit der Haupttäter
2. Strafrechtliche Beurteilung der Beteiligung des Angeklagten
Mulka an den Vernichtungsaktionen
VI. Hilfsbeweisanträge
VII. Strafzumessung
1. Allgemeine Erwägungen zu der Bemessung der Strafen wegen Beihilfe zum Mord
2. Strafzumessung bezüglich des Angeklagten Mulka
B. Die Straftaten des Angeklagten Höcker
I. Lebenslauf des Angeklagten Höcker
II. Die Mitwirkung des Angeklagten Höcker an der Massentötung
jüdischer Menschen in Auschwitz (Tatsächliche Feststellungen)
III. Die Einlassung des Angeklagten Höcker
IV. Beweiswürdigung
V. Rechtliche Würdigung
VI. Hilfsbeweisanträge
VII. Strafzumessung
C. Die Straftaten des Angeklagten Boger
I. Lebenslauf des Angeklagten Boger
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Mitwirkung des Angeklagten Boger an der Massentötung jüdischer Menschen in Auschwitz (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
2. Die Mitwirkung des Angeklagten Boger bei einer sog.
Lagerselektion (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
3. Die Mitwirkung des Angeklagten Boger bei den sog. Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen von Häftlingen an der Schwarzen Wand auf dem Hof zwischen Block 10 und 11 (Eröffnungsbeschluss Ziffer 2 und 3)
4. Die Tötung von Häftlingen bei verschärften Vernehmungen (Eröffnungsbeschluss Ziffer 4)
5. Die Tötung von mindestens 100 Häftlingen nach einem Aufstand des jüdischen Sonderkommandos
III. Die Einlassung des Angeklagten Boger
1. Zu II. 1.
2. Zu II. 2.
3. Zu II. 3.
4. Zu II. 4.
5. Zu II. 5.
IV. Beweisgrundlagen für die Feststellungen unter I. und II., Beweiswürdigung
1. Zu I.
2. Zu II. 1.
3. Zu II. 2.
4. Zu II. 3.
5. Zu II. 4.
6. Zu II. 5.
V. Rechtliche Würdigung
1. Zu II. 1.
2. Zu II. 2.
3. Zu II. 3.
4. Zu II. 4.
5. Zu II. 5.
VI. Hilfsbeweisanträge
VII. Strafzumessung
D. Die Straftaten des Angeklagten St.
I. Der Lebenslauf des Angeklagten St.
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Mitwirkung des Angeklagten St. an Erschiessungen im kleinen Krematorium (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
2. Die Mitwirkung des Angeklagten St. bei der Erschiessung von zwei Kindern (EB 1)
3. Die Mitwirkung des Angeklagten St. bei der Tötung jüdischer Menschen durch Gas im kleinen Krematorium (Eröffnungsbeschluss Ziffer 3)
4. Die Mitwirkung des Angeklagten St. bei der Tötung jüdischer Menschen, die ab Sommer 1942 mit Eisenbahnzügen nach Auschwitz deportiert und auf der alten Rampe selektiert wurden (Eröffnungsbeschluss Ziffer 4)
5. Die Mitwirkung des Angeklagten St. bei weiteren Vergasungen von jüdischen Menschen im kleinen Krematorium im Mai und Juni 1942, die nicht angeklagt sind und die in dem Eröffnungsbeschluss dem Angeklagten St. nicht zur Last gelegt werden
III. Einlassung des Angeklagten St., Beweismittel und Beweiswürdigung
1. Zu I.
2. Zu II. 1. a. und b.
3. Zu II. 2.
4. Zu II. 3.
5. Zu II. 4.
6. Zu II. 5.
IV. Rechtliche Würdigung
1. Zu II. 1., 3., 4.
2. Zu II. 2.
3. Zu II. 5.
V. Anwendung des Jugendstrafrechts auf den Angeklagten St.
VI. Hilfsbeweisanträge
VII. Strafzumessung
E. Die Straftaten des Angeklagten Dylewski
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Dylewski
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Mitwirkung des Angeklagten Dylewski an der Massentötung jüdischer Menschen in Auschwitz (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
2. Die Beteiligung des Angeklagten Dylewski an den sog. Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen der für den Tod ausgesuchten Häftlingen (Eröffnungsbeschluss Ziffer 2, 3 und 4)
III. Einlassung des Angeklagten Dylewski, Beweismittel, Beweiswürdigung
1. Zu I.
2. Zu II. 1.
3. Zu II. 2.
IV. Rechtliche Würdigung
1. Zu II. 1.
2. Zu II. 2.
V. Strafzumessung
F. Die Straftaten des Angeklagten Broad
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Broad
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Mitwirkung des Angeklagten Broad an der Massentötung jüdischer Menschen in Auschwitz (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
2. Die Beteiligung des Angeklagten Broad an den sog. Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen an der Schwarzen Wand (Eröffnungsbeschluss Ziffer 2)
III. Einlassung des Angeklagten Broad, Beweismittel, Beweiswürdigung
1. Zu I.
2. Zu II. 1.
3. Zu II. 2.
IV. Rechtliche Würdigung der unter II getroffenen Feststellungen
1. Zu II. 1.
2. Zu II. 2.
V. Strafzumessung
G. Die Straftaten des Angeklagten Schlage
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Schlage
II. Die Beteiligung des Angeklagten Schlage an sog. Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen von Häftlingen an der Schwarzen Wand (Eröffnungsbeschluss betr. den Angeklagten Schlage)
III. Einlassung des Angeklagten Schlage, Beweismittel, Beweiswürdigung
IV. Rechtliche Würdigung der unter II getroffenen Feststellungen
V. Strafzumessung
H. Die Straftaten des Angeklagten Hofmann
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Hofmann
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Mitwirkung des Angeklagten Hofmann an der Massentötung jüdischer Menschen in Auschwitz (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
2. Die Mitwirkung des Angeklagten Hofmann bei den sog. Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen von Häftlingen an der Schwarzen Wand auf dem Hof zwischen Block 10 und 11 (Eröffnungsbeschluss 2)
3. Die Tötung eines Häftlings durch einen Flaschenwurf (Eröffnungsbeschluss 6)
4. Weitere Taten des Angeklagten Hofmann, die nicht angeklagt und nicht im Eröffnungsbeschluss enthalten sind
III. Einlassung des Angeklagten Hofmann, Beweismittel, Beweiswürdigung
1. Zu I.
2. Zu II. 1.
3. Zu II. 2.
4. Zu II. 3.
5. Zu II. 4.
IV. Rechtliche Würdigung
1. Zu II. 1.
2. Zu II. 2.
3. Zu II. 3.
4. Zu II. 4.
V. Hilfsbeweisanträge
J. Die Straftaten des Angeklagten Kaduk
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Kaduk
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Auswahl kranker und arbeitsunfähiger Häftlinge im Stammlager zur Vergasung durch den Angeklagten Kaduk (Eröffnungsbeschluss 1a)
2. Die Tötung eines Häftlings durch den Angeklagten Kaduk (Eröffnungsbeschluss 7)
3. Die Tötung eines Häftlings im September oder Oktober 1943 (Eröffnungsbeschluss 18)
4. Die Tötung von drei Häftlingen im September oder Oktober 1943 im Quarantänelager in Birkenau (Eröffnungsbeschluss Ziffer 19)
5. Die Tötung eines Häftlings im Spätsommer oder Herbst 1943 (Eröffnungsbeschluss Ziffer 20)
6. Die Tötung eines Zigeuners im Sommer 1944 im Stammlager (Eröffnungsbeschluss Ziffer 21)
7. Die Tötung von drei Häftlingen auf dem Evakuierungsmarsch (Eröffnungsbeschluss Ziffer 24)
III. Einlassung des Angeklagten Kaduk, Beweismittel, Beweiswürdigung
1. Zu II. 1.
2. Zu II. 2.
3. Zu II. 3., 4. und 5.
4. Zu II. 6.
5. Zu II. 7.
IV. Rechtliche Würdigung
1. Zu II. 1.a. und b.
2. Zu II. 2.
3. Zu II. 3.
4. Zu II. 4.
5. Zu II. 5.
6. Zu II. 6.
7. Zu II. 7.
K. Die Straftaten des Angeklagten Baretzki
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Baretzki
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Mitwirkung des Angeklagten Baretzki an der Massentötung jüdischer Menschen in Auschwitz (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
2. Die Mitwirkung des Angeklagten Baretzki bei den sog. Lagerselektionen (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
3. Die Tötung des Häftlings Lischka durch den Angeklagten Baretzki (Eröffnungsbeschluss Ziffer 6)
4. Die Beteiligung des Angeklagten Baretzki an der Vernichtung der im sog. Theresienstädter Lager (B II b) untergebrachten jüdischen Häftlinge im März 1944 (Eröffnungsbeschluss Ziffer 9)
5. Die Ertränkung von vier Häftlingen durch den Angeklagten Baretzki in einem Feuerlöschteich (Nachtragsanklage)
6. Weitere Taten des Angeklagten Baretzki, die nicht angeklagt und nicht im Eröffnungsbeschluss enthalten sind
III. Einlassung des Angeklagten Baretzki, Beweismittel, Beweiswürdigung
1. Zu I.
2. Zu II. 1.
3. Zu II. 2.
4. Zu II. 3.
5. Zu II. 4.
6. Zu II. 5.
7. Zu II. 6.
IV. Rechtliche Würdigung
1. Zu II. 1.
2. Zu II. 2.
3. Zu II. 3.
4. Zu II. 4.
5. Zu II. 5.
6. Zu II. 6.
V. Hilfsbeweisanträge
VI. Strafzumessung
L. Die Straftaten des Angeklagten Dr. L.
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Dr. L.
II. Die Mitwirkung des Angeklagten Dr. L. an der Massentötung jüdischer Menschen in Auschwitz (Tatsächliche Feststellungen)
III. Einlassung des Angeklagten Dr. L., Beweismittel, Beweiswürdigung
IV. Rechtliche Würdigung
V. Hilfsbeweisanträge
VI. Strafzumessung
M. Die Straftaten des Angeklagten Dr. Frank
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Dr. Frank
II. Die Mitwirkung des Angeklagten Dr. Frank an der Massentötung jüdischer Menschen in Auschwitz (Tatsächliche Feststellungen)
III. Die Einlassung des Angeklagten Dr. Frank, Beweismittel, Beweiswürdigung
IV. Rechtliche Würdigung
V. Hilfsbeweisanträge
VI. Strafzumessung
N. Die Straftaten des Angeklagten Dr. Capesius
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Dr. Capesius
II. Die Mitwirkung des Angeklagten Dr. Capesius an der Massentötung der jüdischen Menschen in Auschwitz Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
III. Einlassung des Angeklagten Dr. Capesius, Beweismittel, Beweiswürdigung
Zu II. 1.
Zu II. 2.
Zu II. 3.
Zu II. 4.
IV. Rechtliche Würdigung
V. Hilfsbeweisanträge
VI. Weitere Hilfsbeweisanträge des Verteidigers Dr. Latern. für sämtliche von ihm vertretenen Angeklagten (Dylewski, Broad, Dr. Frank, Dr. Capesius)
VII. Strafzumessung
O. Die Straftaten des Angeklagten Klehr
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Klehr
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Mitwirkung des Angeklagten Klehr bei Selektionen durch den Lagerarzt im HKB und die Tötung der durch den Lagerarzt ausgesonderten Häftlinge durch den Angeklagten Klehr (Eröffnungsbeschluss Ziffer 2)
2. Eigenmächtige Selektionen und eigenmächtige Tötungen von Häftlingen durch den Angeklagten Klehr (Eröffnungsbeschluss Ziffer 2 Satz 2, zweite Hälfte)
3. Eigenmächtige Selektionen durch den Angeklagten Klehr im HKB, durch die kranke Häftlinge zur Tötung mit Zyklon B ausgesucht wurden (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1, zweiter Halbsatz)
4. Die Mitwirkung des Angeklagten Klehr bei der Tötung von 280 Schonungskranken aus dem Block 20 des Häftlingskrankenbaus (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1a)
5. Die Mitwirkung des Angeklagten Klehr bei der Tötung von 700 Infektionskranken (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1b)
6. Die Mitwirkung des Angeklagten Klehr bei der Massentötung der sog. RSHA-Juden (Eröffnungsbeschluss Ziffer 3, Ziffer 1, erster Halbsatz)
7. Die Mitwirkung des Angeklagten Klehr bei der Tötung des jüdischen Sonderkommandos in Stärke von 200 Mann (Eröffnungsbeschluss Ziffer 3)
8. Einzeltötungen durch den Angeklagten Klehr durch Phenolinjektionen (Ziffer 2 des Eröffnungsbeschlusses)
III. Die Einlassung des Angeklagten Klehr, Beweismittel, Beweiswürdigung
1. Zu I.
2. Zu II. 1.
3. Zu II. 2a.
4. Zu II. 2b.
5. Zu II. 2c.
6. Zu II. 2d.
7. Zu II. 3a.
8. Zu II. 3b.
9. Zu II. 4
10. Zu II. 5.
11. Zu II. 6a.
12. Zu II. 6b.
13. Zu II. 7.
14. Zu II. 8a.
15. Zu II. 8b.
16. Zu II. 8c.
17. Zu II. 8d.
18. Zu II. 8e.
IV. Rechtliche Würdigung
1. Zu II. 1.
2. Zu II. 2a-d.
3. Zu II. 3a.
4. Zu II. 3b.
5. Zu II. 4.
6. Zu II. 5.
7. Zu II. 6a und b.
8. Zu II. 7.
9. Zu II. 8a und e.
10. Zu II. 8b.
11. Zu II. 8c.
12. Zu II. 8d.
V. Hilfsbeweisanträge
VI. Strafzumessung
P. Die Straftaten des Angeklagten Scherpe
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Scherpe
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Mitwirkung des Angeklagten Scherpe bei der Tötung von sog. Arztvorstellern durch Phenolinjektionen in Block 20 (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
2. Die Tötung von mindestens 20 polnischen Knaben durch den Angeklagten Scherpe
3. Die Mitwirkung des Angeklagten Scherpe bei der Vernichtung der 700 Infektionskranken aus Block 20 (Eröffnungsbeschluss Ziffer 2)
III. Einlassung des Angeklagten Scherpe, Beweismittel, Beweiswürdigung
1. Zu I.
2. Zu II. 1.
3. Zu II. 2.
4. Zu II. 3.
IV. Rechtliche Würdigung
1. Zu II. 1.
2. Zu II. 2.
3. Zu II. 3.
V. Strafzumessung
Q. Die Straftaten des Angeklagten Hantl
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Hantl
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Mitwirkung des Angeklagten Hantl bei der Tötung von kranken und schwachen Häftlingen durch Phenol
2. Die Beteiligung des Angeklagten Hantl an Selektionen durch den Lagerarzt Dr. Entress im HKB
III. Einlassung des Angeklagten Hantl, Beweismittel, Beweiswürdigung
1. Zu I.
2. Zu II. 1.
3. Zu II. 2.
IV. Rechtliche Würdigung
1. Zu II. 1.
2. Zu II. 2.
V. Strafzumessung
R. Die Straftaten des Angeklagten Bednarek
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Bednarek
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Tötung von Häftlingen im Block 8A des Stammlagers durch den Angeklagten Bednarek (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
2. Die Tötung von Häftlingen in der Strafkompanie durch den Angeklagten Bednarek (Eröffnungsbeschluss: Obersatz und Ziffern 2 und 7)
3. Die Tötung von Häftlingen aus dem sog. Siemens-Kommando im Block 11 (Lagerabschnitt B II d)
III. Einlassung des Angeklagten Bednarek, Beweismittel, Beweiswürdigung
1. Zu II. 1a.
2a. Zu II. 1b.
2b. Zu II. 2a und b.
3. Zu II. 2c.
4. Zu II. 2d.
5. Zu II. 3.
6. Zu II. 3c.
7. Zu II. 3d.
IV. Rechtliche Würdigung
4. Abschnitt:
Die Schuldvorwürfe gegen die freigesprochenen Angeklagten Sch., B. und Dr. Sc.
1. Die Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Sch.
Zu a.
Zu b.
Zu c.
2. Der Schuldvorwurf gegen den Angeklagten B.
3. Der Schuldvorwurf gegen den Angeklagten Dr. Sc.
5. Abschnitt:
Weitere Schuldvorwürfe gegen die Angeklagten Mulka, Höcker, Boger, St., Dylewski, Broad, Schlage, Hofmann, Kaduk, Baretzki, Dr. Capesius, Klehr und Bednarek, die nicht zu einer Verurteilung dieser Angeklagten führten
I. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Mulka
1. Beteiligung an der Vernichtung jüdischer Menschen als Kompanieführer einer Wacheinheit
2. Tötung von Lagerinsassen
3. Erschiessung von drei jüdischen Häftlingen (Nachtragsanklage)
II. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Höcker
III. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Boger
1. Selektion im Zigeunerlager
2. Erschiessung von sowjetischen Kriegsgefangenen
3. Misshandlung mit Todesfolge bei Vernehmungen
4. Erschiessung der Lilli Tofler
5. Erschiessung der Journalistin Novotny
6. Erschiessung eines jungen jüdischen Häftlings
7. Erschiessung von 46 Häftlingen des Kommandos "Union"
8. Erhängung von Häftlingen am 30.12.1944
9. "Liquidierung" des Zigeunerlagers im Sommer 1944
IV. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten St.
1. Erschiessungen an der Schwarzen Wand
2. Erschiessung sowjetischer Kommissare
3. Erschiessung eines Häftlings an der Schwarzen Wand im Frühjahr 1942
4. Tötung von Häftlingen der Strafkompanie (Nachtragsanklage)
V. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Dylewski
1. Erschiessung von sowjetischen Kriegsgefangenen
2. Misshandlung mit Todesfolge beim Verhör
VI. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Broad
VII. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Schlage
VIII. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Hofmann
1. Misshandlungen mit Todesfolge
2. Erschiessung eines Juden
3. Tötung von sowjetischen Kriegsgefangenen
4. Tötung von Kindern zwischen 6 und 12 Jahren
5. Auswahl von etwa 600 Häftlingen zur Vergasung
IX. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Kaduk
1. Misshandlung mit Todesfolge
2. Erschiessungen an der Schwarzen Wand
3. Erhängung von Häftlingen am 30.12.1944
4. Tötung des holländischen Häftlings Ackermann
X. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Baretzki
1. Tötungen durch einen "Spezialschlag" mit der Hand
2. Erhängung von Häftlingen
3. Tötung am elektrisch geladenen Lagerzaun
4. Beteiligung an einer sog. "Hasenjagd"
5. Tötung eines Häftlings im Barackengang
6. Tötung einer Frau aus Lodz
7. Tötung von Häftlingen nach einem Aufstand
8. Erschiessung eines jüdischen Häftlings im Lager Birkenau
XI. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Dr. Capesius
1. Selektionen im Lager Birkenau
2. Medizinische Versuche an Häftlingen mit Todesfolge
3. Verwaltung und Verteilung des zur Tötung der Häftlinge verwendeten Phenols
XII. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Klehr
1. Aussonderung von Häftlingen zur Vergasung
2. Weitere Tötungshandlungen
3. Tötung des Häftlings Rudek durch "Sportmachen"
4. Feuertod zweier Jüdinnen
XIII. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Bednarek
1. Tötung von Häftlingen der Strafkompanie
2. Liquidierung des Familienlagers
3. Tötung eines Ungarn
4. Tötung eines Häftlings mit einem Schaufelstiel
6. Abschnitt:
Verfahrensvoraussetzungen, Prozesshindernisse
I. Kein Verbot der Doppelbestrafung beim Angeklagten Kaduk
II. Keine Verjährung der Straftaten der Angeklagten
1. Verjährungsfrist
2. Beginn und Unterbrechung der Verjährung
7. Abschnitt:
Nebenentscheidungen
I. Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte
II. Anrechnung der Untersuchungshaft
III. Kostenentscheidung
4 Ks 2/63
Im Namen des Volkes
In der Strafsache gegen
1. den Exportkaufmann Robert Karl Ludwig Mulka aus Hamburg, dort geboren am 12.April 1895, zur Zeit in Untersuchungshaft,
2. den Hauptkassierer Karl Höcker aus Lübbecke, geboren am 11.Dezember 1911 in Engershausen, Kreis Lübbecke, zur Zeit in Untersuchungshaft,
3. den kaufmännischen Angestellten Friedrich Wilhelm Boger aus Memmingen, geboren am 19.Dezember 1906 in Stuttgart-Zuffenhausen, zur Zeit in Untersuchungshaft,
4. den Assessor der Landwirtschaft Hans St. aus Darmstadt, dort geboren am 14.Juni 1921, zur Zeit in Untersuchungshaft,
5. den Diplom-Ingenieur Klaus Hubert Hermann Dylewski aus Hilden/Rheinland, geboren am 11.Mai 1916 in Finkenwalde, Krs.Stettin, zur Zeit in Untersuchungshaft,
6. den Kaufmann Pery Broad aus Düsseldorf-Rath, geboren am 25.4.1921 in Rio de Janeiro, zur Zeit in Untersuchungshaft,
7. den Landwirt Sch. aus ..., dort geboren am 17.Dezember 1922,
8. den Hausmeister Bruno Schlage aus Dehne - Bad Oeynhausen, geboren am 11.Februar 1903 in Truttenau, Krs.Königsberg, zur Zeit in Untersuchungshaft,
9. den Heizer Franz Johann Hofmann aus Kirchberg a.d.Jagst, geboren am 5.April 1906 in Hof/Saale, zur Zeit in anderer Sache in Strafhaft,
10. den Krankenpfleger Oswald Kaduk aus Berlin, geboren am 26.August 1906 in Königshütte/Oberschlesien, zur Zeit in Untersuchungshaft,
11. den Arbeiter Stefan Baretzki aus Plaidt/Eifel, geboren am 24.März 1919 in Czernowitz/Rumänien, zur Zeit in Untersuchungshaft,
12. den kaufmännischen Angestellten B. aus Bad Godesberg, geboren am 31.Juli 1910 in Lemberg/Galizien,
13. den Facharzt für Frauenkrankheiten Dr.med. L. aus Elmshorn, geboren am 15.September 1911 in Osnabrück, zur Zeit in Untersuchungshaft,
14. den Zahnarzt Dr.med.dent. Willi Frank aus Stuttgart - Bad Cannstatt, geboren am 9.Februar 1903 in Regensburg, zur Zeit in Untersuchungshaft,
15. den Zahnarzt Dr.med.dent. Sc. aus Hannover, geboren am 1.Februar 1905 in Hannover,
16. den Apotheker Dr. Victor Capesius aus Göppingen, geboren am 7.Februar 1907 in Reussmarkt/Rumänien, zur Zeit in Untersuchungshaft,
17. den Tischler Josef Klehr aus Braunschweig, geboren am 17.Oktober 1904 in Langenau (Kreis Leobschütz/Oberschlesien), zur Zeit in Untersuchungshaft,
18. den Pförtner Herbert Scherpe aus Mannheim, geboren am 20.Mai 1907 in Gleiwitz, zur Zeit in Untersuchungshaft,
19. den Weber Emil Hantl aus Marktredwitz, geboren am 14.Dezember 1902 in Mährisch-Lotschnau, zur Zeit in Untersuchungshaft,
20. den Kaufmann Emil Bednarek aus Schirnding, geboren am 20.Juli 1907 in Königshütte, zur Zeit in Untersuchungshaft,
wegen Mordes und wegen Beihilfe zum Mord
hat das Schwurgericht bei dem Landgericht in Frankfurt/Main auf die Hauptverhandlung in der Zeit vom 20.Dezember 1963 bis 20.August 1965 am 19. und 20.August 1965 für Recht erkannt:
A.I. Es sind schuldig:
1. der Angeklagte Mulka der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in mindestens vier Fällen an mindestens je
siebenhundertfünfzig Menschen,
2. der Angeklagte Höcker der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in mindestens drei Fällen an mindestens je tausend Menschen,
3. der Angeklagte Boger des Mordes in mindestens einhundertvierzehn Fällen und der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord an mindestens tausend Menschen sowie einer weiteren gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord an mindestens zehn Menschen,
4. der Angeklagte St. des gemeinschaftlichen Mordes in mindestens vierundvierzig Fällen, davon in einem Fall begangen an mindestens zweihundert Menschen und in einem weiteren Fall an mindestens hundert Menschen,
5. der Angeklagte Dylewski der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in mindestens zweiunddreissig Fällen, davon in zwei Fällen begangen an mindestens je siebenhundertfünfzig Menschen,
6. der Angeklagte Broad der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in mindestens zweiundzwanzig Fällen, davon in zwei Fällen begangen an mindestens je tausend Menschen,
7. der Angeklagte Schlage der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in mindestens achtzig Fällen, 8. der Angeklagte Hofmann des Mordes in einem Fall, des gemeinschaftlichen Mordes in mindestens dreissig Fällen, sowie des gemeinschaftlichen Mordes in mindestens drei weiteren Fällen an je mindestens siebenhundertfünfzig Menschen,
9. der Angeklagte Kaduk des Mordes in zehn Fällen und des gemeinschaftlichen Mordes in mindestens zwei Fällen, begangen in einem Fall an mindestens tausend, in dem anderen an mindestens zwei Menschen,
10. der Angeklagte Baretzki des Mordes in mindestens fünf Fällen sowie der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in mindestens elf Fällen, davon in einem Fall begangen an mindestens dreitausend Menschen, in fünf Fällen begangen an mindestens je tausend Menschen und in fünf Fällen begangen an mindestens je fünfzig Menschen,
11. der Angeklagte Dr. L. ~.....~,
12. der Angeklagte Dr. Frank der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in mindestens sechs Fällen an mindestens je tausend Menschen,
13. der Angeklagte Dr. Capesius der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in mindestens vier Fällen an mindestens je zweitausend Menschen,
14. der Angeklagte Klehr des Mordes in mindestens vierhundertfünfundsiebzig Fällen und der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in mindestens sechs Fällen, davon in zwei Fällen begangen an mindestens je
siebenhundertfünfzig Menschen; im 3. Falle an mindestens zweihundertundachtzig Menschen, im 4. Falle an mindestens siebenhundert Menschen, im 5. Falle an mindestens zweihundert Menschen und im 6. Falle an mindestens fünfzig Menschen,
15. der Angeklagte Scherpe der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in mindestens zweihundert Fällen und einer weiteren gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord an mindestens siebenhundert Menschen,
16. der Angeklagte Hantl der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in mindestens vierzig Fällen und der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in zwei weiteren Fällen an mindestens je einhundertsiebzig Menschen,
17. der Angeklagte Bednarek des Mordes in vierzehn Fällen.
II. Es werden danach unter Freisprechung im übrigen verurteilt:
1. der Angeklagte Mulka zu einer Gesamtzuchthausstrafe von vierzehn Jahren;
2. der Angeklagte Höcker zu einer Gesamtzuchthausstrafe von sieben Jahren;
3. der Angeklagte Boger zu lebenslangem Zuchthaus und einer Gesamtstrafe von fünf Jahren Zuchthaus;
4. der Angeklagte St. zu zehn Jahren Jugendstrafe;
5. der Angeklagte Dylewski zu einer Gesamtstrafe von fünf Jahren Zuchthaus;
6. der Angeklagte Broad zu einer Gesamtstrafe von vier Jahren Zuchthaus;
7. der Angeklagte Schlage zu einer Gesamtstrafe von sechs Jahren Zuchthaus;
8. der Angeklagte Hofmann zu lebenslangem Zuchthaus;
9. der Angeklagte Kaduk zu lebenslangem Zuchthaus;
10. der Angeklagte Baretzki zu lebenslangem Zuchthaus und einer Gesamtstrafe von acht Jahren Zuchthaus;
11. der Angeklagte Dr. L. ~.....~;
12. der Angeklagte Dr. Frank zu einer Gesamtzuchthausstrafe von sieben Jahren;
13. der Angeklagte Dr. Capesius zu einer Gesamtzuchthausstrafe von neun Jahren;
14. der Angeklagte Klehr zu lebenslangem Zuchthaus und einer Gesamtstrafe von fünfzehn Jahren Zuchthaus;
15. der Angeklagte Scherpe zu einer Gesamtstrafe von vier Jahren und sechs Monaten Zuchthaus;
16. der Angeklagte Hantl zu einer Gesamtstrafe von drei Jahren und sechs Monaten Zuchthaus, die durch die erlittene Untersuchungshaft als verbüsst gilt;
17. der Angeklagte Bednarek zu lebenslangem Zuchthaus.
III. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden aberkannt:
1. den Angeklagten Boger, Hofmann, Kaduk, Baretzki, Klehr und Bednarek auf Lebenszeit;
2. dem Angeklagten Mulka auf die Dauer von zehn Jahren;
3. dem Angeklagten Schlage auf die Dauer von sechs Jahren;
4. den Angeklagten Höcker, Dr. Frank, Dr. Capesius auf die Dauer von je fünf Jahren;
5. den Angeklagten Dylewski, Broad und Scherpe auf die Dauer von je vier Jahren und
6. dem Angeklagten Hantl auf die Dauer von drei Jahren.
IV. Den Angeklagten Mulka, Höcker, Boger, St., Dylewski, Broad, Schlage, Baretzki, Dr. L., Dr. Frank, Dr. Capesius, Klehr und Scherpe wird die in dieser Sache erlittene Polizei- und Untersuchungshaft auf die erkannten zeitigen Freiheitsstrafen angerechnet.
B. Die Angeklagten Sch., B. und Dr. Sc. werden freigesprochen.
C. Die Angeklagten tragen die Kosten des Verfahrens, soweit sie verurteilt sind, im übrigen fallen die Kosten der Staatskasse zur Last.
GRÜNDE
1. Abschnitt:
Die Einrichtung und Entwicklung der Konzentrationslager im NS-Staat
Bald nach der sogenannten Machtübernahme am 30.1.1933 errichteten die NS-Machthaber Lager, in die sie politische Gegner einsperrten und dort, abgeschirmt gegen die Öffentlichkeit, den Rechtsgarantien eines Rechtsstaates entzogen und der Willkür der Bewachungsmannschaften ausgesetzt, gefangenhielten. Hierdurch sollten die politischen Gegner aus dem politischen öffentlichen Leben ausgeschaltet und jede Opposition gegen das NS-Regime von Anfang an unterdrückt werden. Die Einweisung in die Lager erfolgte auf Grund eines schriftlichen "Schutzhaftbefehls" der von den zuständigen Polizeibehörden ohne richterliche Nachprüfung erlassen werden konnte. Grundlage für diese Massnahmen der Polizeibehörden war die nach dem Reichstagsbrand erlassene Notverordnung zum Schutze von Volk und Staat vom 28.2.1933 (RGBl. I, 83), die verschiedene in der Weimarer Verfassung verankerte Grundrechte, u.a. das Grundrecht der Unverletzlichkeit der persönlichen Freiheit, aufhob. Die Befugnis zur Schutzhaftverhängung stand nach den auf Grund der Notverordnung vom 28.2.1933 ergangenen ersten preussischen Erlassen zur Durchführung der "Schutzmassnahmen" den Kreispolizeibehörden zu. Die "Schutzhaft" sollte offiziell vorbeugende Polizeimassnahme zur Ausschaltung sogenannter Staatsgegner sein. Sie war also keine Strafmassnahme zur Ahndung strafbarer Handlungen.
Die NS-Führer, an ihrer Spitze Hitler, Göring, Röhm, der Stabschef der SA, und Himmler, der Reichsführer SS, hatten schon während des Kampfes um die Macht im Staat deutlich ihre Absicht proklamiert, nach der Übernahme der Macht mit den Kommunisten und anderen Feinden der nationalsozialistischen Bewegung abzurechnen. Die Notverordnung zum Schutze für Volk und Staat diente nun der Verwirklichung dieses Vorhabens. Damit die Verhaftung politischer Gegner gründlich durchgeführt werde, räumten die neuen Machthaber Angehörigen der SA und SS hilfspolizeiliche Befugnisse ein. Diese halfen bei der sofort nach dem Erlass der genannten Verordnung im gesamten Reichsgebiet einsetzenden Grossaktion, die zur massenweisen Verhaftung von Angehörigen der kommunistischen Partei und ihrer Gliederungen, gegen die sich die Verhaftungswelle in erster Linie richtete, aber auch zur Festnahme anderer politischer Gegner der NS-Bewegung führte, mit. Darüber hinaus gingen bewaffnete Verbände der SA und SS, die den durch die Verordnung vom 28.2.1933 geschaffenen Ausnahmezustand ausnützten, auch eigenmächtig gegen politische Gegner vor. Sie verhafteten und misshandelten willkürlich und ohne Einschaltung der Polizei sogenannte Staatsfeinde.
In der allerersten Zeit waren die auf Grund eines Schutzhaftbefehls festgenommenen Personen noch in Untersuchungshaftanstalten und Gefängnissen der Justiz untergebracht worden. Heinrich Himmler, der am 9.März 1933 in München als kommissarischer Polizeipräsident eingesetzt worden war und am 1.4.1934 zum politischen Polizeikommandeur Bayerns ernannt wurde, liess bereits am 20.3.1933 in der Nähe von Dachau bei München für die Schutzhaftgefangenen das erste Konzentrationslager errichten. Die Leitung des Lagers übertrug er der SS. Der äussere Grund für die Errichtung dieses Lagers waren die infolge der Massenverhaftungen eingetretene Überfüllung der justizeigenen Anstalten und die dadurch hervorgerufenen Vorstellungen der Justiz, die die Durchführung einer geordneten Rechtspflege gefährdet sah und darauf drängte, die Schutzhaftgefangenen loszuwerden. Der wahre innere Grund dürfte aber schon damals in dem Bestreben Himmlers und anderer NS-Führer gelegen haben - das im späteren Verlauf der Entwicklung der Konzentrationslager immer deutlicher wurde -, für die Schutzhaftgefangenen einen von der Öffentlichkeit abgeschirmten Bezirk zu schaffen, einen Staat im Staate, der jeglicher Kontrolle durch Einflussnahme durch die Öffentlichkeit und insbesondere die Justiz entzogen war.
Ausser in Dachau wurden im Verlaufe des Jahres 1933 weitere Lager für die in Schutzhaft genommenen Personen eingerichtet, die von den SA- oder SS-Angehörigen bewacht wurden. Im Sommer und Herbst 1933 wurden in verstärktem Masse Sozialdemokraten, Zentrumsangehörige, Deutschnationale, jüdische Journalisten und Schriftsteller und andere missliebige Gruppen von Personen verhaftet und in diese Lager eingewiesen. Örtliche SA- und SS-Dienststellen richteten darüber hinaus für die eigenmächtig festgenommenen politischen Gegner besondere Lager ein. Die in diesen sogenannten "wilden" Lagern herrschenden Missstände und die darin vorkommenden Exzesse beunruhigten schliesslich sogar die Führer der NS-Bewegung, zumal Hitler Rücksicht auf die Reichswehr und den Reichspräsidenten von Hindenburg nehmen musste.
Göring ordnete daher als preussischer Innenminister in einem Runderlass vom 14.10.1933 an, dass aus politischen Gründen inhaftierte Personen grundsätzlich in staatlichen Konzentrationslagern oder in staatlichen oder kommunalen Polizeigefängnissen in Gewahrsam zu halten seien. Nur wenige Konzentrationslager wurden staatlich anerkannt. Die "wilden" SA-Lager wurden allmählich aufgelöst.
Aber auch in den staatlich anerkannten Konzentrationslagern herrschten Willkür und Gewalt. Die Gefangenen waren dem Terror der Wachmannschaft ausgesetzt. Der erste Kommandant von Dachau, Wäckerle, erliess auf Befehl Himmlers scharfe "Sonderbestimmungen" für die Gefangenen, die aus einem System von Strafen und Klassifizierungen der Gefangenen bestand. Unter anderem sahen sie das "Standrecht", d.h. die Erschiessung von Gefangenen bei Fluchtversuchen und ein sogenanntes "Lagergericht" - bestehend aus dem Kommandanten, einem oder zwei vom Kommandeur zu bestimmenden Führern und einem der Wachtruppe angehörenden SS-Mann - , das sogar zur Verhängung der Todesstrafe bei geringfügigen Lagervergehen befugt sein sollte, vor. Für die Bewachungsmannschaften gab es keine genauen Dienstvorschriften. Sie behandelten die Gefangenen nach Willkür und eigenem Gutdünken. Bestrebungen der staatlichen Verwaltungsorgane (Reichsinnenministerium), die ausserordentliche Einrichtung der Schutzhaft und der Konzentrationslager nach den Massenverhaftungen im Jahre 1933 einzuschränken, wenn nicht gar zu beseitigen, scheiterten. Durch den Schutzhafterlass des Reichsinnenministers vom 12./26.4.1934, der Ausdruck dieser Bestrebungen war, sollte ein einheitliches Vorgehen der politischen Polizei in den einzelnen Ländern des Reiches sichergestellt und die Verhängung von Schutzhaft reduziert und "normalisiert" werden. Der Erlass verfügte, dass zur Anordnung der Schutzhaft in Preussen nur noch das Geheime Staatspolizeiamt, die Ober- und Regierungspräsidenten, der Polizeipräsident in Berlin, die Stapoleitstellen in den Regierungsbezirken (also nicht mehr die Kreispolizeibehörden) und in den anderen Ländern die entsprechenden Behörden zuständig sein sollten. Der Erlass enthielt ferner genaue Richtlinien über die Prozedur bei der Ausstellung von Schutzhaftbefehlen.
Der Einfluss des Reichsinnenministerium auf die Praxis der Schutzhaftverhängung blieb jedoch gering, obwohl durch das Gesetz über den Neuaufbau des Reiches vom 30.1.1934 die Souveränität der Landesregierungen erloschen und auf das Reich übergegangen war und das Reichsinnenministerium über die Reichsstatthalter unmittelbares Weisungsrecht gegenüber den Landesregierungen erhalten hatte. Himmlers Macht war stärker. Es gelang ihm, im Verlaufe weniger Monate die Führung der politischen Polizei in allen Ländern des Reiches - ausser in Preussen - in seiner Hand zu vereinigen. Er erreichte, dass er im Laufe des Winters 1933/1934 von den einzelnen Landesregierungen bzw. den Reichsstatthaltern der deutschen Länder (ausser in Preussen) zum politischen Polizeikommandeur jeweils ihrer Länder ernannt wurde. Aber auch in Preussen erlangte er praktisch die Führung der politischen Polizei. Hier wurde durch das Gesetz vom 26.4.1933 (Gesetzessammlung S.122) "Zur Wahrnehmung der Aufgaben der politischen Polizei neben oder an Stelle der ordentlichen Polizeibehörden" das "Geheime Staatspolizeiamt" (Gestapa, mit Sitz in der Prinz-Albrecht-Strasse in Berlin) errichtet, das dem preussischen Minister des Innern (Göring) unmittelbar unterstand. Durch Gesetz vom 30.11.1933 (GS S.413) wurde die Geheime Staatspolizei selbständiger Zweig der inneren Verwaltung. Das Gestapa wurde direkt dem Ministerpräsidenten (Göring) unterstellt. Dieser setzte als seinen Vertreter den Reichsführer SS Himmler mit der Dienstbezeichnung "Inspekteur der Geheimen Staatspolizei" ein. Himmler hatte damit die Führung und Aufsicht über die gesamte politische Polizei im Reich inne. Zudem wurde am 22.4.1934 der ihm als Reichsführer SS unterstehende SS-Führer Heydrich Chef der Gestapo. So hatte Himmler die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass er im Bereich der Schutzhaftverhängung und der KZ-Angelegenheiten die Dinge nach seinem Willen lenken konnte. Die ihm unterstellte politische Polizei beachtete in der Praxis den genannten Schutzhafterlass, der bis Januar 1938 formell in Kraft blieb, wenig. Himmler lehnte eine Einschränkung oder gar Beseitigung der Schutzhaft scharf ab. Die Verhängung der Schutzhaft durch Polizeiorgane ohne irgendeine Kontrolle sah er als ein geeignetes Instrument zur Ausschaltung politischer Gegner oder anderweitig unerwünschter oder gefährlich erscheinender Personen an. Dieses Mittel wollte er nicht mehr aus der Hand geben. Die Konzentrationslager sollten nach seinem Willen zu einer festen und dauerhaften Einrichtung des NS-Staates werden. Hierbei fand er die ausdrückliche Billigung Hitlers, der der Justiz misstraute und die zur Ausschaltung politischer Gegner geschaffenen Sondergerichte nicht für ausreichend ansah. Nach Himmlers Vorstellungen sollten die Konzentrationslager Bezirke "eigenen Rechtes" bleiben. Sie sollten nicht den staatlichen Strafgesetzen unterstehen und dem Einfluss der ordentlichen Strafjustiz entzogen werden. In ihnen wollte er mit der ihm unterstellten SS nach eigenem Ermessen, das jeder Kontrolle entzogen war, und nach eigenen "Rechtsvorstellungen" schalten und walten.
Die Ereignisse um den sogenannten Röhm-Putsch am 30.6.1934 kamen diesen Bestrebungen entgegen. Nachdem die von Röhm geführte SA nach dem sogenannten Putsch und Tode Röhms unter massgeblicher Mitwirkung der SS entmachtet war, wurde die Leitung und Bewachung der Konzentrationslager allein der SS übertragen. Das bisherige Unterstellungsverhältnis der SS unter die SA erlosch. Die KL wurden in den folgenden Jahren zur alleinigen Domäne der SS und ihres Chefs, des Reichsführers SS Heinrich Himmler.
Das Bestreben Himmlers, die Konzentrationslager zu einer festen und ständigen Einrichtung des NS-Staates und einem dauernden Machtinstrument der NS-Führung und der SS zur Unterdrückung jeglicher Opposition im Staate zu machen, führte dazu, dass er nach Auflösung der sogenannten wilden Lager und der Entmachtung der SA die noch wenigen verbliebenen staatlich anerkannten Konzentrationslager nach einheitlichen Richtlinien ausrichtete. Dachau diente als Modell für alle anderen Konzentrationslager. Als Kommandanten für Dachau hatte Himmler schon Ende Juni 1933 den SS-Oberführer Eicke nach Ablösung des ersten Kommandanten Wäckerle eingesetzt. Eicke hatte das Leben der Häftlinge im Lager streng reglementiert und feste Dienstvorschriften für die SS-Wachtruppen erlassen. Für die Gefangenen hatte er am 1.10.1933 eine "Disziplinar- und Strafordnung" erlassen, die ein System von Strafen, z.B. die Prügelstrafe, ja sogar die Todesstrafe, für eine Reihe von "Vergehen" der Gefangenen, z.B. für tätlichen Angriff auf die Wachtposten, Gehorsamsverweigerung, Verbreitung von "Greuelpropaganda", vorsah. Die Exekutive hatte er sich selbst als Lagerkommandanten übertragen. Für die Wachtposten hatte er Dienstvorschriften erlassen, deren Grundsatz war, die Gefangenen "ohne Toleranz mit äusserster, unpersönlicher, disziplinierter Härte" zu behandeln. Für den Waffengebrauch hatte er rigorose Vorschriften erlassen. Weitere Vorschriften regelten bis ins Einzelne das Verfahren der Häftlingsappelle, das militärisch geordnete Abmarschieren der Gefangenen zur Arbeit, die Pflichten der Torwache und der Begleitposten, die Kontrolle, Kommandos usw.
Im Mai 1934 hatte Himmler Eicke mit der Neuorganisation und Vereinheitlichung der gesamten Konzentrationslager beauftragt. Am 7.7.1934 ernannte er ihn nun zum Inspekteur der Konzentrationslager und der SS-Wachverbände, die später nach ihrem auf den Kragenspiegeln befindlichen Totenkopf als SS-Totenkopfverbände bezeichnet wurden. Eicke fasste die in mehreren Konzentrationslagern zerstreuten Gefangenen in einige wenige grössere Lager zusammen und setzte ihre einheitliche Leitung und Bewachung durch SS-Führer durch. In den Lagern wurden die von ihm bereits für Dachau erlassenen Dienstvorschriften über den internen Dienstbetrieb, die Gefangenenbehandlung, den Gebrauch der Schusswaffe sowie die "Disziplinar- und Strafordnung für die Gefangenen" eingeführt. Allerdings wurde von der angedrohten Todesstrafe zwischen 1933 und 1935 nur vereinzelt Gebrauch gemacht, da Ermittlungen durch die zuständigen Staatsanwaltschaften und Anklageerhebung zu befürchten waren. Ab 1935 nahm man davon überhaupt Abstand, liess die Strafandrohung aus Einschüchterungs- und Abschreckungszwecken jedoch bestehen.
Als Strafen wurden in der Regel verhängt: Arrest-, Prügelstrafe, Strafarbeit, Postentzug, Schreibverbot und das sogenannte Baumbinden. Ab 1935 wurde den Lagerkommandanten die Befugnis entzogen, schwerere Strafen selbst zu verhängen. Auch die Prügelstrafe bedurfte der Genehmigung durch den Inspekteur der Konzentrationslager.
Misshandlungen und Tötungen der Gefangenen durch die SS-Wachmannschaften kamen jedoch - wenn auch nicht als offiziell verhängte Strafe - weiter vor. Eicke züchtete bewusst den Hass der für das Lager verantwortlichen SS-Funktionäre und der Wachmannschaften gegen die sogenannten Staatsfeinde.
Auch die innere Organisation der Lager, ihre Einteilung in verschiedene Abteilungen (Kommandantur, Schutzhaftlagerführung usw., auf die noch im Zusammenhang mit dem KL Auschwitz zurückzukommen sein wird) erfolgte in allen Lagern nach dem gleichen Schema. Eine Lagerordnung regelte bis ins einzelne die Aufgaben der verschiedenen Abteilungen. Die von Eicke eingeführte Organisation der Konzentrationslager und die für die Lager erlassenen Vorschriften blieben auch für die späteren Konzentrationslager massgebend. Bei den einzelnen Konzentrationslagern wurden kasernierte SS-Wachverbände stationiert. Seit Ende 1934 gehörten diese nicht mehr zum Gesamtverband der allgemeinen SS. Sie bildeten als SS-Totenkopfverbände neben den SS-Verfügungstruppen einen besonderen Zweig der bewaffneten SS. Eicke wurde auch Führer dieser Wachverbände.
Im Jahre 1935 unterstanden Eicke sieben Konzentrationslager.
Im Verlaufe der Jahre zwischen 1934 und 1937 bahnte sich allmählich ein Wandel in der Motivation für die Einweisung in die Konzentrationslager an. Man erliess Schutzhaftbefehle nicht nur gegen politische Gegner, sondern benutzte sie auch als Mittel, um andere Kategorien sogenannter "volksschädlicher Elemente", wie Asoziale, Homosexuelle, Gewohnheitsverbrecher, Bettler, Landstreicher, Zigeuner und Arbeitsscheue auszuschalten. Diese sogenannten "vorbeugende Verbrechensbekämpfung" öffnete der Willkür Tür und Tor. Auf diese Weise "korrigierte" man die ordentliche Gerichtsbarkeit. Besondere Bedeutung erhielt dieses Verfahren auf dem Gebiet der politischen Strafverfolgung. Personen, die wegen Landes- oder Hochverrats von ordentlichen Gerichten verurteilt worden waren und ihre Strafe verbüsst hatten, wurden nach Verbüssung der Strafe in Konzentrationslager eingewiesen. Auch nach Freisprüchen in solchen Verfahren erfolgten häufig Einweisungen ins KL. Auch auf die "Zeugen Jehovas" (Kreis der ernsten Bibelforscher) wurde die Schutzhaftverhängung ausgedehnt. So entstanden verschiedene Kategorien von Gefangenen, die jeweils besonders gekennzeichnet wurden. Stoffdreiecke, die die Gefangenen auf ihrer Kleidung zu tragen hatten, wurden für die verschiedenen Kategorien in verschiedenen Farben angefertigt.
1938 trat ein neuer Abschnitt in der Entwicklung der Konzentrationslager ein. Man kam auf die Idee, die Konzentrationslager als Arbeitskräftepotential für bestimmte, von der NS-Führung geplante Projekte und für SS-eigene Produktionsstätten auszunutzen. Die SS errichtete bei den Konzentrationslagern SS-eigene Baustoffproduktionsstätten. So wurde im Frühjahr 1938 die SS-Firma der "Deutschen Erd- und Steinwerke" (Dest) gegründet. Ihr Zweck bestand in der Anlage von Ziegelwerken und der Ausbeutung von Steinbrüchen. Die Firma errichtete ein Grossziegelwerk in Sachsenhausen und bei Buchenwald. Bei dem Konzentrationslager Flossenbürg (Oberpfalz) und bei Mauthausen erwarb sie Granitsteinbrüche. Für die Verhängung von Schutzhaft und die Einweisung in Konzentrationslager kam nun ein neuer Gesichtspunkt hinzu: Der Bedarf an Arbeitskräften für die errichteten Produktionsstätten, ein Gesichtspunkt, der später im Verlauf des Krieges eine immer grössere Bedeutung, insbesondere auch in den besetzten Gebieten, gewann. Diese neue Motivation kommt in einem Erlass Heydrichs, dem Chef des inzwischen errichteten Hauptamtes Sicherheitspolizei, vom 1.6.1938 zum Ausdruck, in dessen einleitender Begründung als Zweck der in dem Erlass angeordneten Aktion gegen "Asoziale" im Reichsgebiet zwar die "Ausschaltung von Personen, die der Gemeinschaft zur Last fallen", genannt, aber auch darauf hingewiesen wird, dass die straffe Durchführung des Vierjahresplanes den Einsatz aller arbeitsfähigen Kräfte erfordere und es nicht zulasse, dass asoziale Menschen sich der Arbeit entzögen. Auffällig wurde auch im Jahre 1938 die Aktion gegen sogenannte Kriminelle und Asoziale forciert, wobei in den die Verhaftungsaktionen auslösenden Erlassen ausdrücklich angeordnet wurde, dass nur arbeitsfähige männliche und weibliche Personen festzunehmen seien.
Das Jahr 1938 war ferner durch ein starkes Ansteigen der Häftlingszahlen gekennzeichnet. Neue Lager wurden infolge der Expansion des Dritten Reiches errichtet. In den neu eingegliederten Gebieten (Österreich, Sudetengebiet) fahndeten Spezialkommandos der Sicherheitspolizei nach sogenannten Staatsfeinden und nahmen eine grosse Anzahl von Personen in Schutzhaft.
Nach der sogenannten Reichskristallnacht (9.11.1938) wurden ca. 30000 Juden zusammengetrieben und auf Befehl Hitlers in die Konzentrationslager eingewiesen. Hierdurch wollte man auf die jüdisch-deutschen Bürger einen Druck ausüben, das Reichsgebiet zu verlassen. Die meisten Juden blieben allerdings nur einige Wochen in den Lagern und wurden entlassen, wenn sie sich verpflichtet hatten, aus Deutschland auszuwandern.
Das Jahr 1939 brachte einen gewissen Rückgang der Häftlingszahlen.
Der Ausbruch des Krieges am 1.9.1939 brachte eine Wende in der Entwicklung der Konzentrationslager. Die Zahl der Lager und der Konzentrationslagergefangenen schwoll nun ins Riesenhafte an. Vom Beginn des Krieges bis zum März 1942 stieg die Zahl der Schutzhaftgefangenen von 25000 auf rund 100000 Personen an. Der Personenkreis der Lagerinsassen änderte sich. Von den Gefangenen waren nur noch 5 bis 10% Reichsdeutsche. Die anderen waren Angehörige anderer Nationen. Sie waren in den besetzten Ländern, vor allem in Polen, der Tschechoslowakei, Frankreich, Belgien und anderen Ländern verhaftet worden. Auch in der Leitung der Konzentrationslager trat ein Wechsel ein. Eicke wurde bald nach Kriegsausbruch von dem SS-Brigadeführer Glücks abgelöst. Dieser führte die Dienstbezeichnung: "Der Reichsführer SS - Inspekteur der Konzentrationslager". In dieser Funktion unterstand er weiterhin dem SS-Hauptamt, einem der ursprünglich drei SS-Ämter der SS-Führungsorganisation (SS-Amt, Rasse- und Siedlungsamt (RuS), SD-Amt), die am 30.1.1935 von Himmler zu SS-Hauptämtern erhoben worden waren. Nachdem im August 1940 aus einigen Ressorts des SS-Hauptamtes ein eigenes SS-Führungshauptamt gebildet worden war, wurde diesem die Inspektion der KL eingegliedert. In allen wichtigen Fragen wurde jedoch wie früher zwischen dem Inspekteur der Konzentrationslager und Himmler direkt verhandelt. Erst nachdem am 1.2.1942 das SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt (WVHA) aus zwei Hauptämtern der SS-Führung, nämlich dem Hauptamt "Verwaltung und Wirtschaft" (gegründet am 20.4.1939 aus der Dienststelle "Verwaltungschef der SS im persönlichen Stab Himmlers") und dem Hauptamt "Haushalt und Bauten" (ebenfalls am 20.4.1939 gegründet) sowie einem Zweig des bereits genannten SS-Hauptamtes, nämlich dem Verwaltungsamt IV (Leiter SS-Obergruppenführer Pohl) gebildet worden war, wurde der Inspekteur der Konzentrationslager (Glücks) dem WVHA unterstellt bzw. als Amtsgruppe D eingegliedert. Chef des WVHA wurde Obergruppenführer Pohl. Glücks blieb Amtsgruppenchef der Amtsgruppe D. Ihm unterstanden weiterhin sämtliche Konzentrationslager. Mit der Verhängung von Schutzhaft hatten er und seine Amtsgruppe direkt nichts zu tun.
Während des Krieges wurde das Verfahren bei der Schutzhaftverhängung vereinfacht. Die Bestimmungen über die Schutzhaftverhängung wurden erheblich verschärft. Himmler erhielt von Hitler die Anweisung, mit polizeilichen Mitteln gegen alle Feinde des Staates und der Volksgemeinschaft vorzugehen und dabei nicht nur von der Schutzhaft Gebrauch zu machen, sondern auch in schweren Fällen die betreffenden Personen ohne Hinzuziehung der Justiz zu "liquidieren". Auf Grund der von Hitler und Himmler erteilten Weisungen gab der Chef der Sicherheitspolizei (Heydrich) in einem Runderlass an die höheren SS- und Polizeiführer, die Inspekteure der Sicherheitspolizei und die Dienststellen der Gestapo scharfe Richtlinien über "Grundsätze der inneren Staatssicherheit während des Krieges" heraus. Danach sollte gegen Personen sofort durch Festnahme eingeschritten werden, die in ihren Äusserungen am Sieg des deutschen Volkes zweifelten oder das Recht des Krieges in Frage stellten oder andere Personen in volks- oder reichsfeindlichem Sinne zu beeinflussen suchten. Nach der Festnahme sollte unverzüglich dem Chef der Sicherheitspolizei berichtet und um Entscheidung über die Weiterbehandlung des Falles gebeten werden, da "notfalls auf höhere Weisung brutale Liquidierung solcher Elemente erfolgen werde".
So erhielten die Konzentrationslager zu den bisherigen Funktionen eine weitere hinzu: Sie dienten als Stätte physischer Vernichtung, der "Liquidierung" von sogenannten Staatsfeinden, auch wenn kein justizielles Verfahren vorangegangen war und kein Urteil eines Straf- oder Sondergerichtes vorlag.
Nach Kriegsbeginn erfolgte eine ganze Reihe von verfahrenslosen Erschiessungen in den Konzentrationslagern, die Hitler befohlen oder genehmigt hatte.
Für die Schutzhaftverhängung und die Entlassung von Schutzhaftgefangenen aus den Konzentrationslagern blieb auch nach Kriegsbeginn das Geheime Staatspolizeiamt, das durch das preussische Gesetz vom 26.4.1933 errichtet worden war und dessen Stellung und Aufgaben durch das Gestapogesetz vom 10.2.1936 umrissen worden waren, grundsätzlich allein zuständig. Ihm war durch den Erlass des Reichsinnenministers vom 25.1.1938 (§2 Satz 1) diese ausschliessliche Zuständigkeit zuerkannt worden, nachdem vorher - wie oben bereits dargelegt - auch andere Polizeidienststellen die Befugnis zur Schutzhaftverhängung gehabt hatten.
Das Gestapa war Zweig des "Hauptamtes Sicherheitspolizei". Zum näheren Verständnis sei hier kurz auf die Entwicklung und Organisation der deutschen Polizei im Reichsgebiet seit 1936 eingegangen:
Himmler wurde durch Erlass des "Führers" und Reichskanzlers vom 17.6.1936 als Reichsführer SS zum Chef der deutschen Polizei ernannt. Damit wurde das Parteiamt des Reichsführers SS (RFSS) institutionell mit dem neu eingeführten (staatlichen) Amt eines "Chefs der deutschen Polizei" verbunden. Das bedeutete eine Zentralisierung (als Verreichlichung bezeichnet) der gesamten deutschen Polizei und des deutschen Polizeiwesens, das bisher Ländersache gewesen war und eine - von Himmler bewusst angestrebte - Integrierung der SS und Polizei bzw. Aufsaugung der Polizei durch die SS. Nach seiner Ernennung führte Himmler eine grundlegende Neuorganisation der deutschen Polizei durch. Er bildete zwei Hauptämter, das "Hauptamt Ordnungspolizei" (Chef: General der Polizei Daluege) und das "Hauptamt Sicherheitspolizei" (Chef: SS-Gruppenführer Reinhard Heydrich). Zum Hauptamt Sicherheitspolizei gehörte das Amt Politische Polizei, praktisch im wesentlichen gebildet vom Gestapa, und das Amt Kriminalpolizei, gebildet vom Preussischen Landeskriminalpolizeiamt (ab 16.7.1937 Reichskriminalpolizeiamt).
Mit Wirkung vom 1.10.1939 errichtete Himmler dann durch Erlass vom 27.9.1939 das Reichssicherheitshauptamt, und zwar durch Zusammenfassung des Hauptamtes Sicherheitspolizei und des dem Bereich der nationalsozialistischen Bewegung zugehörigen SD-Hauptamtes, das aus dem Nachrichten- und Abwehrdienst der SS hervorgegangen war.
Amt IV des RSHA wurde gebildet aus dem Amt Politische Polizei des Hauptamtes Sicherheitspolizei, der Abteilung II des Gestapa und der Abteilung III des Gestapa. Amtschef des Amtes IV wurde SS-Gruppenführer Heinrich Müller. Auf die weitere Gliederung des Amtes IV soll hier nicht eingegangen werden. Dieses Amt war und blieb in Fortführung der Aufgaben des Gestapa bis Kriegsende für die Ausstellung der Schutzhaftbefehle und die Einweisungen und Entlassungen der Konzentrationslagergefangenen zuständig. Chef des Reichssicherheitshauptamtes wurde SS-Obergruppenführer Heydrich, dem später Kaltenbrunner folgte.
Nach Kriegsbeginn wurde die Praxis der Schutzhaftverhängung jedoch vereinfacht. In eiligen Fällen konnten nach einem Runderlass des Chefs der Sipo und des SD vom 16.5.1940 die Dienststellen der Sicherheitspolizei Schutzhaftanträge per Fernschreiben an das Schutzhaftreferat des RSHA (Amt IV Referat C 2) richten. Die Anordnung der Schutzhaftverhängung erfolgte dann ebenfalls fernschriftlich. Die schriftlichen Unterlagen wurden erst nachgereicht. Damit verstärkte sich der Einfluss der örtlichen Gestapostellen bei den Konzentrationslagereinweisungen. Eine Sonderregelung über die Schutzhaftverhängung gegen polnische Staatsangehörige erging durch den Runderlass des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD vom 4.5.1943. Dieser übertrug den Stapoleitstellen sowie den Befehlshabern und Kommandeuren der Sicherheitspolizei, auf deren Funktionen im übrigen hier nicht eingegangen werden soll, die Anordnung der Schutzhaft und Einweisung in die Konzentrationslager für sämtliche polnische Häftlinge in eigener Zuständigkeit. Ausgenommen hiervon waren lediglich Angehörige des polnischen Hochadels, politische und geistige Führer, ehemalige höhere Offiziere und der höhere Klerus.
Während des Krieges benutzte man ferner die Konzentrationslager dazu, um - wie es in der nationalsozialistischen Terminologie hiess - "den Volkskörper von schädlichen Elementen zu reinigen". So wurden Geisteskranke, Invalide und andere unerwünschte Personengruppen (z.B. die Juden) in der Verschwiegenheit der Konzentrationslager getötet. Unter dem Geheimzeichen 14 f 13 wurden in den Konzentrationslagern Kranke und Arbeitsunfähige von Ärzten ausgesondert und anschliessend getötet. In welchem Umfange dies z.B. im Konzentrationslager Auschwitz geschah, wird noch zu erörtern sein.
Im Verlaufe des Krieges trat aber immer mehr die bereits seit 1938 erkennbare Funktion der Konzentrationslager, Potential für Arbeitskräfte zu sein, in den Vordergrund. Sie wurden riesige Zwangsarbeitslager, die ausser für die SS-eigenen Betriebe auch Arbeitskräfte für die deutsche Kriegsindustrie zu stellen hatten. Da für diesen Arbeitseinsatz das WVHA zuständig war, das an einer ständigen Vermehrung der Arbeitskräfte interessiert war, wirkte es auf die Schutzhaftverhängung und die Einweisung von Gefangenen in Konzentrationslagern indirekt ein. Durch Beeinflussung des RSHA erreichte es die Verstärkung von Einweisungen. Kennzeichnend hierfür ist z.B. das Schreiben des WVHA vom 30.4.1942 an Himmler:
"Die Mobilisierung aller Häftlingsarbeitskräfte zunächst für Kriegsaufgaben (Rüstungssteigerung) und später für Friedensbauarbeiten schiebt sich immer mehr in den Vordergrund. Aus dieser Erkenntnis ergeben sich nun einige Massnahmen, welche eine allmähliche Überführung der Konzentrationslager aus ihrer früheren einseitigen politischen Form in eine den wirtschaftlichen Aufgaben entsprechende Organisation fordern."
Das WVHA war auch bestrebt, die Sterblichkeit in den Lagern, die seit Beginn des Krieges sehr hoch war, herunterzudrücken. Der Arbeitskräftebedarf führte ferner dazu, dass die arbeitsfähigen Juden, die an sich - wie noch zu erörtern sein wird - für die Vernichtung bestimmt waren, zunächst zum Teil von dieser Vernichtung ausgenommen und als Arbeitskräfte in die Lager aufgenommen wurden. Die Arbeitskräfte für die Konzentrationslager wurden in erster Linie aus den besetzten Gebieten des Ostens rekrutiert. Sie wurden als wirkliche oder vermeintliche Gegner der deutschen Besatzungsmacht oder als verdächtig, Widerstands- oder Untergrundorganisationen anzugehören, festgenommen und in die Konzentrationslager überführt. Unter ihnen befanden sich besonders viele Juden. Die Häftlingszahlen schwollen dementsprechend nach Kriegsbeginn ins Riesenhafte an. Die vorhandenen Konzentrationslager reichten nicht mehr zu ihrer Aufnahme aus. Eine starke Überbelegung der Lager mit einer hohen Sterblichkeit war die Folge. Die Führung richtete daher alsbald nach Kriegsbeginn weitere Konzentrationslager insbesondere im Osten ein. So kam es auch zur Gründung des Konzentrationslagers Auschwitz, über das im nächsten Abschnitt nähere Ausführungen zu machen sein werden.
Zu den bisher genannten Funktionen der Konzentrationslager kam für viele eine, weitere wichtige Funktion während des Krieges hinzu. Sie dienten im Rahmen der "Endlösung der Judenfrage" als Stätten für die massenweise Tötung jüdischer Menschen. Einige Lager - insbesondere in Polen - hatten ausschliesslich diesen Zweck. Sie waren reine Vernichtungslager. Bei anderen Lagern kam zu den bisherigen Funktionen, die beibehalten wurden, die Massenvernichtung jüdischer Menschen hinzu. Hierfür wurden sogar besondere Einrichtungen geschaffen. Das Konzentrationslager Auschwitz, das allen bisher genannten Zwecken bis Kriegsende diente, wurde eines der grössten Vernichtungslager im Rahmen der "Endlösung der Judenfrage".
2. Abschnitt: Das Konzentrationslager Auschwitz
I. Allgemeines
Als sich nach Kriegsbeginn die Notwendigkeit für die NS-Führung zeigte, neue Konzentrationslager zu errichten, beauftragte Himmler im Winter 1939/1940 den Inspekteur der KL, Glücks, die Möglichkeit der Errichtung neuer Konzentrationslager in den besetzen Ostgebieten zu prüfen. Glücks berichtete am 21.2.1940, "dass Auschwitz, eine ehemalige polnische Artillerie-Kaserne (Stein- und Holzgebäude) nach Abstellung einiger sanitäter Mängel als Quarantänelager geeignet sei". Das Gelände wurde am 17. und 18.4.1940 von einer von dem späteren Lagerkommandanten Höss geleiteten Kommission im Auftrage des Inspekteurs der KL besichtigt. Es liegt in der Nähe der Stadt Auschwitz, die damals zu den dem deutschen Reich eingegliederten Ostgebieten gehörte, am Ostrand der Mährischen Pforte in einer Niederung zwischen den Flüssen Sola und Weichsel, am Schnittpunkt des damaligen Generalgouvernements, des damaligen Warthegaues und Ostoberschlesiens.
Die Kommission sah das Gelände, in dessen Nähe die Bahnlinie Kattowitz - Auschwitz - Krakau vorbeiführte, als geeignet für die Gründung eines Konzentrationslagers an und berichtete entsprechend. Himmler beauftragte daraufhin am 4.5.1940 Höss - offensichtlich im Hinblick auf die grosse Zahl polnischer Häftlinge, die in den genannten Gebieten durch die Sicherheitspolizei festgenommen worden waren und die Polizeigefängnisse überfüllten -, "in kürzester Frist aus dem bestehenden Gebäudekomplex ein Durchgangslager für 10000 Häftlinge zu schaffen". Er ernannte ihn gleichzeitig zum Kommandanten für das zu gründende Lager. Höss begann sofort mit einigen SS-Angehörigen und 200 aus der Stadt Auschwitz zwangsweise rekrutierten Juden mit der Errichtung des Lagers. Die Zivilbevölkerung in der Umgebung der ehemaligen Kaserne wurde zwangsweise evakuiert. Noch im Mai 1940 suchte der erste Rapportführer des Lagers, SS-Oberscharführer Palitzsch, 30 Berufsverbrecher in dem Konzentrationslager Sachsenhausen aus und brachte sie nach Auschwitz. Sie bildeten als erste Insassen die Stammannschaft des Lagers. Nach Eintreffen der ersten Häftlingstransporte wurden sie als Vorgesetzte der Häftlinge (sogenannte Funktionshäftlinge) eingesetzt. Am 14.6.1940 traf der erste polnische Häftlingstransport ein. Zu diesem Zeitpunkt war das Lager noch im Aufbau. Nur ein Steingebäude war mit einem Drahtzaun umzäunt. Am 20.6.1940 lief der zweite Transport ein, dem bald weitere Häftlingstransporte folgten. Der Ausbau des Lagers, für den die eingetroffenen Häftlinge eingesetzt wurden, machte nun rasch Fortschritte. Immer weitere Steingebäude (Blocks) wurden ausgebaut, die Lagerstrassen befestigt und der gesamte Bereich des Lagers, der für die Aufnahme und Unterbringung der Häftlinge diente, mit Stacheldraht umgeben.
Als Durchgangslager - dem ursprünglich vorgesehenen Zweck - diente das Konzentrationslager Auschwitz nur teilweise und nur in der ersten Zeit. Himmler sah schon bald andere Aufgaben für das Lager vor. Als "Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums" konnte er in den eingegliederten Ostgebieten - anders als im Altreich - über das ihm unterstehende Bodenamt in Kattowitz die Beschlagnahme von Grund und Boden zugunsten des Lagers anordnen. Diese Möglichkeit bestimmte ihn zu weitreichenden Plänen. SS-eigene Produktionsstätten sollten in der Nähe und Umgebung des Lagers errichtet und grosse SS-eigene landwirtschaftliche Betriebe und Versuchsanstalten angelegt werden. Die Gefangenen des Lagers sollten in ihnen als billige Arbeitskräfte verwendet werden. Dementsprechend befahl Himmler, nachdem er bereits Ende 1940 die Erweiterung des auf dem Kasernengelände errichteten Lagers angeordnet hatte, nach seiner ersten Besichtigung des Lagers am 1.3.1941 die Ausdehnung des Gesamtlagerbereiches (sogenanntes Interessengebiet KL Auschwitz) auf ein Gebiet von 40 qkm und die Errichtung eines weiteren Lagers bei dem Ort Birkenau (Brzinka) ca. 3 km vom Lager Auschwitz entfernt mit einer Kapazität für 100000 Häftlinge. Später gab er sogar Anweisung, das Lager für 200000 Häftlinge auszubauen. Massgebend für diesen geplanten riesenhaften Ausbau war nicht zuletzt der Standort der nahegelegenen ostoberschlesischen Industrie, für die die billige Arbeitskraft der Gefangenen ausgenutzt werden sollte.
Mit dem Ausbau des Lagers Birkenau wurde im Oktober 1941 begonnen. Er erfolgte in mehreren Bauabschnitten. Der Plan, 600 Baracken für insgesamt 200000 Gefangene zu errichten, wurde jedoch bis Kriegsende nicht mehr verwirklicht. An SS-eigenen Produktionsstätten wurden unter anderem die SS-Wirtschaftsbetriebe "Deutsche Ausrüstungswerke" (DAW), "Deutsche Erd- und Steinwerke" und andere errichtet. In dem polnischen Ort Reisko - wenige Kilometer vom Lager entfernt - entstand ein grosser, SS-eigener landwirtschaftlicher Betrieb mit einer SS-eigenen Versuchsanstalt unter der Leitung des SS-Sturmbannführers Dr. C. In Harmense - ebenfalls nur einige Kilometer vom Lager entfernt - wurden SS-eigene Fischteiche angelegt.
Ab Frühjahr 1941 wurden ständig Häftlinge aus dem Konzentrationslager Auschwitz der IG-Farbenindustrie zur Errichtung eines Buna-Werkes ca. 7 km vom Lager entfernt zur Verfügung gestellt. Die IG-Farbenindustrie errichtete 1942 für die Häftlingsarbeiter, die zunächst täglich den Weg von und zum Werk zurücklegen mussten, in unmittelbarer Nähe des Buna-Werkes das Häftlingsarbeitslager Monowitz. Weitere kleinere Häftlingslager entstanden bei anderen Industriebetrieben im oberschlesischen Raum aber auch in weiterer Entfernung (z.B. bei Brünn), so dass schliesslich zum KL Auschwitz nicht nur das zunächst errichtete Lager (Stammlager) und das Lager Birkenau, sondern ausser Monowitz, dem grössten der Aussenlager, weitere 38 Aussenlager gehörten.
II. Beschreibung des Konzentrationslagerbereiches
1. Das Stammlager
Das auf dem ehemaligen Kasernengelände errichtete Lager wurde Stammlager genannt. Es bestand aus dem Schutzhaftlager, einem räumlich begrenzten und überschaubaren Rechteck, in dem die Häftlinge untergebracht waren, und den ausserhalb des Lagers befindlichen Gebäuden, die zum Kommandanturbereich gehörten. Das Schutzhaftlager war mit einem 4 m hohen Stacheldrahtzaun umgeben, der abends nach dem Einrücken der Häftlinge von der Arbeit bis zum Ausrücken am nächsten Morgen mit Starkstrom geladen wurde. Auf den Pfosten der Umzäunung befanden sich Scheinwerfer, die nachts das Lager beleuchteten. Am Zaun entlang waren Wachttürme aufgebaut, auf denen SS-Posten während der Nacht, teilweise auch tagsüber, wenn die Häftlinge nicht ausrückten oder bei besonderen Anlässen, Wache hielten. Später wurde noch ein zweiter Stacheldrahtzaun errichtet. Das Eingangstor zum Schutzhaftlager, über dem sich die Überschrift "Arbeit macht frei" befand, lag an der Nordseite des Lagers. Das Schutzhaftlager bestand nach seiner Erweiterung und der Bebauung des zunächst in der Mitte des Lagers freigelassenen Appellplatzes aus 28 in mehreren Reihen nebeneinander liegenden Steingebäuden (Blocks genannt), einem Gebäude für die Wäscherei und dem Küchengebäude mit Magazin. Die Steingebäude waren numeriert, die Numerierung wurde jedoch im Laufe der Jahre mehrfach gewechselt. Nach der Bebauung des Appellplatzes im Jahre 1941 hatten sie die Nummern 1-28. Die Blöcke 1-8, 12-18, 22 und 23 dienten als Unterkünfte für die Häftlinge. Die Blöcke 9, 19, 20, 21 und 28 bildeten ab 1941 den Häftlingskrankenbau (HKB). Ursprünglich war nur der Block 21 als Krankenblock benutzt worden. Dann hatte die starke Zunahme der Krankheitsfälle die Einbeziehung des Blocks 28, kurz danach auch die Einbeziehung der Blöcke 20 und 19 und schliesslich des Blocks 9 in den HKB notwendig gemacht. Im Block 10 waren Frauen untergebracht, an denen Dr. Clauberg und andere Ärzte medizinische Versuche machten.
Block 11 war der Arrestblock. Vor der Erweiterung des Lagers hatte er die Nr.13. Er erlangte im Schutzhaftlager besondere Bedeutung. Er war besonders abgeschirmt und gesichert. Kein Häftling aus dem Schutzhaftlager durfte ihn betreten, wenn er nicht in diesem Block eine besondere Funktion zu verrichten hatte. Er stand - wie alle Blöcke - mit der Giebelseite zur Lagerstrasse. Von der Stirnseite (von der Lagerstrasse aus gesehen) und der Rückseite des Blocks 11 waren zu Stirn- und Rückseite des parallel daneben liegenden Blocks 10 zwei hohe Steinmauern gezogen worden, so dass zwischen diesen beiden Blöcken ein Hof entstanden war, der von aussen nicht ohne weiteres - jedenfalls nicht von der Lagerstrasse aus - einzusehen war. Unmittelbar vor der hinteren Verbindungsmauer zwischen Block 10 und 11 - von der Lagerstrasse aus gesehen - hatte man aus schwarzen Isolierplatten eine Wand als Kugelfang errichtet. An dieser Wand, die in der Lagersprache den Namen "schwarze Wand" erhielt, wurden unzählige Menschen erschossen. Durch die vordere Verbindungsmauer führten ein Holztor und eine kleine Holztür. Der Block 11 hatte zwei Eingänge. Der eine führte von der Lagerstrasse aus in den Block auf einen breiten Mittelgang (Flur), der den Block in zwei Hälften teilte. In der rechten Hälfte des Blockes im Erdgeschoss - vom Eingang aus gesehen - lagen mehrere Zimmer, die vom Flur aus zu betreten waren, unter anderem die Blockführerstube (erstes Zimmer vom Eingang aus gesehen), die Schreibstube für den Blockschreiber (zweites Zimmer) und das Zimmer des Blockältesten. In der Mitte des Hauptflurs ging nach links ein Seitenflur in Richtung auf den Hof zwischen Block 10 und 11 ab, der durch einen zweiten Ausgang auf den Hof führte. Auf dem Seitenflur befand sich ein grosser Waschraum, der nur von dem Seitenflur aus zu betreten war. Am Hauptflur lag ein weiterer kleiner Waschraum, und zwar links - von der Lagerstrasse aus gesehen - unmittelbar gegenüber der Blockältestenstube.
Ein weiterer Raum im Erdgeschoss diente zur Unterbringung von sogenannten Polizeihäftlingen, die durch die Gestapoleitstelle Kattowitz in das Lager gebracht und durch ein sogenanntes Standgerichtsverfahren dieser Gestapoleitstelle abgeurteilt wurden. Nähere Einzelheiten hierüber werden noch zu schildern sein.
Der erste Stock diente zeitweilig als Quarantänestation für die Häftlinge, die gerade in das Lager gekommen waren und für solche, die auf ihre Entlassung aus dem Lager warteten. In ihm waren zeitweilig auch Arrestanten der SS untergebracht. In der ersten Zeit (1940/1941) befand sich in Block 11 auch die Strafkompanie (SK).
Im Keller des Blocks 11 befanden sich 28 Arrestzellen für Lagerhäftlinge. In der Lagersprache wurde dieser Zellenbau "Bunker" genannt. Der Keller wurde - wie das Erdgeschoss und der erste Stock - durch einen breiten Mittelgang in zwei Hälften geteilt. Der Gang war durch starke Eisengitter mit zwei Gittertüren unterteilt.
Von ihm zweigten kurze parallele Seitengänge ab, an denen die einzelnen Zellen (2-5) lagen. Sie waren mit dicken Türen mit Stahlverschlägen und Gucklöchern versehen. Eine der Zellen (Nr.22) war in vier Stehzellen umgewandelt worden. Die Grösse einer Stehzelle betrug noch nicht einen Quadratmeter. In ihr konnte sich ein Mensch weder setzen noch hinlegen. Der Einstieg zu einer Stehzelle bestand nur aus einem kleinen Loch in Kniehöhe, durch das der Häftling hindurchkriechen musste. In die Stehzellen wurden Häftlinge zur Strafe für irgendwelche geringfügigen Lagervergehen eingesperrt. Die Strafe bestand meist darin, dass sie mehrere Nächte hintereinander - ohne Essen und Trinken - in der Stehzelle verbringen mussten. Am nächsten Morgen mussten sie dann wieder mit zur Arbeit ausrücken.
Die Lagerführung sperrte mehrfach auch Häftlinge, die ihr aus irgendeinem Grunde missliebig waren, in die Stehzellen für längere Zeit, also Tag und Nacht, ein, ohne ihnen etwas zu essen und zu trinken geben zu lassen, bis die Häftlinge verhungert waren. Auf diese Weise sind mehrere Häftlinge umgekommen.
In die Arrestzellen wurden Schutzhäftlinge aus dem Lager entweder durch die Lagerführung oder die Politische Abteilung eingewiesen. Der Grund für die Einweisung durch die Lagerführung waren Lagervergehen im Sinne der SS. Von der Politischen Abteilung wurden vornehmlich Häftlinge in den Arrest gebracht, die verdächtig waren, Mitglieder einer Untergrundorganisation zu sein, unzulässige Verbindungen zu Zivilpersonen ausserhalb des Lagers zu unterhalten oder einen Fluchtversuch geplant oder versucht zu haben. Ferner kamen alle Häftlinge hinein, denen eine Flucht gelungen war, die aber wieder ergriffen worden waren. Auch der Verdacht, sonstige Lagervergehen begangen zu haben (z.B. Diebstähle) konnte Grund für die Einweisung in den Arrest sein. Der Blockschreiber, ein Funktionshäftling, trug die in den Arrest eingewiesenen Häftlinge in das sogenannte Bunkerbuch ein. Ausserdem wurden sie auf einer Karteikarte erfasst. Häftlinge, die nur eine Lagerstrafe zu verbüssen hatten, wurden nicht in das Bunkerbuch eingetragen.
Im Block 24 befand sich die Häftlingsschreibstube für das Schutzhaftlager, später auch ein Bordell. In Block 25 war eine Häftlingskantine, Block 26 diente als Effekten- und Block 27 als Bekleidungskammer.
Neben dem Lagereingang, jedoch ausserhalb der Drahtumzäunung, befand sich in einer Baracke die Blockführerstube, wo sich die ein- und ausrückenden Häftlinge an- und abmelden mussten. Gegenüber dem Lagereingang lagen die zur Fahrbereitschaft gehörenden Gebäude und Werkstätten.
An der Schmalseite des Lagers im Westen - ausserhalb des Stacheldrahtzaunes - befanden sich drei Gebäude, in denen die verschiedenen Dienststellen ihre Büroräume hatten. In dem an der südwestlichen Ecke des Lagers neben Block 1 - jedoch durch den Stacheldrahtzaun getrennt - liegenden Gebäude hatte der Kommandanturstab seine Büros mit je einem Dienstzimmer für den Kommandanten und den Adjutanten. In dem zweiten, nördlich daran anschliessenden, Gebäude war die Verwaltungsabteilung, und in dem dritten, an der Nordwestecke des Lagers neben Block 22 - jedoch ebenfalls durch den Stacheldrahtzaun von diesem getrennt - liegenden Gebäude waren die Apotheke, die Dienststelle des Standortarztes und das SS-Revier untergebracht. Gegenüber diesem zuletzt genannten Gebäude (SS-Reviergebäude genannt) lag das Krematorium, das später, nach dem Ausbau neuer Krematorien in Birkenau, das "alte Krematorium" genannt wurde. In ihm wurden die Leichen der verstorbenen Häftlinge verbrannt. Es diente aber auch, was später noch näher zu erörtern sein wird, als Exekutionsstätte und als Vergasungsraum zur Tötung von Menschen mit Zyklon B. Neben dem alten Krematorium waren einige Baracken, in denen die Politische Abteilung des Lagers ab 1942 ihre Diensträume hatte und Vernehmungen durchführte.
2. Das Lager Birkenau
Das Lager Birkenau - ebenfalls ein Rechteck -, mit dessen Bau im Oktober 1941 begonnen wurde, umfasste eine Fläche von 170 Hektar. Es wurde in drei Bauabschnitten errichtet. Der Bauabschnitt I, der später die Bezeichnung B I beibehielt, wurde in die Felder a und b unterteilt. Auf ihnen wurden unverputzte Steinbaracken mit gemauerten Boxen als Schlafstätten für Häftlinge erbaut. Im Feld B I a wurden ab Sommer 1942 Frauen, im Feld B I b Männer untergebracht. Im Jahre 1943 wurden die Männer in den Abschnitt B II verlegt. Das Feld B I b wurde ebenfalls mit Frauen belegt. Der ganze Abschnitt B I bildete nun das Frauenkonzentrationslager (FKL). Auf dem Bauabschnitt B II wurden Baracken nach dem Muster der Wehrmachtspferdestallbaracken errichtet. Sie hatten keine Fenster, sondern nur Öffnungen an ihren Schmalseiten. Das Haupttor des Gesamtlagers befand sich an der Ostseite zwischen den Abschnitten B I und B II. Durch dieses Tor wurde im Jahre 1943 ein Anschlussgleis vom Bahnhof der Stadt Auschwitz in das Lager geführt und zwischen den Abschnitten B I und B II eine Rampe mit 3 Schienensträngen errichtet. Sie wurde Anfang oder Frühjahr 1944 fertig. Sie erlangte besondere Bedeutung bei der Massenvernichtung von jüdischen Menschen in den Gaskammern von Birkenau, auf die noch zurückzukommen sein wird.
Der Abschnitt B II wurde in die Lagerabschnitte a-f unterteilt. Diese Lagerabschnitte bildeten eigene, durch besondere Drahtumzäunung gesicherte Lager. Sie hatten nur je einen, an ihrer nördlichen Schmalseite befindlichen Eingang. Sie konnten daher nur von der zwischen den Bauabschnitten B II und B III von Ost nach West verlaufenden Lagerstrasse betreten werden. Vor dem Eingang jedes Lagerabschnitts befand sich eine Baracke mit der Blockführerstube.
Der Lagerabschnitt B II a war das Quarantänelager. Hierher kamen zunächst die Neuankömmlinge, bis sie auf die anderen Lagerabschnitte verteilt wurden.
In dem Lagerabschnitt B II b befand sich das sogenannte tschechische Familienlager, auch Theresienstädter Lager genannt. Es entstand im September 1943, als tschechische Juden familienweise aus Theresienstadt nach Auschwitz verbracht und auch familienweise in diesem Lagerabschnitt untergebracht wurden. Im Dezember 1943 wurde er mit weiteren tschechischen Juden aus Theresienstadt belegt. Der grösste Teil der Juden wurde - wie noch zu erörtern sein wird - im März und Juli des Jahres 1944 in den Gaskammern von Birkenau getötet, während ein Teil der arbeitsfähigen Juden in andere Lager verschickt wurde.
Der Lagerabschnitt B II c wurde im Jahre 1944 mit ungarischen Frauen belegt.
Im Lagerabschnitt B II d befanden sich arbeitsfähige Männer. Im Block 11 dieses Lagers war die Strafkompanie (SK) untergebracht. Block 11 war von den anderen Baracken isoliert und besonders gesichert.
B II e war das Zigeunerlager. In ihm waren Zigeuner familienweise bis zu ihrer Vernichtung im Jahre 1944, auf die ebenfalls noch zurückzukommen sein wird, untergebracht.
B II f war das Männerkrankenlager.
An der Westseite des Bauabschnittes B II befand sich noch ein weiteres Barackenlager, das "Effektenlager", in der Lagersprache "Lager Kanada" genannt, in dem die den Juden abgenommenen Gepäckstücke, Kleidung, Schmuck, Uhren usw. gelagert und sortiert wurden.
Das gesamte Lagerrechteck B I und B II war, ähnlich wie das Stammlager, mit hohem doppelten Stacheldrahtzaun umgeben, der nachts ebenfalls elektrisch geladen wurde, Auch die zwischen den einzelnen Lagerabschnitten gezogenen Stacheldrahtzäune wurden nachts unter Strom gesetzt.
In dem gesamten Lager Birkenau waren zur Zeit der Höchstbelegstärke (1943) rund 100000 Häftlinge untergebracht, während das Stammlager nach seiner Erweiterung und der Aufstockung der Steingebäude nur eine durchschnittliche Belegstärke von 18000 Personen hatte.
Der Bauabschnitt B III wurde bis zur Evakuierung des Lagers am 18.1.1945 nicht mehr vollendet. Auf ihm waren zwar schon einige Baracken errichtet, es fehlte aber an Wasser und sanitären Einrichtungen. Auch war es noch nicht durch einen Drahtzaun gesichert. In den Baracken dieses Abschnitts, der in der Lagersprache "Lager Mexico" genannt wurde, waren zur Zeit der grossen Ungarn-Transporte im Jahre 1944, als Hunderttausende von ungarischen Juden nach Auschwitz zur Vernichtung transportiert wurden, vorübergehend ungarische jüdische Frauen untergebracht, die unter den primitivsten Verhältnissen leben mussten, zum Teil nicht einmal bekleidet waren.
Zum Bereich des Lagers Birkenau gehörten auch zwei nordwestlich vom Lager im Gelände liegende Bauernhäuser, die im Jahre 1942 zu Vergasungsanstalten umgebaut worden sind. In ihnen wurden - was noch zu erörtern sein wird - Tausende von Menschen durch Gas getötet. Ferner gehörten zum Lager Birkenau vier westlich vom Lager im Jahre 1943 errichtete Krematorien mit Gaskammern (die Krematorien I bis IV), die ebenfalls der Tötung unzähliger Menschen dienten.
Das Stammlager und das Lager Birkenau waren tagsüber von einer gemeinsamen grossen Postenkette, bestehend aus bewaffneten SS-Angehörigen, umgeben, die die Lager in einer grösseren Entfernung in einem geschlossenen Ring umgaben und die Flucht von Häftlingen während der Arbeit verhindern sollten. Die grosse Postenkette wurde morgens vor dem Ausrücken der Häftlinge aus dem Lager gebildet, und erst am Abend nach dem Abendappell, wenn festgestellt worden war, dass kein Häftling fehlte, eingezogen. Stellte sich beim Abendappell heraus, dass einer oder mehrere Häftlinge fehlten, blieben die Aussenposten stehen, bis die fehlenden Häftlinge gefunden waren. Das Gebiet innerhalb der grossen Postenkette war Sperrgebiet und durfte nur mit einem besonderen Passierschein betreten werden.
3. Das Lager Monowitz mit seinen Nebenlagern
Das bereits erwähnte, für die IG-Farbenindustrie errichtete Arbeitslager gehörte ebenfalls zu dem Konzentrationslager Auschwitz. Es wurde zuerst "Lager Buna", später Lager Monowitz genannt. Eine nähere Beschreibung dieses Lagers erübrigt sich, da die Straftaten, die zur Verurteilung der Angeklagten geführt haben, im Bereich des Stammlagers oder des Lagers Birkenau begangen worden sind.
Aus den gleichen Gründen bedarf es nicht der Beschreibung der weiteren 38 zum Teil kleineren Aussenlager.
Im November 1943 wurden die Lager Birkenau und Monowitz organisatorisch verselbständigt. Das gesamte Konzentrationslager Auschwitz wurde in die Lager Auschwitz I (Stammlager), Auschwitz II (Lager Birkenau) und Auschwitz III (Lager Monowitz mit sämtlichen Nebenlagern) geteilt. Die Lager Birkenau und Monowitz mit Nebenlagern erhielten eigene Lagerkommandanten und Adjutanten. Es fehlten ihnen jedoch eine eigene Fernschreibstelle, eine eigene Politische Abteilung, eine eigene Fahrbereitschaft und ein eigener ärztlicher Dienst. Die zum Kommandanturbereich des Lagers A I gehörende Politische Abteilung, die Fahrbereitschaft, der Standortarzt, die Fernschreibstelle blieben weiterhin für alle Lager zuständig. Ferner hatte der Lagerkommandant des Lagers A I in seiner Eigenschaft als Standortältester des Standortes Auschwitz Weisungs- und Befehlsbefugnisse gegenüber den Lagerkommandanten der Lager A II und A III.
III. Die innere Organisation des Konzentrationslagers Auschwitz
1. Die Lagerkommandantur (Abteilung I)
An der Spitze des Konzentrationslagers stand der Lagerkommandant. Er war für das Lager in jeder Hinsicht verantwortlich. Ihm zur Seite stand als erster Gehilfe der Lageradjutant. Seine Aufgabe war es, den Kommandanten über alle wichtigen Vorgänge im Lager zu unterrichten, die gesamte eingehende Post auf die einzelnen Abteilungen zu verteilen und den Schriftverkehr der Kommandantur mit aussenstehenden Dienststellen und den Abteilungen des Lagers zu bearbeiten. Verschlusssachen hatte er ebenfalls zu bearbeiten und sicher aufzubewahren. Er führte auch das Geheimtagebuch. Der Adjutant war ferner Personalsachbearbeiter des Kommandanturstabes. Er hatte dem Kommandanten Beförderungen und Ernennungen der im Lagerbereich tätigen SS-Angehörigen vorzuschlagen. Dem Adjutanten unterstand ferner das gesamte Nachrichtenwesen des Lagers sowie die Fahrbereitschaft. Die Angehörigen des Kommandanturstabes (SS-Unterführer und SS-Männer) waren zu der sogenannten Stabskompanie zusammengefasst. Der Adjutant war Chef dieser Kompanie. Er war damit Disziplinarvorgesetzter aller zum Kommandanturstab gehörenden SS-Unterführer und -Männer. Der Adjutant war auch verantwortlich für die Waffen, die Munition und das Gerät des Kommandanturstabes.
Als Hilfskräfte standen dem Adjutanten der Stabsscharführer (Spiess) und mehrere Unterführer (Schreiber) zur Seite.
2. Die Politische Abteilung (Abteilung II)
Die Politische Abteilung (PA) war eine - in sachlicher Hinsicht - selbständige, vom Lagerkommandanten unabhängige Abteilung. An ihrer Spitze stand als Leiter ein SS-Führer im Range eines Untersturmführers, der Beamter der Gestapo war. Er war verantwortlich für die Erfassung der Neuzugänge, die ordnungsmässige Führung der Häftlingskartei und der Häftlingsakten, sowie für die termingerechte Überstellung von Häftlingen zu Polizeidienststellen und Gerichtsterminen. Seine Aufgabe war es ferner, Häftlinge zu vernehmen oder durch ihm unterstellte SS-Unterführer und SS-Männer vernehmen zu lassen. Bei Fluchten sollte er die Fahndung der zuständigen Polizeidienststellen veranlassen. Schliesslich oblag dem Leiter der Politischen Abteilung die Erstellung von angeforderten Führungszeugnissen für Schutzhaftgefangene und die Verständigung der zuständigen Staatsanwaltschaften bei unnatürlichen Todesfällen.
Der Leiter der PA hatte einen Stellvertreter, der ebenfalls ein Gestapobeamter im Range eines SS-Untersturmführers war. Ihm standen ferner weitere SS-Unterführer und SS-Männer zur Erledigung seiner Aufgaben zur Verfügung. Diese waren Angehörige der Waffen-SS und gehörten zur Stabskompanie. Die Politische Abteilung hatte mehrere Unterabteilungen:
a. Die Aufnahmeabteilung
Ihre Aufgabe war es, eingelieferte Schutzhaftgefangene aktenmässig zu erfassen. Für jeden Häftling wurde eine Karteikarte angelegt und ein Personalbogen ausgefüllt. Die Häftlingsakten, die entweder von der einweisenden Dienststelle übersandt oder bei der Aufnahme des Häftlings neu angelegt wurden, wurden in der zur Politischen Abteilung gehörenden Registratur aufbewahrt. Dort befand sich auch die Kartothek, in der sämtliche im Lager lebenden Häftlinge karteimässig erfasst waren. Starb ein Häftling, so wurde seine Karteikarte aus dieser - wie man im Sprachgebrauch des Lagers sagte - "Lebendenkartei" herausgenommen und in die sogenannte "Totenkartei" abgelegt. Die Aufnahmeabteilung gab an jeden neu in das Lager aufgenommenen Häftling eine Nummer aus. An Hand der für die Neuzugänge angelegten Personalbogen wurden dann Zugangslisten in elf- oder zwölffacher Ausfertigung geschrieben, die den einzelnen Abteilungen des Lagers, der Bekleidungskammer, Effektenkammer usw. zugestellt wurden. Personen, die sofort nach ihrer Einlieferung durch Erschiessen oder durch Gas getötet werden sollten und auch getötet wurden, wurden nicht durch die Aufnahmeabteilung in die Lagerstärke aufgenommen.
b. Die Vernehmungsabteilung
Sie war gegliedert in die ermittlungs- und die nachrichtendienstliche Abteilung. Die Ermittlungsabteilung hatte Rechtshilfeersuchen von Gerichten und Polizeidienststellen durch Vernehmungen der betreffenden Häftlinge zu erledigen. Ihre Hauptaufgabe war es aber, Vergehen von Häftlingen (z.B. Diebstähle), Untergrund- und Widerstandstätigkeit im Lager, Fluchtvorbereitungen, Verbindungen von Häftlingen zu ausserhalb des Lagers lebenden Zivilpersonen aufzuklären und die hierfür erforderlichen Vernehmungen durchzuführen. Die nachrichtendienstliche Abteilung überwachte und beobachtete die Häftlinge insbesondere im Hinblick auf konspirative Tätigkeit. Sie bediente sich vieler im Lager befindlicher Spitzel, die ihre Kameraden aus eigensüchtigen Motiven - oft zu Unrecht - an die SS verrieten. Die nachrichtendienstliche Abteilung überwachte und beobachtete auch SS-Angehörige und schritt ein, wenn Angehörige der SS in den Verdacht unzulässiger Verbindung zu Häftlingen, der Begünstigung von Häftlingen oder sonstiger strafbarer Handlungen gerieten. Bei besonderen Aufträgen durch die Gestapoleitstelle in Kattowitz oder den Lagerkommandanten beobachtete sie auch die im Lager tätigen SS-Führer.
c. Das Standesamt
Das Lager in Auschwitz hatte ein eigenes Standesamt, das zur PA gehörte. Im Standesamt wurden Geburten, Heiraten und Todesfälle registriert. Geburten kamen selten vor. Eine Heirat wurde im Jahre 1944 registriert, als ein österreichischer Häftling namens Rudi Friemel eine spanische Frau heiraten durfte. Friemel wurde - was noch in anderem Zusammenhang zu erörtern sein wird - am 30.12.1944 mit anderen Personen öffentlich erhängt.
Die Hauptarbeit des Standesamtes bestand in der Registrierung von Todesfällen. Mehrere Häftlingsschreiberinnen mussten täglich stundenlang, da meist Hunderte von Häftlingen an einem Tag starben oder zu Tode gebracht wurden, auf Grund der von einem SS-Arzt unterzeichneten Todesbescheinigungen und an Hand der Häftlingsakten der verstorbenen Gefangenen die Sterbeurkunden ausfüllen, die sie dann einem Standesbeamten (SS-Unterführer) zur Unterschrift vorlegten. Die unterschriebenen Sterbeurkunden wurden später zu Totenbüchern zusammengebunden.
Menschen aus Transporten, die nicht in die Lagerstärke aufgenommen, sondern sofort durch Gas oder auf andere Weise getötet wurden, wurden beim Standesamt nicht erfasst. Für sie wurden keine Todesurkunden ausgestellt. Zu dem Standesamt gehörte auch die Krematoriumsabteilung. Dort wurden Krematoriumsbücher geführt. In diese wurden von Häftlingsschreiberinnen die Einäscherung der vom HKB gemeldeten Toten eingetragen, wobei als Einäscherungstag der 4. Tag nach dem gemeldeten Todestag eingetragen werden musste.
d. Der Erkennungsdienst
Aufgabe des Erkennungsdienstes war es, die Neuzugänge erkennungsdienstlich zu behandeln. Von jedem Häftling wurden drei fotografische Aufnahmen gemacht und Fingerabdrücke genommen. Hiervon ausgenommen waren allerdings jüdische Häftlinge, die mit sogenannten RSHA-Transporten, auf die noch zurückzukommen sein wird, nach Auschwitz zum Zwecke der Tötung deportiert worden waren, dann aber als arbeitsfähig ausgesondert und in das Lager verbracht worden waren. Bei ihnen entfiel die erkennungsdienstliche Behandlung.
e. Die Fürsorgeabteilung
Zur Politischen Abteilung gehörte auch die Fürsorgeabteilung. Ihre Aufgabe war es, dienstliche oder private schriftliche Anfragen in bezug auf Häftlinge zu beantworten. Sie sollte auch Häftlinge in privaten Angelegenheiten (z.B. Erbschaftsangelegenheiten) beraten.
3. Die Schutzhaftlagerführung (Abteilung III)
a. Der Schutzhaftlagerführer
An der Spitze des Schutzhaftlagers stand der Schutzhaftlagerführer im Range eines SS-Führers (SS-Hauptsturm- oder SS-Obersturmführers). Er war verantwortlich für den gesamten Bereich des Häftlingslagers. In Auschwitz gab es im Stammlager drei Schutzhaftlagerführer. Der zweite und dritte Schutzhaftlagerführer unterstanden dem ersten Schutzhaftlagerführer. Sie unterstützten ihn in seinen Aufgaben. Teilweise wechselten sich die drei Schutzhaftlagerführer im Dienst ab. Ihr Dienstzimmer befand sich zunächst in der neben dem Lagereingang befindlichen Baracke, in der die Blockführerstube war, später wurde eine besondere Baracke für die Schutzhaftlagerführer in der Nähe des Lagereingangs aufgestellt. Aufgabe des Schutzhaftlagerführers war es, sich durch ein geeignetes Überwachungssystem über alle Vorgänge im Lager zu unterrichten. Er sollte ferner darauf achten, dass alle Häftlinge "streng aber gerecht" behandelt würden. Misshandlungen von Häftlingen, die ausdrücklich verboten waren, sollte er dem Lagerkommandanten melden. Missstände im Lager sollte er sofort abstellen. Der Schutzhaftlagerführer nahm morgens und abends die Zählappelle ab. Der Appell selbst wurde von dem Rapport- und den Blockführern durchgeführt. Die Blockführer meldeten die Stärke der einzelnen Blocks an den Rapportführer, der wiederum die Gesamtstärke des Lagers dem ersten Schutzhaftlagerführer meldete. Aufgabe des Schutzhaftlagerführers war es ferner, die täglich, wöchentlich und vierzehntägig von dem Rapportführer an die Kommandantur einzureichenden schriftlichen Stärkemeldungen zu unterzeichnen. Beim Ausrücken der Häftlinge zur Arbeit nach dem Morgenappell machte der Schutzhaftlagerführer am Lagertor Stichproben, ob die ausrückenden Arbeitskommandos auch die gemeldete Stärke hätten. Tagsüber kontrollierte er stichprobenweise die Arbeitskommandos. Der Schutzhaftlagerführer sollte sich auch durch Stichproben davon überzeugen, ob jeder Häftling das zustehende Essen bekäme. Durch Kostproben sollte er das zubereitete Essen überwachen. Das ihm unterstehende SS-Personal sollte er immer wieder über den Umgang mit Häftlingen belehren, insbesondere über das Verbot der Häftlingsmisshandlung. Zu Strafmeldungen, die durch Häftlingsfunktionäre oder das SS-Lagerpersonal gegen Häftlinge wegen irgendwelcher Lagervergehen gemacht wurden, sollte er den betreffenden Häftling hören und seine Stellungnahme mit dem Vorschlag einer Lagerstrafe gegenüber dem Lagerkommandanten abgeben. Schliesslich gehörte es noch zu den Aufgaben des Schutzhaftlagerführers, die Häftlinge für bestimmte Funktionen im Lager auszuwählen und in diese Funktionen einzusetzen.
b. Der Rapportführer
Der Rapportführer war stets ein SS-Unterführer (SS-Oberscharführer oder SS-Unterscharführer). Er war der unmittelbare Vorgesetzte der Blockführer und teilte diese zum Dienst ein. Wie schon unter a. ausgeführt, führte er mit deren Hilfe die Zählappelle durch und war für die genaue Erstellung der Stärkemeldung verantwortlich. Waren Vorführungen von Häftlingen zum Schutzhaftlagerführer, zur Politischen Abteilung oder zu sonstigen Dienststellen angeordnet, hatte er für deren rechtzeitige Vorführung zu sorgen. Beim Ausrücken der Häftlinge zur Arbeit überprüfte er am Lagertor stichprobenweise die Stärke der Kommandos. Beim Einrücken der Häftlinge in das Lager nach der Arbeit durchsuchte er einzelne Häftlinge, ob sie Lebens- oder Genussmittel bei sich führten, was streng verboten war. Im Lager hatte er auf Ordnung und Sauberkeit zu achten. Im übrigen kontrollierte er tagsüber auch die Arbeitskommandos. Die vom Lagerkommandanten angeordneten Strafmassnahmen hatte er durchzuführen und die Durchführung schriftlich festzuhalten.
c. Die Blockführer
Die Blockführer (SS-Unterführer oder SS-Mannschaftsdienstgrade) waren für einen oder mehrere ihnen zugeteilte Häftlingsblocks verantwortlich. Sie hatten für Ruhe, Ordnung und Sauberkeit in den Blocks zu sorgen. Dabei bedienten sie sich der Häftlingsfunktionäre, an die sie sich bei Verstössen hielten. Sie konnten zu ausserhalb des Lagers eingesetzten Arbeitskommandos eingeteilt werden und hatten dann laufend Arbeiten der Häftlinge zu überwachen und ihre Arbeitsleistungen zu überprüfen.
Täglich waren ein oder mehrere Blockführer als "Blockführer vom Dienst" eingeteilt. In dieser Eigenschaft hatten sie sich in der Blockführerstube vor dem Lagertor aufzuhalten und den Lagereingang zu überwachen. Der Blockführer vom Dienst war für das genaue Zählen der ein- und ausrückenden Häftlingsarbeitskommandos verantwortlich. Die Häftlinge, die tagsüber mit besonderem Ausweis ohne Begleitposten das Lager verliessen, musste er genau erfassen. SS-Angehörigen und Zivilangestellten, die ohne den erforderlichen besonderen Passierschein das Lager betreten wollten, musste er den Zugang verwehren.
4. Die Abteilung Verwaltung (Abteilung IV)
An der Spitze der Abteilung Verwaltung stand der erste Verwaltungsführer im Range eines SS-Führers. Dieser war verantwortlich für Unterkunft, Verpflegung, Kleidung und Besoldung des Kommandanturstabes sowie für die Unterkünfte, Verpflegung und Bekleidung der Häftlinge. Er war der Berater des Lagerkommandanten in allen wirtschaftlichen Angelegenheiten.
Dem ersten Verwaltungsführer unterstand auch die Gefangeneneigentumsverwaltung, die die gesamten, von den Häftlingen mitgebrachten und in der Effektenkammer aufbewahrten Effekten (Geld, Wertsachen, Bekleidung usw.) zu verwalten hatte. Ihm standen zur Durchführung seiner Aufgaben SS-Unterführer und SS-Männer des Verwaltungsdienstes zur Verfügung.
5. Der ärztliche Dienst (Abteilung V)
An der Spitze des ärztlichen Dienstes stand der SS-Standortarzt. Er hatte sein Dienstzimmer - wie schon oben erwähnt- in dem sogenannten SS-Reviergebäude. Ihm unterstanden die SS-Truppenärzte, die für die Behandlung des SS-Personals zuständig waren, die SS-Lagerärzte, die die Häftlinge im Schutzhaftlager ärztlich betreuen sollten, die SS-Zahnärzte, die für die zahnärztliche Behandlung des SS-Personals und die zahnärztliche Betreuung der Häftlinge zuständig waren, und der SS-Lagerapotheker, der die zum Konzentrationslager Auschwitz gehörende Lagerapotheke (im SS-Reviergebäude untergebracht) zu leiten hatte.
Den SS-Lagerärzten waren Sanitätsdienstgrade (SDG) im Range von SS-Unterführern oder SS-Männern als Gehilfen zugeteilt, die ihnen unmittelbar unterstanden. Das Stammlager hatte in der Regel einen SS-Lagerarzt, während im Lager Birkenau meist mehrere Lagerärzte in den verschiedenen Lagerabschnitten die Häftlinge betreuen sollten.
Der SS-Lagerarzt war ausser für die ärztliche Betreuung des Schutzhaftlagers auch für die hygienischen und sanitären Einrichtungen des Lagers verantwortlich. Er sollte die Hygiene des Lagers überwachen und vorbeugend Epidemien und Seuchen verhindern. Neuzugänge sollte er untersuchen, ebenso die Häftlinge, die sich täglich krank meldeten. Ferner sollte sich der Lagerarzt von der Zubereitung und der Qualität der Verpflegung in der Küche überzeugen und die in der SS-Küche sowie die in den
Häftlingsküchen beschäftigten Häftlinge ständig auf ansteckende Krankheiten hin beobachten. Missstände im Lager sollte er sofort dem Lagerkommandanten melden. Schliesslich musste der Lagerarzt in bestimmten Abständen ärztliche Berichte an die vorgesetzte Dienststelle erstatten, die davon dem Lagerkommandanten Abschriften zur Kenntnisnahme vorlegen sollte.
Im Stammlager und auch in den Lagerabschnitten in Birkenau kümmerten sich die Lagerärzte - von geringen Ausnahmen abgesehen - kaum um ihre Aufgaben. Sie überliessen die ärztliche Versorgung und Betreuung den Häftlingsärzten und Häftlingspflegern.
In grösserem Umfange liessen sie kranke Häftlinge von den SDGs oder Funktionshäftlingen durch Phenolinjektionen töten oder in den Gaskammern durch Gas töten, was noch in anderem Zusammenhang später näher zu erörtern sein wird.
6. Der Arbeitseinsatz
An der Spitze des Arbeitseinsatzes im KL Auschwitz stand der Arbeitseinsatzführer im Range eines SS-Führers. Er war für den Arbeitseinsatz der Häftlinge nach berufsmässigem Können und Leistungsfähigkeit verantwortlich. Alle Häftlinge des Lagers waren in einer sogenannten Berufskartei vom Arbeitseinsatzführer erfasst.
Dem Arbeitseinsatzführer standen zur Durchführung seiner Aufgaben sogenannte Arbeitsdienstführer (SS-Unterführer) zur Verfügung. Die Arbeitsdienstführer hatten die Arbeitskommandos zusammenzustellen, die bestehenden Arbeitskommandos zu ergänzen oder umzustellen. Sie bedienten sich zur Durchführung ihrer Aufgaben weitgehend der Häftlingsfunktionäre.
7. Die Häftlingsfunktionäre
Der inneren Organisation der SS im KL Auschwitz entsprach auf der Häftlingsseite eine Organisation im Lager, die nach dem Grundsatz der Selbstverwaltung aufgebaut war. Allerdings war diese völlig abhängig von der SS-Führung und hatte deren Willen auszuführen. An der Spitze des Schutzhaftlagers stand auf der Häftlingsseite der Lagerälteste, der von dem Schutzhaftlagerführer nach Fühlungnahme mit dem Rapportführer aus den Häftlingen ausgewählt und in diese Funktion eingesetzt wurde. Neben dem Lagerältesten für das gesamte Schutzhaftlager gab es auch noch Lagerälteste für bestimmte Teilbereiche, z.B. den HKB, der mehrere Blocks umfasste. Der Lagerälteste war verantwortlicher Vertreter des Lagers gegenüber der SS, an den sie sich jederzeit halten konnte, wenn irgendetwas zu beanstanden war, oder wenn sie irgend etwas zu verfügen hatte. Der Lagerälteste war verantwortlich für Ordnung, Ruhe und Sauberkeit im Lager. Ihm unterstanden die Blockältesten, die er aus den Häftlingen auswählte und der SS-Lagerführung zur Ernennung vorschlug.
Der erste Lagerälteste des gesamten Lagers war ein Berufsverbrecher, der aus den 30 ersten, von dem Rapportführer Palitzsch von Sachsenhausen nach Auschwitz verbrachten Häftlingen ausgewählt worden war.
Jeder Wohnblock hatte einen Blockältesten. Dieser war Vorgesetzter aller Häftlinge seines Blocks und für alles, was im Block geschah, verantwortlich. Vor allem hatte er für Ruhe, Ordnung und Sauberkeit im Block zu sorgen. Ihm oblag ferner die Verteilung der Essensportionen, wobei er sich der sogenannten Stubendienste bediente.
Die Häftlinge hatten den Lagerältesten, den Blockältesten und den Stubendiensten unbedingt zu gehorchen. Die Macht, die der Lagerälteste, die Blockältesten und die Stubendienste über die Häftlinge hatten, wurde oft auf das schwerste missbraucht. Allerdings wurden die Häftlingsfunktionäre auch für alles, was der SS-Führung im Lager oder in den Blocks irgendwie auffiel, zur Verantwortung gezogen und nicht selten bestraft. Dem Rapportführer auf seiten der SS entsprach im Lager der Rapportschreiber, der die Häftlingsschreibstube im Lager leitete. Hier wurde der gesamte, die innere Verwaltung des Lagers betreffende Verkehr erledigt (z.B. Appellvorbereitungen, Stärkemeldungen, Karteiführung usw.). Auch jeder Block hatte einen Häftlingsschreiber (Blockschreiber). Im HKB war ebenfalls eine Schreibstube, in der mehrere Schreiber tätig waren. Dort wurden alle in den HKB aufgenommenen Häftlinge karteimässig erfasst. Für verstorbene Häftlinge wurden hier die Todespapiere ausgestellt. Je eine Todesmeldung ging an die verschiedenen Dienststellen. Ferner wurden hier die vom Lagerarzt unterzeichneten Todesbescheinigungen für das Standesamt ausgeschrieben. Die Toten wurden in ein Totenbuch eingetragen. Im übrigen wurde eine Vielzahl von Häftlingsschreiberinnen bei der Politischen Abteilung sowie Häftlingsschreiber bei der Dienststelle des Standortarztes beschäftigt. Auch sonstige Arbeiten liess die SS-Führung in grossem Umfang von Häftlingen erledigen (z.B. Arbeiten des Arbeitsdienstes). Die einzelnen Arbeitskommandos wurden von Häftlingsvorgesetzten, die "Kapos" genannt wurden, befehligt und beaufsichtigt. Die Kapos brauchten selbst nicht zu arbeiten. Ihnen standen Vorarbeiter zur Unterstützung zur Seite. An sich sollte jedes Arbeitskommando durch einen SS-Kommandoführer beaufsichtigt werden, dem der Kapo verantwortlich war. Bei der Vielzahl der Arbeitskommandos war es jedoch nicht möglich, dass ständig ein SS-Kommandoführer von Beginn bis zur Beendigung der Arbeitszeit bei dem Kommando anwesend war. Die Kommandos wurden daher häufig ganz den Kapos und Vorarbeitern unter der Bewachung von SS-Posten überlassen.
Grossen Kommandos wurden mehrere Kapos unter einem Oberkapo zugeteilt.
Die Lagerältesten, Blockältesten, Kapos und Vorarbeiter waren durch Armbinden gekennzeichnet. Bei der SS hatten sie eine gewisse Vorzugsstellung. Ihr Bestreben war es daher, ihre Posten zu behalten.
8. Der Wachsturmbann
Die Wachtruppe und die Wachtposten wurden von dem Wachsturmbann, der etwa einem Bataillon der Wehrmacht entsprach, gestellt. Der Wachsturmbann war eine selbständige Einheit. An seiner Spitze stand ein SS-Führer im Range eines SS-Hauptsturm- oder Sturmbannführers. Er war in mehrere Kompanien gegliedert, die von SS-Führern als Kompaniechefs geführt wurden. Der Führer des Wachsturmbannes hatte täglich aus seiner Einheit dem Lagerkommandanten die für die Bewachung des Lagers (kleine und grosse Postenkette) und die für die Arbeitskommandos erforderlichen Wachtposten zur Verfügung zu stellen. Ferner hatte er täglich für das Lager einen "Führer vom Dienst" abzuordnen, der laufend die Wachen und Posten zu kontrollieren hatte. Eine täglich vom Wachsturmbann zu stellende Wache hatte sich ständig im Lagerbereich in Bereitschaft aufzuhalten, um im Alarmfall sofort einsatzbereit zu sein. Der Führer vom Dienst, die Wache und sämtliche zum Wachdienst eingeteilten SS-Unterführer und Mannschaften unterstanden während ihres Dienstes der Befehls- und Disziplinargewalt des Lagerkommandanten. Im Alarmfall hatte der Lagerkommandant die Befehlsgewalt über den gesamten Wachsturmbann.
Die Angehörigen des Wachsturmbannes waren nicht berechtigt, das Schutzhaftlager zu betreten. Die Begleitposten für die Arbeitskommandos nahmen die Kommandos morgens nach dem Ausrücken aus dem Lager vor dem Lagertor in Empfang. Der Führer des Wachsturmbannes sollte alle Führer, Unterführer und Mannschaften seiner Einheit eingehend über ihre Pflichten auf Wache, bei der Gefangenenbegleitung, über den Gebrauch der Schusswaffe, den Umgang mit Häftlingen, insbesondere aber über das Verbot der Häftlingsmisshandlung belehren bzw. durch die Kompanieführer belehren lassen. Belehrungen waren ständig durch die Kompanieführer zu wiederholen. Verstösse gegen das Verbot der Häftlingsmisshandlung sollten streng bestraft werden.
IV. Unterstellungsverhältnisse, Befehlsweg
Das KL Auschwitz unterstand ebenso wie alle anderen Konzentrationslager unmittelbar dem Inspekteur der KL bzw. dem WVHA, nachdem dieses am 1.2.1942 gebildet und ihm der Inspekteur der KL als Amtsgruppe D eingegliedert worden war. Das WVHA war in 5 Amtsgruppen (Amtsgruppen A, B, C, D, W) gegliedert. Die Amtsgruppe D hatte 4 Ämter, die folgende Zuständigkeitsbereiche umfassten:
1. Amt D I: Zentralamt mit den Referaten
D I/1: Häftlingsangelegenheiten
D I/2: Nachrichtenwesen, Lagerschutz und Wachhunde
D I/3: Kraftfahrwesen
D I/4: Waffen und Geräte
D I/5: Schulung der Truppe
2. Amt D II: Arbeitseinsatz der Häftlinge
3. Amt D III: Sanitätswesen und Lagerhygiene
4. Amt D IV: KL-Verwaltung
Den Zuständigkeitsbereichen der Ämter I bis IV der Amtsgruppe D entsprachen die oben unter III angeführten Zuständigkeitsbereiche der verschiedenen Abteilungen im Konzentrationslager Auschwitz, d.h. dem Zentralamt (D I) entsprach die Lagerkommandantur, dem Amt D II der Arbeitseinsatzführer, dem Amt D III der Standortarzt, dem Amt D IV die Abteilung Verwaltung.
Allgemeine Weisungen und Befehle über grundsätzliche Fragen der Häftlingsbehandlung und bezüglich allgemeiner Fragen des Konzentrationslagers erhielt der Lagerkommandant unmittelbar vom Amtsgruppenchef der Amtsgruppe D. Der Amtschef des Amtes D I konnte dem Lagerkommandanten insoweit nicht von sich aus, sondern nur über den Amtsgruppenchef Befehle erteilen. Die übrigen Amtschefs hatten jedoch auf ihren Sachgebieten unmittelbar Weisungsbefugnis gegenüber den entsprechenden Dienststellen im Lager. Das bedeutete, dass der Chef des Amtes D II seine Weisungen bezüglich des Arbeitseinsatzes nicht an den Lagerkommandanten, sondern unmittelbar an den Arbeitseinsatzführer im Lager erteilte, mit dem er in ständigem Kontakt stand, und dass der Standortarzt vom Chef des Amtes D III (dem leitenden Arzt der KL) unmittelbar seine Befehle erhielt, und dass schliesslich der Verwaltungsführer seine Weisungen vom Amtschef D IV unmittelbar bezog. Meldungen, Berichte, Anforderungen und Anfragen usw. gingen ebenfalls unmittelbar von den genannten Abteilungen im Konzentrationslager Auschwitz zu den Ämtern der Amtsgruppe D, denen sie unmittelbar unterstanden. Allerdings sollte der Lagerkommandant in allen wichtigen Fragen auf dem laufenden gehalten werden. Inwieweit ihm Abschriften des Schriftverkehrs, der erteilten Anweisungen und Befehle zur Kenntnisnahme zugeleitet worden sind, ist im einzelnen nicht aufgeklärt worden.
Die Belieferung des Lagers mit Nahrungsmitteln erfolgte durch das örtlich zuständige Zivilernährungsamt unter Mitwirkung des Amtes D IV.
Die grösste Bedeutung erhielt im Verlaufe des Krieges das Amt D II (Arbeitseinsatz). Dieses Amt hatte unter anderem auch die Zuweisung von Häftlingen an kriegswirtschaftlich wichtige Betriebe (z.B. die IG-Farben AG, die Siemenswerke usw.) zu genehmigen und die Bedingungen hierfür auszuhandeln. Die Verantwortung für die Versorgung und bauliche Ausstattung des KL Auschwitz lag ausserhalb des Zuständigkeitsbereiches der Amtsgruppe D. Für die Bauangelegenheiten war die Amtsgruppe C des WVHA zuständig, während die Amtsgruppe B Amt II die Wachmannschaft und die Häftlinge mit Bekleidung zu versorgen hatte.
Wie oben bereits ausgeführt, hatte das WVHA mit der Einweisung und Entlassung von Schutzhaftgefangenen unmittelbar nichts zu tun. Dies war Sache des RSHA bzw. des Amtes IV im RSHA. Im KL Auschwitz bildete die politische Abteilung das ausführende Organ des RSHA bzw. des Amtes IV. Unmittelbar unterstand sie zwar der Gestapoleitstelle in Kattowitz, sie erhielt aber häufig auch unmittelbar Anweisungen und Befehle durch das RSHA. Z.B. gingen Exekutionsbefehle vom RSHA unmittelbar an die Politische Abteilung. Auch die Führungsberichte über Schutzhaftgefangene waren an das RSHA zu richten. Von ihm wurden Einweisungen und Entlassungen von Schutzhaftgefangenen verfügt.
Der Chef der Politischen Abteilung war als Gestapobeamter nur dem RSHA bzw. der Gestapoleitstelle in Kattowitz verantwortlich. Er unterstand dieser sowohl sachlich als auch disziplinär. Das gleiche galt für seinen Vertreter. Die Politische Abteilung war daher auch im Kreise der SS im Lagerbereich gefürchtet. Die anderen Angehörigen der Politischen Abteilung unterstanden als Angehörige der Waffen-SS zwar sachlich ebenfalls der Gestapo bzw. dem RSHA, gehörten aber zur Stabskompanie und unterlagen der Disziplinargewalt des Adjutanten.
Für den Lagerkommandanten in Auschwitz gab es in bezug auf die Unterstellungs- und Befehlsverhältnisse eine Ausnahme: Höss, der erste Lagerkommandant in Auschwitz, wurde - wie noch später näher auszuführen sein wird - nach dem Entschluss Hitlers, die in seinem Macht- und Herrschaftsbereich lebenden jüdischen Menschen zu "liquidieren", von Himmler damit beauftragt, in Auschwitz die Voraussetzungen für eine solche massenweise Tötung zu schaffen. Insoweit wurde er unmittelbar dem RSHA unterstellt und empfing von dieser Dienststelle unmittelbar seine Befehle für die Tötung der zur Vernichtung nach Auschwitz deportierten jüdischen Menschen. Auch seine späteren Nachfolger trugen als Lagerkommandanten die unmittelbare Verantwortung für die Durchführung dieser Aktionen gegenüber dem RSHA unmittelbar.
V. Die Lebensverhältnisse der Schutzhaftgefangenen
1. Unterbringung
Im Stammlager waren die Gefangenen - wie schon ausgeführt - in Steingebäuden untergebracht. Nach der Aufstockung der Gebäude wohnten im Parterre und im I. Stock eines jeden Wohngebäudes je eine unter einem Blockältesten zusammengefasste Gemeinschaft von Häftlingen, Block genannt, von denen der eine die Nummer des Steingebäudes ohne Zusatz, der andere die gleiche Nummer mit dem Zusatz des Buchstaben A trugen (z.B. Block 8 und 8 A, das waren zwei Häftlingsblocks, die in dem Steingebäude Nr.8 wohnten).
Die Unterkünfte der Gefangenen waren fast immer überbelegt. Im Stammlager waren die Blocks für etwa 400 Personen berechnet. Tatsächlich mussten aber häufig 700 bis 1000 und mehr Häftlinge darin unterkommen. Die vorhandenen 3stöckigen Betten reichten für diese Belegstärke nicht aus. Daher mussten meist zwei oder drei Häftlinge in einem Bett schlafen. In Birkenau waren die Unterbringungsverhältnisse noch wesentlich schlechter. Im Lager B I, das zuletzt - wie oben bereits ausgeführt - nur noch Frauenkonzentrationslager war, mussten die Gefangenen in den unverputzten Steinbaracken in düsteren, aus Stein gemauerten Boxen an Stelle von Betten und Holzpritschen schlafen. Auch hier waren die Baracken meist überbelegt. Die Frauen schliefen zu zweit, zu dritt oder manchmal auch zu viert in einer Schlafbox. Als Schlafunterlagen dienten Papiersäcke, die mit Holzwolle gestopft waren. Die Holzwolle knüllte sich im Laufe der Zeit zusammen. Sie war völlig verstaubt und verschmutzt, meist auch mit Kot, weil viele Frauen an ständigem Durchfall litten. Bettlaken fehlten fast ganz. Soweit sich Frauen welche organisiert hatten, waren sie grau vor Schmutz. Für jede Schlafbox wurde nur eine Decke ausgegeben, so dass sich mehrere Häftlingsfrauen mit einer einzigen Decke zudecken mussten.
Die fensterlosen Wehrmachtspferdestallbaracken im Lager B II bestanden nur aus dünnen Holzwänden, durch deren Ritzen in der kalten Jahreszeit Kälte und Wind ungehinderten Zugang zum Innern der Baracken hatten. Die Dächer der Baracken waren nicht wasserdicht. An vielen Stellen regnete es bei schlechtem Wetter durch. Die 3stöckigen Holzpritschen waren nur mit Stroh belegt, das verschmutzt und verstaubt oder durchnässt war. Manchmal fehlte das Stroh auch ganz. Dann schliefen die Gefangenen auf den blanken Brettern. Die Baracken in Birkenau hatten nur gestampfte Lehmfussböden. Bei trockenem Wetter wirbelte der Staub in Wolken von den Böden hoch. Bei Regenwetter bildeten sich auf ihm infolge der undichten Dächer Wasserlachen und Schlamm. In der Holzwolle und dem Stroh der Lagerstätten wimmelte es von Flöhen, Läusen und anderem Ungeziefer, das zu einer unerträglichen Plage der Gefangenen wurde. Ratten nagten an den Leichen, die täglich an den Baracken und in den Leichenkammern bis zur Verbrennung in den Krematorien hingelegt wurden. Nicht selten griffen sie auch kranke Häftlinge an.
Bei Regenwetter verwandelte sich das Lager Birkenau - vor allem das Zigeunerlager (B II e) - in einen Morast. Der zähe Schlamm klebte am Schuhwerk bzw. an den Holzpantinen der Gefangenen.
2. Sanitäre und hygienische Verhältnisse im Lager
Die sanitären und hygienischen Verhältnisse in Birkenau waren völlig unzureichend. In Birkenau und Umgebung gab es überhaupt kein Trinkwasser. Alle Brunnen waren von Kolibazillen verseucht. Vorhandene Wassertümpel waren voller Stechmücken. Das ganze Gebiet war für ein Lager mit einer grossen Anzahl von Menschen völlig ungeeignet. Durch den Bau eines Entwässerungsgrabens, des sogenannten Königsgrabens, bei dessen Bau viele Häftlinge starben, sollte eine gewisse Verbesserung erreicht werden. In den Baracken waren keine Waschräume und Toiletten - ausser in Block 11 des Lagerabschnittes B II d -. Im Frauenlager (B I) bestanden die Latrinen aus einem Graben mit einer Mauer. Am Ende des Grabens war ein Wasserrohr, aus dem nichttrinkbares Wasser floss. Es war die einzige Wasserquelle. Ein weiblicher Kapo musste sie bewachen.
In den einzelnen Abschnitten des Lagers B II waren die Latrinen in Holzbaracken. Sie bestanden aus 6 Reihen von Betonsockeln, die mit Löchern versehen waren. Die Latrinen reichten bei weitem nicht für die grosse Anzahl der in den einzelnen Lagerabschnitten untergebrachten Menschen aus, zumal viele infolge der schlechten und mangelhaften Ernährung an Durchfall litten. Nachts durften die Häftlinge die Baracken nicht verlassen. Sie konnten daher auch nicht die Latrinen aufsuchen. Ihre Notdurft mussten sie in einem in der Baracke bereitstehenden Kübel verrichten, der morgens geleert wurde. Zum Waschen hatte jeder Lagerabschnitt in Birkenau zwei Waschbaracken. Durch sie liefen drei Eisenrohre mit kleinen Löchern hindurch, aus denen das Wasser in Holztröge floss. In den Trögen mussten sich die Häftlinge waschen. Oft floss das Wasser nur spärlich. Seife hatten nur die bevorzugten Häftlinge oder diejenigen, die sich auf irgendeine Weise Seife besorgen konnten. Auch fehlte es weitgehend an Handtüchern. Viele Häftlinge wuschen sich daher nur selten oder überhaupt nicht.
3. Bekleidung
Jedem, der in das KL Auschwitz aufgenommen wurde, wurde seine persönliche Kleidung abgenommen. Er bekam dafür Häftlingskleidung (gestreifte Anzüge, Unterwäsche, Mütze und Holzschuhe). Oft passte die Kleidung nicht und war völlig, insbesondere im Winter, unzureichend. So hatten z.B. im FKL die meisten Frauen keine Strümpfe. Die Holzschuhe, in denen zu gehen für viele Häftlinge ungewohnt war, verursachten Blasen und eitrige Geschwüre an den Füssen und riefen Infektionen hervor. Viele Häftlinge mussten daher barfuss zur Arbeit gehen. Krankheiten und Tod waren die häufige Folge.
4. Ernährung
Die Verpflegung im Konzentrationslager Auschwitz war schlecht und unzureichend. Die Häftlinge erhielten nicht die ihnen offiziell zustehenden Nahrungsmengen, die bei völliger Ruhe oder geringer Arbeit evtl. zum Überleben ausgereicht hätten. Denn die mit der Verteilung der Verpflegung befassten SS-Angehörigen und Häftlinge zweigten von den geringen Häftlingsportionen noch gewisse Mengen für ihren eigenen Bedarf ab. Die Qualität der Lebensmittel, insbesondere des Fleisches, der Wurst und der von den Lagerküchen zubereiteten Suppen, war sehr schlecht. Das Vieh, das für das Lager angeliefert wurde, war alt und abgemagert. Die mindere Qualität der Suppen und die in ihr massenweise enthaltenen Bakterien verursachten bei vielen Häftlingen Durchfall. Die Gefangenen litten infolge der unzureichenden Ernährung unter ständigem quälenden Hunger. Sie waren in kurzer Zeit nach der Aufnahme in das Lager völlig abgemagert. Diese körperlich heruntergekommenen Häftlinge, bei denen der Körper den Fettvorrat verbraucht und auch grosse Teile der Muskeln aufgezehrt hatte, so dass sich die Haut nur noch über das Knochenskelett spannte, wurden in der Lagersprache "Muselmänner" genannt. Sie bewegten sich nur noch langsam wie Eidechsen bei Kälte. Sie verloren jedes Interesse an ihrer Umgebung und wurden ihrem eigenen Schicksal gegenüber gleichgültig und apathisch. Sie starben alsbald an Entkräftung.
Allerdings gab es auch Arbeitskommandos, bei denen die Häftlinge verbesserte Verpflegung bekamen (z.B. die in den landwirtschaftlichen Betrieben arbeiteten) oder mehr essen konnten (z.B. die in den Häftlingsküchen Beschäftigten).
Wer nicht in der Lage war, sich durch Beziehungen im Lager oder durch Verbindung zu Zivilpersonen ausserhalb des Lagers oder durch Lebensmittelpakete, die alle nichtjüdischen Häftlinge erhalten durften, zusätzlich Lebensmittel zu verschaffen, war in der Regel bereits nach 4 bis 6 Monaten zum "Muselmann" abgemagert und starb. Die unzureichende Ernährung im KL Auschwitz - vor allem in den Jahren 1942 und 1943 - führte dazu, dass die Häftlinge massenweise an Entkräftung oder an Erkrankungen, die die Folge der Unterernährung waren, starben, wenn sie nicht schon vorher auf andere Weise zu Tode gebracht worden waren. So lebten z.B. von 2000 Frauen (1000 jüdischen Slowakinnen und 1000 reichsdeutschen Frauen), die im Frühjahr 1942 in das KL Auschwitz aufgenommen worden waren, im März 1943 nur noch 260. Von 34 Frauen, die am 20.3.1943 mit der Zeugin Dr. Li. in das Lager B I in Birkenau eingeliefert worden waren, lebten nach einem Jahr nur noch 2, nämlich die Zeugin Dr. Li., die als Ärztin im Lager eingesetzt worden war und eine andere Frau, die die Funktion eines Kapos erhalten hatte. Die Zeugin Dr. Li. konnte nur deswegen überleben, weil sie laufend Lebensmittelpakete erhielt. Die andere Frau konnte sich als Kapo zusätzliche Nahrungsmittel beschaffen. Im Winter 1943/1944 gab es im FKL durchschnittlich täglich 350 Tote.
Im Stammlager schrieben im Jahre 1942 7 Häftlinge Tag und Nacht nur Todesmeldungen aus. Die hohe Sterblichkeit beunruhigte schliesslich die höheren Dienststellen. Immer wieder wurde vom WVHA darauf hingewiesen, dass zur Erhaltung von Arbeitskräften alles getan werden müsse. Da jedoch die allgemeinen Lagerverhältnisse und insbesondere die Verpflegung nicht verbessert wurden, die in Auschwitz tätigen SS-Angehörigen offenbar an einer Änderung der allgemeinen Situation auch nicht interessiert waren, trat keine Änderung ein. Erst nach der Dreiteilung des Lagerbereiches und der Ablösung des ersten Lagerkommandanten Höss durch den SS-Sturmbannführer Liebehenschel besserten sich die allgemeinen Verhältnisse allmählich. Die Sterblichkeit ging etwas zurück.
5. Die Arbeitsfron der Gefangenen
Trotz dieser unzureichenden Ernährung mussten die Häftlinge während des ganzen Tages neun bis zehn Stunden, ab 20.4.1942 sogar 11 Stunden hart arbeiten. Von dem genannten Datum an war die Arbeitszeit während des Sommers von 6 Uhr bis 11 Uhr am Vormittag und von 13 Uhr bis 19 Uhr am Nachmittag festgesetzt. Sonntags wurde in der Regel nicht gearbeitet. Allerdings bestanden erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Arbeitskommandos. Am schwersten waren die Arbeiten beim Bau der Lagerstrassen im Stammlager und in Birkenau, die mit einer Walze, die von Häftlingen gezogen wurde, befestigt wurden, ferner die Arbeiten in der Kiesgrube, beim Bau des bereits erwähnten Königsgrabens u.a. Bevorzugt waren Arbeiten bei den landwirtschaftlichen Kommandos, den Fischteichen, vor allem aber Arbeiten in der Küche (z.B. beim Kartoffelschälkommando), in der Nähstube (im FKL) und in den Werkstätten. Bei den Arbeitskommandos wurden die Häftlinge von Kapos und Vorarbeitern ständig angetrieben. Viele starben bei der Arbeit. Die Leichen wurden abends zum Appell mit in das Lager gebracht und beim Zählappell vor die angetretenen Blocks gelegt. Nicht selten kam es auch vor, dass Häftlinge bei der Arbeit von Kapos, Vorarbeitern oder SS-Angehörigen totgeschlagen wurden.
6. Krankheiten und Seuchen
Die mangelhafte Ernährung, die schlechten hygienischen und sanitären Verhältnisse, der Schmutz und das Ungeziefer, sowie die Überbelegung der Wohnblocks führte dazu, dass ständig eine grosse Anzahl von Häftlingen krank und der Häftlingskrankenbau überfüllt war. Alle denkbaren Infektionskrankheiten und Seuchen breiteten sich aus. Besonders verbreitet und gefürchtet waren Typhus, Ruhr und Cholera. Auch sie trugen zu dem Massensterben bei. Als im Jahre 1942 sogar SS-Angehörige von Typhus infiziert wurden und man der Typhusepidemie nicht mehr Herr werden konnte, wurden - worauf später noch näher eingegangen werden muss - mindestens 700 Typhuskranke, unter denen sich auch schon Genesende befanden, durch Gas getötet. Im übrigen entledigte man sich der kranken Häftlinge, indem man sie massenweise durch Phenol oder Gas töten liess. Auch hierauf wird bei der Erörterung der Straftaten der Angeklagten noch zurückzukommen sein.
7. Richtlinien für die Behandlung der Häftlinge
Im KL Auschwitz war es - wie in allen übrigen Konzentrationslagern - allen SS-Angehörigen untersagt, die Häftlinge zu misshandeln oder gar zu töten. Über dieses Verbot wurden sie immer wieder belehrt. Jeder im KL Auschwitz eingesetzte SS-Angehörige musste eine schriftliche ehrenwörtliche Verpflichtung unterschreiben, die zu seinen Personalakten genommen wurde und die folgenden Wortlaut hatte: "Über Leben und Tod eines Staatsfeindes entscheidet der Führer. Kein Nationalsozialist ist daher berechtigt, Hand an einen Staatsfeind zu legen oder ihn körperlich zu misshandeln. Bestraft wird jeder Häftling nur durch den Kommandanten." Die Häftlinge sollten streng und hart und unter Wahrung der erforderlichen Distanz - wie man sie gegenüber "Staatsfeinden" für selbstverständlich hielt - behandelt, jedoch nicht misshandelt werden. Bei Verstössen gegen die Lagerdisziplin oder bei sonstigen Vergehen sollten die betreffenden Häftlinge dem Lagerkommandanten auf dem Dienstweg (über den Schutzhaftlagerführer, der seine Stellungnahme abzugeben hatte) gemeldet werden, der dann über die zu verhängende Strafe zu entscheiden hatte. Als Strafen kamen unter anderem in Betracht: Einweisung in die Strafkompanie, Arrest und die Prügelstrafe. Für die Prügelstrafe war die Genehmigung des Amtsgruppenchefs der Amtsgruppe D (Glücks) erforderlich. Sie sollte im Beisein eines Arztes vollstreckt werden, der vor dem Vollzug der Strafe den Delinquenten auf seinen Gesundheitszustand untersuchen sollte. In der Regel wurden 25 Stockhiebe verhängt, wenn offiziell Genehmigung für die Prügelstrafe eingeholt worden war.
Bei der höheren Führung im WVHA (Amtsgruppenchef Glücks) galt es als selbstverständlich, dass ein SS-Unterführer, Kommandoführer oder Wachtposten einen Häftling weder schlagen noch stossen, ja nicht einmal berühren dürfe.
8. Die tatsächliche Behandlung der Gefangenen im KL Auschwitz durch die SS-Angehörigen und die Häftlingsfunktionäre
Die SS-Führer, SS-Unterführer und SS-Mannschaften im KL Auschwitz missachteten ständig - von Ausnahmen abgesehen - die Richtlinien für die Häftlingsbehandlung. Die Häftlinge wurden erniedrigt, schikaniert und misshandelt. Bei den geringsten "Vergehen" schlugen die SS-Männer auf die Häftlinge mit der Hand oder mit der Faust oder mit einem Stock ein oder traten sie ins Gesäss, in den Leib oder andere Körperteile. Das Menschenleben galt in Auschwitz nichts. Nicht selten wurden Häftlinge so lange misshandelt, bis sie starben. Viele Blockälteste und Kapos - jedoch nicht alle - standen den SS-Angehörigen in dieser Beziehung nicht nach. Sie übertrafen sie häufig noch an Grausamkeit und Brutalität. Von der SS aufgestachelt und angetrieben, waren sie bestrebt, sich auf diese Weise bei der SS in ein gutes Licht zu setzen, um ihre bevorzugten Posten zu behalten. Besonders gefährdet waren jüdische Häftlinge. Sie bildeten die unterste Stufe der Konzentrationslagergefangenen. Man sah sie nicht als Menschen, sondern als Schädlinge, Ungeziefer oder Bazillenträger an, die es zu vernichten galt. In noch stärkerem Masse als andere Häftlinge waren sie ständig den Schikanen und Misshandlungen ausgesetzt. Ihr Leben war ständig bedroht. In der ersten Zeit wurden jüdische Häftlinge nach ihrer Aufnahme in das KL automatisch in die Strafkompanie eingewiesen, die sich bis zum Jahre 1942 im Block 11 im Stammlager befand und dann nach Birkenau in das Lager B I und schliesslich in den Lagerabschnitt B II d (Block 11) verlegt wurde. In der SK waren die Häftlinge, insbesondere die Juden, schwersten Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Nur wenige überlebten.
Es kam auch vor, dass der Schutzhaftlagerführer SS-Hauptsturmführer Aumeier beim Ausrücken eines Arbeitskommandos den Kommandoführer oder Kapo zu sich rief und ihm befahl: "Am Samstag ist Dein Kommando judenrein!" Während der Arbeit stürzten sich dann die Kapos auf ein Zeichen des Kommandoführers auf die jüdischen Häftlinge, trieben sie mit Stöcken zum Laufschritt beim Arbeiten an, wobei sie ständig auf sie einschlugen, bis sie erschöpft zusammenbrachen. Wer dann noch lebte, wurde totgeschlagen oder erwürgt. Hierfür hatte man eine besondere Methode entwickelt, die in der Lagersprache "Krawatte legen" genannt wurde. Dem auf dem Boden liegenden Häftling wurde ein Schaufelstiel oder ein Stock auf den Hals gelegt. Dann stellte sich der Kapo oder ein hierzu befohlener Häftling auf die beiden Enden des Stieles oder Stockes und wippte so lange hin und her, bis der Häftling tot war.
Eine andere Methode, die Häftlinge zu töten, bestand darin, dass SS-Wachtposten einem Häftling die Mütze abnehmen und über die Postenkette, eine Linie, die an sich kein Häftling überschreiten durfte, warf. Lief dann der Häftling auf den Befehl des SS-Mannes oder des Kommandoführers hin, um seine Mütze zu holen, wurde er wegen Überschreitens der Postenkette "Auf der Flucht" erschossen. Diese Methode des sogenannten Mützenwerfens wendeten die SS-Posten besonders gern bei Neulingen an, die die Lagerverhältnisse und die Gebräuche und Methoden der SS noch nicht kannten. Ältere Häftlinge, die die Folgen dieses Mützenwerfens kannten, kamen dem Befehl, die Mütze wiederzuholen, nicht mehr nach. Zwar durfte kein Häftling in Auschwitz ohne Mütze sein. Da im Lager aber täglich viele Menschen starben, war es nicht schwer für einen Häftling, sich von einem Toten eine Mütze zu besorgen.
Eine beliebte Methode, Häftlinge zu quälen und zu schikanieren, war das sogenannte "Sportmachen". Die "Sportübungen" wurden von SS-Angehörigen oder Blockältesten (häufig auf Befehl der SS, aber auch eigenmächtig) den Häftlingen befohlen. Sie dienten dazu, ganze Gruppen von Häftlingen und einzelne Häftlinge für irgendwelche kleinen "Vergehen" zu bestrafen. Bei den "Sportübungen" mussten die Häftlinge nicht nur jedes vernünftige Mass überschreitende gymnastische Übungen machen, sondern sie mussten sich auf Befehl des Leiters des "Sports" in schnellem Tempo hinwerfen, wieder aufstehen, im Kreise herumrennen, auf dem Bauche kriechen, hüpfen usw., bis sie vor Erschöpfung die befohlenen Übungen nicht mehr mitmachen konnten. Praktisch waren die "Sportübungen" ein Strafexerzieren.
Häufig brachen erschöpfte und ausgehungerte Häftlinge infolge der übermässigen körperlichen Anstrengungen bewusstlos zusammen. Dann wurden sie noch von den SS-Männern und Blockältesten getreten. Schliesslich wurden sie von ihren Kameraden weggetragen.
VI. Die Disziplin der SS-Angehörigen in Auschwitz
So wenig sich die SS-Angehörigen im KL Auschwitz - von Ausnahmen abgesehen - um die Richtlinien über die Häftlingsbehandlung kümmerten, so wenig beachteten sie andere Vorschriften und Befehle. Allen war unter schwersten Strafen verboten, sich an Häftlingsgut zu vergreifen. Es gab aber kaum SS-Angehörige, die sich nicht am Geld, den Devisen, Wertgegenständen, an der Wäsche und Kleidung und anderen Dingen, die man den zur Vernichtung nach Auschwitz verbrachten Juden abgenommen hatte, bereicherten. Jede Gelegenheit, solche Dinge an sich zu bringen, wurde ausgenützt. Wer keine Gelegenheit hatte, sich selbst unmittelbar solche Sachen anzueignen, liess sich von Untergebenen, Kapos oder anderen Häftlingen die Dinge besorgen. SS-Angehörige und Gefangene, die in dem bereits erwähnten Effektenlager "Kanada" arbeiteten, brachten das Häftlingsgut an sich und trieben damit im Lager einen schwunghaften Handel. Von den SS-Führern, Unterführern und Männern erkauften sich die Häftlinge damit Vorteile, nicht selten das Leben von Kameraden. Kapos, die mit ihren Arbeitskommandos in den SS-Wirtschaftsbetrieben arbeiteten, mussten SS-Angehörige mit Möbeln und sonstigen Gebrauchsgegenständen versorgen. Auch hiermit erkauften sie sich Vergünstigungen. Im KL Auschwitz war alles käuflich. Alles hatte seinen Preis.
Die Korruption untergrub die Manneszucht und Disziplin. Die Autorität der SS-Führer und Unterführer ihren Untergebenen gegenüber war meist gering. Die Vorgesetzten konnten sich ihren Untergebenen gegenüber nicht durchsetzen, weil diese von ihren Verfehlungen und ihrer Bestechlichkeit wussten. Fast jeder hatte den anderen in der Hand.
Alkoholexzesse waren häufig. Nicht selten verrichteten SS-Angehörige aller Dienstgrade in betrunkenem Zustand ihren Dienst, ohne dass Vorgesetzte einschritten. Mit Kapos, Blockältesten oder anderen
bevorzugten Häftlingen hielten sie Trinkgelage ab, ohne sich um die Vorschriften zu kümmern, die solche Kontakte untersagten. Manche liessen sich auch mit Häftlingsfrauen, auch Jüdinnen und Zigeunerinnen, in intimen Verkehr ein, was ebenfalls unter schwerster Strafe verboten war.
Auch sonst hielten SS-Männer nicht die befohlene Distanz zu den Häftlingsfrauen. Disziplinlosigkeiten, Ungehorsam, schlechtes Benehmen in der Öffentlichkeit, insbesondere Frauen gegenüber, mussten immer wieder in Standort- und Kommandanturbefehlen und sonstigen Befehlen gerügt werden, ohne dass eine Besserung eintrat. Auch gerichtliche Verfahren, die von der SS-Gerichtsbarkeit gegen eine grosse Anzahl von SS-Angehörigen, auch Führer, wegen Bereicherung an Häftlingsgut, Veruntreuung, Diebstählen usw. durchgeführt wurden und in der Mehrzahl mit schweren Strafen für die Betroffenen endeten, änderten an der allgemeinen Korruption und Disziplinlosigkeit in Auschwitz nichts.
VII. Das KL Auschwitz als Vernichtungslager
1. Das KL Auschwitz als Hinrichtungsstätte für Polen
Das KL Auschwitz diente nicht nur der Ausschaltung und Verwahrung von sogenannten Staatsfeinden und von massenweise in Polen verhafteter vermeintlicher oder wirklicher Widerstandskämpfer und Angehöriger von Untergrundorganisationen, sondern auch als Exekutionsstätte für Polen, die zum Zwecke der "Liquidierung" in das Lager eingeliefert wurden. Hierzu kam es im Zuge der allgemeinen nationalsozialistischen Polenpolitik, über die in diesem Zusammenhang ein kurzer Überblick gegeben werden soll:
Zu einem untrennbaren Bestandteil nationalsozialistischer Programmatik gehörte die Gewinnung deutschen Lebensraumes im Osten. Hitler hatte bereits vor der Machtergreifung in seinem Buch "Mein Kampf" zum Ausdruck gebracht, dass er die Eroberung neuen Lebensraumes im Osten als lebensnotwendig für das deutsche Volk ansah. Allerdings richtete sich sein Blick damals in erster Linie auf die fruchtbaren Gebiete in der Ukraine. Auch nach der Machtergreifung zielten seine diesbezüglichen - zunächst noch verschwommenen - Pläne nicht unbedingt gegen das polnische Volk und den polnischen Staat. Im Jahre 1934 schloss er sogar noch mit Polen einen Nichtangriffspakt ab, vor dessen Staatschef Marschall Pilsudski er eine gewisse Hochachtung hatte. Sowjetrussland war für ihn der ideologische Feind Nr.1, mit dem eine kriegerische Auseinandersetzung in absehbarer Zeit unvermeidlich erschien. Er glaubte daher, im Kampf mit Russland, eventuell mit polnischer Unterstützung, den Lebensraum für das deutsche Volk gewinnen zu müssen. Mit Polen bestand noch bis zum Frühjahr 1939 weitgehend aussenpolitisches Einvernehmen. Erst als sich die polnische Regierung im Jahre 1939 Hitlers dynamisch-erpresserischer Diplomatie und Politik in der Korridor- und Danziger Frage im Bunde mit England widersetzte, änderte sich Hitlers Einstellung zu Polen grundlegend. Nun richtete sich sein Blick, wenn er an die Ausdehnung des deutschen Lebensraumes dachte, auf die Gebiete in West- und Mittelpolen. Er entschloss sich, durch einen überraschenden militärischen Überfall diese Gebiete zu erobern. Um sich hierfür freie Hand im Osten zu verschaffen, trat er in Verhandlungen zu der Sowjetunion ein, die ihren Abschluss in dem Pakt mit Stalin am 23.8.1939 fanden. Dieser deutsch-sowjetische Grenz- und Freundschaftsvertrag bedeutete die Aufteilung Polens in eine deutsche und eine sowjetische Interessenzone. West- und Mittelpolen boten sich Hitler nun seinen Plänen einer deutschen Raumerweiterung und völkischen Expansion nach Osten dar. Ihm ging es bei seinen Plänen aber nicht nur um die Ausschaltung der polnischen Staats- und Militärmacht und die Annexion von Territorium, sondern um einen völkisch biologischen Kampf zwischen der germanischen "Herrenrasse" und einer "minderwertigen" slawischen Nation, deren lebendige Kraft es auszuschalten galt. Daher war seine Politik gegenüber Polen, deren Grundsätze und Ziele er unter anderem in seinen Instruktionen an die Oberbefehlshaber der Wehrmacht am 14. und 22.8.1939, in seiner Rede vom 20.9.1939 in Danzig, in der Rede am 6.10.1939 vor dem Reichstag, in einer Besprechung Ende September 1939 mit Gauleiter Forster, Himmler, Heydrich u.a., sowie in einer Besprechung am 17.10.1939 mit Himmler, Keitel, Rudolf Hess, Martin Bormann u.a. zum Ausdruck brachte und in einer Besprechung mit dem Generalgouverneur des Generalgouvernements und anderen SS-Führern am 2.10.1940 bestätigte, gekennzeichnet durch einen unter Missachtung aller sittlichen, moralischen und rechtlichen Grundsätze geführten harten und rücksichtslosen Kampf gegen das polnische Volkstum, die Ausschaltung und Vernichtung der polnischen Führungsschicht und die Unterdrückung und Ausbeutung der übrigen polnischen Bevölkerung. Nur beispielhaft seien einige Äusserungen Hitlers bei der Besprechung am 17.10.1939, die die Grundzüge seiner radikalen Politik gegenüber dem polnischen Volk erkennen lassen, angeführt:
Hitler erklärte unter anderem, man müsse verhindern, dass die polnische Intelligenz sich als Führerschicht aufmache, es gelte einen harten Volkstumskampf zu führen, der keine gesetzlichen Bindungen gestatte. Die in Polen anzuwendenden Methoden würden mit den geläufigen Massstäben der Reichsverwaltung unvereinbar sein. Das ausserhalb der Reichsgrenzen zu bildende Generalgouvernement solle es ermöglichen, das alte und neue Reichsgebiet zu säubern von Juden, Polaken und Gesindel. In dem Abschiebungsgebiet solle nur ein niederer Lebensstandard bleiben. Dort sollten nur Arbeitskräfte geschöpft werden.
Hauptträger des von Hitler bewusst gewollten Kampfes gegen das polnische Volk war nach dem Einmarsch der deutschen Truppen und der Ausschaltung der polnischen Streitkräfte der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei und die ihm unterstellten SS- und Polizeikräfte (Sicherheitspolizei, SD und Ordnungspolizei) sowie die NS-Gauleiter und sonstige Parteifunktionäre.
Aus SD-Führern, Abordnungen der Gestapo, der Kriminal- und Ordnungspolizei wurden schon vor Beginn des Polenfeldzuges fünf Einsatzgruppen unter der Tarnbezeichnung "Unternehmen Tannenberg" gebildet. Sie rückten mit den deutschen Armeen, denen sie unterstellt wurden, nach Polen ein. Später kam eine sechste Gruppe hinzu. Der 14. Armee, die über das ostoberschlesische Industriegebiet nach Galizien vordrang, wurde ausserdem eine besondere "Einsatzgruppe z.b.V." zugeteilt. In einem internen Runderlass an die verschiedenen Dienststellen der SS und Polizei vom 13.9.1939 umschrieb Heydrich den Auftrag der Einsatzgruppen nur allgemein: Sie hätten im besetzten Gebiet die Aufgaben der Bekämpfung aller reichs- und deutschfeindlichen Elemente rückwärts der fechtenden Truppe. Tatsächlich erhielten aber die Führer der mit den Truppen nach Polen einmarschierenden Einsatzgruppen in geheimen Befehlen den Auftrag, bestimmte Gruppen der polnischen Führungsschicht festzunehmen und zu "liquidieren". Allerdings lassen sich solche Befehle dokumentarisch nicht belegen, weil bei diesen Aufträgen besonderer Wert auf Vertraulichkeit und Geheimhaltung gelegt wurde und die Befehle oft nur mündlich überliefert wurden. Sie lassen sich aber aus Aufzeichnungen des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, des SS-Gruppenführers Heydrich, vom 2.7.1940 erschliessen. In diesen Aufzeichnungen, die für Himmler bestimmt waren und durch Spannungen zwischen Wehrmacht und Sipo im besetzten Frankreich veranlasst waren, kam Heydrich auf die früheren Einsätze der Sipo bei der Besetzung Österreichs, des Sudetenlandes, Böhmens und Mährens und auch Polens zurück. Im Bezug auf den polnischen Einsatz führte er unter anderem aus, dass hier eine genaue Information der Wehrmacht nicht bestanden habe, weil die Weisungen für den polizeilichen Einsatz "ausserordentlich radikal" gewesen seien und zum Beispiel "Liquidierungsbefehle" für zahlreiche polnische Führungskreise, der in die Tausende gegangen sei, einbegriffen habe.
Aus einem Aktenvermerk des Chefs der militärischen Abwehr Admiral Canaris "über die Besprechung im Führerzug", die Canaris nach einer Unterredung mit dem Chef des OKW Generaloberst Keitel niederschreiben liess, ergibt sich ein Hinweis auf einen Befehl zur systematischen Erfassung und Tötung polnischer Führungskreise. In dem Aktenvermerk heisst es unter anderem:
"Ich machte Generaloberst Keitel darauf aufmerksam, dass ich davon Kenntnis habe, dass umfangreiche Füsilierungen in Polen geplant seien und dass insbesondere der Adel und die Geistlichkeit ausgerottet werden sollten. Für diese Methoden wird die Welt schliesslich doch auch die Wehrmacht verantwortlich machen .... Generaloberst Keitel erwiderte darauf, dass diese Sache bereits vom Führer entschieden sei, der dem Oberbefehlshaber des Heeres klar gemacht habe, dass, wenn die Wehrmacht hiermit nichts zu tun haben wolle, sie es auch hinnehmen müsse, dass SS und Gestapo neben ihr in Erscheinung träte ...."
Vor allem aber sprechen die tatsächlichen Aktionen der Einsatzgruppen im September/Oktober 1939 und spätere Aktionen für solche Befehle.
Der Einsatz der genannten Gruppen erstreckte sich nicht nur auf die üblichen staatspolizeilichen Fahndungen nach ganz bestimmten Personen. Sie gingen vielmehr pauschal und willkürlich gegen ganze Gruppen des Polen- und Judentums vor. Nur einige Fälle seien beispielhaft angeführt:
Im Armeebereich des AOK 14 verursachten Massenerschiessungen von Juden durch die Einsatzgruppen des SS-Oberführers Woyrsch Unruhe bei der Wehrmacht, worüber der 1c des AOK 14 einem Vertreter des Amtes Abwehr/OKW berichtete. Ferner liquidierte der aus Danziger SS-Leuten gebildete "Wachsturmbann Eimann" der mit Billigung Himmlers in den Kreisen Preussisch Stargard, Berent, u.a. eingesetzt wurde, zahlreiche Angehörige der polnischen Intelligenz an Ort und Stelle. Andere wurden verhaftet und in Lager verschleppt. In Westpreussen und im westlichen Teil Posens (ab 1.1.1940 Reichsgau Wartheland) war der Hauptschauplatz der Fahndung nach der polnischen Oberschicht. Von dem Klerus der Diözese Kulm Pelplin zum Beispiel wurde 2/3 verhaftet, der Rest floh. 214 der verhafteten Priester, vor allem das gesamte Domkapitel, wurden in den Monaten Oktober/November 1939 exekutiert. Polen, die dem polnischen Westmarkverein und anderen nationalen Verbänden angehörten, wurden automatisch als deutschfeindlich angesehen und "liquidiert".
Auch nach der Einverleibung der westlichen Gebiete Polens am 26.10.1939 in das deutsche Reich und der Gründung des Generalgouvernements am 1.1.1940, wodurch die Militärverwaltung beendet wurde und auf zivile Behörden überging, hörten die Verfolgungen der polnischen Führungsschicht und der sog. politisch unzuverlässigen Elemente nicht auf. Die Verhaftungen und Erschiessungen sowie Deportationen von Polen gingen weiter. Himmler setzte in den neuen Reichsgauen "Höhere SS- und Polizeiführer" ein, die ihm unmittelbar unterstanden und die allen in ihren Gebieten befindlichen SS- und Polizeieinheiten und Dienststellen Weisungen und Befehle erteilen konnten. Ihnen unterstanden die Inspekteure der Sicherheitspolizei unmittelbar. Aus den nach den Kampfhandlungen stationär gewordenen Einsatzgruppen bzw. Einsatzkommandos gingen die Leiter der Staatspolizeistellen und Staatspolizeistellen hervor, die nach dem Runderlass Himmlers vom 7.11.1939 bezgl. der Organisation der Gestapo in den Ostgebieten "politische Referenten der Reichsstatthalter und der Regierungspräsidenten" wurden.
Nach Aufhebung der Militärverwaltung hatten diese Dienststellen für die weiteren Verfolgungsmassnahmen freie Hand.
In welchem Umfang weiter Erschiessungsaktionen durchgeführt wurden, ist z.B. aus einem Bericht des Befehlshabers des Wehrkreiskommandos Posen, General Petzel, vom 31.11.1939 an den Chef des Ersatzheeres ersichtlich. Petzel berichtet u.a., dass SS-Formationen mit volkspolitischen Sonderaufträgen in alle möglichen Gebiete der Verwaltung eingriffen und damit den Aufbau im Gau Posen störten. Fast in allen grösseren Orten fänden öffentliche Erschiessungen statt, die Auswahl der zu erschiessenden Polen sei dabei oft unverständlich und die Art und Weise der Exekutionen vielfach unwürdig. In den Städten würden wahllos grosse Blocks geräumt und die Bewohner nachts auf LKWs verladen und evakuiert.
Das gleiche Thema behandelte der OB Ost General Blaskowitz in einer Denkschrift an Hitler, die er ihm durch das OKH zuleiten liess. Er brachte darin seine Besorgnis wegen illegaler Erschiessungen und Festnahmen von Polen zum Ausdruck und verwies auf die damit verbundenen Auswirkungen und Gefahren für die Disziplin der Truppe. Örtliche Absprache mit SD und Gestapo seien ohne Erfolg, weil diese sich auf Weisungen Himmlers beriefen. Er bat um Wiederherstellung gesetzmässiger Zustände, vor allem, dass Exekutionen nach rechtmässig gefällten Urteilen durchgeführt würden. Blaskowitz hatte jedoch bei Hitler keinen Erfolg. Er wurde im Mai 1940 abgelöst.
Kommandeure der Wehrmacht beschwerten sich ebenfalls über die verfahrenslosen Erschiessungen. Ihre Beschwerden wurden in Form einer Vortragsnotiz von den Stabsoffizieren des Oberost für Besprechungen bei dem Oberbefehlshaber des Heeres zusammengefasst. Es heisst darin u.a.:
"Es ist abwegig, einige Zehntausende Juden und Polen, so wie es augenblicklich geschieht, abzuschlachten. Damit wird angesichts der Masse der Bevölkerung weder die polnische Staatsidee totgeschlagen noch die Juden beseitigt. Im Gegenteil, die Art und Weise des Abschlachtens bringt grossen Schaden mit sich. ..... Was die ausländischen Sender bisher gebracht haben, ist nur ein winziger Bruchteil von dem, was in Wirklichkeit geschehen ist. ..... Wenn Amtspersonen der SS und Polizei Gewalttaten und Brutalität verlangen und sie in der Öffentlichkeit belobigen, dann regiert in kürzester Zeit nur noch der Gewalttätige ...."
Diese Vorstellungen und Beschwerden der Wehrmachtsstellen, zu denen auch private Briefe aus volksdeutschen Kreisen mit ähnlichen Beschwerden, auf die im einzelnen nicht eingegangen werden soll, kamen, änderten zwar an der grundsätzlichen Einstellung der SS-Führung nichts, sie führten aber dazu, dass ab Frühjahr und Sommer 1940 willkürliche Erschiessungen durch Spezialkommandos und Exekutionen aufgrund sog. pauschaler Standgerichtsurteile der SS- und Polizeistandgerichte in der Öffentlichkeit eingestellt wurden.
Sie wurden nun von der SS und Polizei in die neu im Osten eingerichteten Konzentrationslager verlegt, wo sie abgeschirmt von der Öffentlichkeit im geheimen stattfinden konnten. Auch Auschwitz diente zur "Liquidierung" von Polen. Es wurde Exekutionsstätte für Polen, die von Polizeiorganen festgenommen und ohne Verfahren nur aufgrund eines Exekutionsbefehls des RSHA oder aufgrund eines sog. Polizeistandgerichtsverfahrens und -standgerichtsurteils zur Tötung nach Auschwitz eingeliefert worden waren.
In der ersten Zeit fanden solche Erschiessungen in der sog. Kiesgrube in der Nähe des Stammlagers Auschwitz ausserhalb des Stacheldrahtes statt. Sie wurden noch mit einer gewissen Feierlichkeit durchgeführt. Ein Peloton, meist aus Freiwilligen des Wachsturmbannes gebildet, marschierte auf. Die Delinquenten wurden in Gruppen zum Erschiessen in der Kiesgrube vor einem Kugelfang aufgestellt. Vor der Erschiessung wurden ihnen Exekutionsbefehle oder Standgerichtsurteile vorgelesen. Dann gab der Führer des Erschiessungskommandos, in der Regel ein SS-Führer, den Feuerbefehl. Später wurden diese Exekutionen in den Hof zwischen Block 10 und 11 verlegt. Auch hier wurden zunächst die Exekutionen noch durch ein Peloton unter Führung eines SS-Führers durchgeführt. Den Delinquenten wurden die Exekutionsbefehle oder Standgerichtsurteile vor der Erschiessung vorgelesen. Sie wurden vor der bereits erwähnten "Schwarzen Wand" mit dem Gesicht zu dem Erschiessungskommando aufgestellt und dann auf Befehl des SS-Führers erschossen. Schon bald aber erschien dieses Verfahren zu umständlich. Von einem bestimmten Zeitpunkt ab, der sich nicht mehr genau feststellen liess, wurden die Erschiessungen nur noch durch Genickschüsse an der schwarzen Wand ohne Verlesung der Exekutionsbefehle oder Standgerichtsurteile durch den Rapportführer oder andere SS-Angehörige durchgeführt. In welchem Umfang polnische Staatsangehörige von ausserhalb zur "Liquidierung" in das Lager verbracht und dort erschossen worden sind, konnte nicht festgestellt werden. Auch konnte im einzelnen nicht geklärt werden, welche Polizeidienststellen Polen eingeliefert haben.
Von besonderer Bedeutung für das KL Auschwitz wurden die Standgerichtsverhandlungen der Gestapoleitstelle in Kattowitz. Das "Polizeistandgericht" in Kattowitz tagte in regelmässigen Abständen im KL Auschwitz, meist in einem Zimmer des Blockes 11. Vorsitzender des Gerichtes war der Leiter der Stapoleitstelle in Kattowitz, SS-Obersturmbannführer und Oberregierungsrat Dr. Mildner, später - ab Herbst 1943 - der Kommandeur der Sipo und des SD in Kattowitz, der Zeuge Dr. T. Als Beisitzer dieses Gerichtes fungierten ein Beamter der Kriminalpolizei und ein Beamter der Sicherheitspolizei. Verhandelt wurde gegen Zivilpersonen, die von der Gestapo in Kattowitz wegen angeblicher Widerstands-, Untergrund- und Partisanentätigkeit oder Abhörens feindlicher Sender, wegen Unterhaltungen über diese Nachrichten, wegen Kurierdiensten, wegen Schleichhandels oder anderer Vergehen festgenommen worden waren.
Meist wurde gegen grössere Gruppen verhandelt. Die Zivilisten wurden entweder zur Verhandlung aus den Polizeigefängnissen in Kattowitz oder dem Gerichtsgefängnis Myslowitz nach Auschwitz in das Lager gebracht, oder sie waren schon vorher, wenn die Polizeigefängnisse überfüllt waren, in das Lager gebracht und im ersten Stock des Blockes 11 als sogenannte "Polizeihäftlinge" untergebracht worden. In der Lagerstärke erschienen sie nicht. Zur Verhandlung, die in der Schreibstube des Blockes 11 stattfand, wurden die Polizeihäftlinge von einer Liste, die die Gruppe der Gestapo und des SD aus Kattowitz mitgebracht hatte, aufgerufen und vor dem Vernehmungszimmer aufgestellt. Dann wurden sie einzeln in den Verhandlungsraum hineingeführt. Die "Verhandlung" unter dem SS-Obersturmbannführer Dr. Mildner dauerte gegen die einzelnen Personen jeweils nur eine Minute oder weniger. Innerhalb von ein bis zwei Stunden wurden 100 bis 150, manchmal auch 200 Personen abgeurteilt. Von ganz geringen Ausnahmen abgesehen, lauteten die Urteile stets auf Todesstrafe. Die "Urteile" mussten von dem Gauleiter Bracht, der gleichzeitig Oberpräsident der Provinz Oberschlesien war, formell bestätigt werden. Häufig hatte er die Bestätigungen schon vor Verkündung der Urteile blanko erteilt.
Unmittelbar nach den Verhandlungen des Polizeigerichts wurden die zum Tode verurteilten Personen durch Genickschüsse an der schwarzen Wand anfänglich auch in einem Raum des kleinen (alten) Krematoriums durch Angehörige der SS aus dem Lager getötet. Bei den Erschiessungen waren die Mitglieder des Polizeistandgerichts aus Kattowitz in der Regel nicht mehr anwesend. Sie fuhren meist unmittelbar nach der Verhandlung weg.
Das Polizeistandgericht verhandelte bei seinen Sitzungen im KL Auschwitz auch gegen Schutzhäftlinge, die schon einige Zeit im Lager einsassen und glaubten, mit dem Leben davongekommen zu sein. Ein Angehöriger der Stapoleitstelle in Kattowitz brachte zu den Standgerichtsverhandlungen in Auschwitz häufig Listen von im Lager einsitzenden Schutzhäftlingen mit. Sie standen im Verdacht, mit den abzuurteilenden Zivilpersonen in Verbindung gestanden zu haben. Zu den Verhandlungen wurden sie dann von ihren Arbeitskommandos weggeholt und - mit den übrigen zivilen Angeklagten - zum Tode verurteilt und erschossen.
Die Anzahl der auf diese Weise von dem Polizeistandgericht zum Tode verurteilten und danach hingerichteten Personen konnte nicht festgestellt werden.
Ob im KL Auschwitz, insbesondere an der schwarzen Wand zwischen Block 10 und 11, auch Todesurteile von Sondergerichten der deutschen Justiz, die alsbald nach Ablösung der Militärverwaltung in den dem deutschen Reich eingegliederten polnischen Gebieten aufgebaut wurde, vollstreckt worden sind, konnte nicht geklärt werden. Es ist zwar unwahrscheinlich, konnte aber nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden.
2. Das KL Auschwitz als Exekutionsstätte für polnische Geiseln
Als es nach Abschluss der militärischen Kämpfe im September 1939 zur Bildung vereinzelter polnischer Widerstands- und Partisanengruppen kam, ordneten die Militärbefehlshaber Ende September 1939 an, dass in jedem Ort, in dem deutsche Soldaten stationiert waren, eine bestimmte Anzahl von Geiseln aus der polnischen Bevölkerung festzusetzen und täglich auszuwechseln sei. Bei Angriffen auf deutsche Soldaten und auf Volksdeutsche sollten diese Geiseln in einem bestimmten Verhältnis erschossen werden. Die Erschiessungsbefehle durften allerdings nur von den höheren Truppenkommandeuren (vom Divisionskommandeur aufwärts) erteilt werden.
Die Kommandos der Sicherheitspolizei und der SD beanspruchten von Anfang an eine eigene Befugnis zur Geiselfestsetzung. Sie machten davon unter Hinweis auf die notwendige Abschreckung einen weit extensiveren und viel weniger geregelten Gebrauch als die Wehrmacht. Dieses System der Geiselfestsetzung behielten die Polizeikommandos für die späteren Zeiten bei. Allerdings wurden Geiselerschiessungen ab Frühjahr und Frühsommer 1940 ebenso wie die Exekutionen von Angehörigen der Führungsschicht und sogenannten Staatsfeinden auf öffentlichen Plätzen und in den lokalen Gefängnissen allmählich eingestellt. Die Geiseln wurden in Konzentrationslager eingeliefert und dort bei Angriffen oder Aktionen von polnischen Widerstands- und Partisanengruppen erschossen.
Auch in das KL Auschwitz wurden solche Geiseln eingeliefert. Sie sassen oft längere Zeit im Lager und gingen, wie die anderen Häftlinge, auf Arbeitskommandos. Oft wussten sie selbst nicht, dass sie Geiseln waren. Auch der Lagerführung war dies nicht immer bekannt. Eines Tages kam plötzlich der Befehl des RSHA oder des Befehlshabers der Sipo, dass bestimmte Häftlinge als Geiseln zu erschiessen seien. Die Betreffenden wurden dann von ihren Arbeitskommandos geholt und in den Arrest eingeliefert. Von dort wurden sie dann zur Exekution geführt. In der ersten Zeit erfolgten diese - ebenso wie die oben bereits geschilderten Exekutionen - an der Kiesgrube durch ein Exekutionskommando. Später wurden die Geiseln an der schwarzen Wand durch Genickschüsse getötet. Konkrete Fälle von Geiselerschiessungen konnten nicht festgestellt werden, d.h. Namen von auf diese Weise Hingerichteten und Namen von SS-Angehörigen, die solche Geiselerschiessungen durchgeführt haben.
Ausser den Geiseln wurden auch andere polnische Staatsangehörige, die bereits als Schutzhaftgefangene im Lager einsassen, "liquidiert". Wiederholt kamen plötzlich Exekutionsbefehle vom RSHA - offenbar weil man inzwischen irgendwelche weiteren Feststellungen getroffen hatte - für bestimmte Schutzhäftlinge. Diese wurden dann ebenfalls von ihren Arbeitskommandos weggeholt und an der schwarzen Wand durch Genickschuss getötet.
Die politische Abteilung konnte ferner Anträge auf Exekution bestimmter Schutzhaftgefangener beim RSHA stellen. Dies geschah z.B. in Fällen missglückter Fluchtversuche nichtdeutscher Schutzhaftgefangener, bei dem Verdacht von Widerstands- oder Untergrundtätigkeit und anderer Vergehen im Sinne der SS. Das RSHA genehmigte dann meist fernschriftlich die Exekution der betreffenden Schutzhaftgefangenen. Auch sie wurden durch Genickschuss an der schwarzen Wand getötet. Darüber hinaus wurden viele Schutzhaftgefangene auch ohne Exekutionsbefehle des RSHA und ohne Standgerichtsurteile eigenmächtig von der politischen Abteilung und der Schutzhaftlagerführung getötet. Dies geschah vor allem dann, wenn der Arrestbunker im Block 11 überfüllt war. Die Einzelheiten über solche eigenmächtigen Tötungen nach sogenannten Bunkerentleerungen werden noch im Zusammenhang mit den Straftaten des Angeklagten Boger im einzelnen zu schildern sein.
3. Das KL Auschwitz als Exekutionsstätte für russische Kriegsgefangene
Als Hitler im Sommer 1940 einsah, dass er England nicht zur Anerkennung seiner politischen und militärischen Eroberungen in Europa zwingen könne und ein militärischer Sieg über England wegen seiner Insellage nicht möglich erschien, fasste er den Entschluss, die Sowjetunion zu überfallen, um sich für die Weiterführung des Kampfes gegen England die nötigen Rohstoffquellen zu erschliessen und sich durch die Vernichtung des Bolschewismus, den er als den ideologischen Feind Nr.1 ansah, den Rücken für die Auseinandersetzung mit England freizukämpfen. Mit dieser "Konsolidierung Europas", d.h., der Neuordnung des Kontinents im Geiste nationalsozialistischer Ideologie, wollte Hitler England zunächst indirekt treffen.
Für Hitler bedeutete der geplante Krieg gegen die Sowjetunion nicht nur einen Kampf mit Waffen, sondern es war für ihn eine Auseinandersetzung zweier Weltanschauungen, die nach seiner Meinung nur mit äusserster Härte, Brutalität und Gewalt geführt werden könne. So wie er vor dem polnischen Feldzug und nach der Zerschlagung des polnischen Staates zu einem harten und brutalen Volkstumskampf gegen das polnische Volk, der nicht nach Recht und Unrecht frage, aufgerufen hatte, so forderte er vor Beginn des Russlandfeldzuges einen rücksichtslosen Kampf gegen den Bolschewismus und die "jüdisch-bolschewistische Intelligenz" ohne Rücksicht auf Recht und Unrecht.
In einer fast zweieinhalbstündigen Ansprache vor den Generälen aller Wehrmachtteile am 30.3.1941 bezeichnete Hitler unter anderem den Bolschewismus als soziales Verbrechertum, der eine ungeheuere Gefahr für die Zukunft darstelle. Der Kampf gegen ihn sei ein Vernichtungskampf. Man müsse von dem Standpunkt des soldatischen Kameradentums abrücken, da der Kommunist weder vorher noch nachher Kamerad sei. Vor allem müssten die bolschewistischen Kommissare und die kommunistische Intelligenz als Träger der bolschewistischen Idee vernichtet werden. Das aber sei nicht eine Frage der Kriegsgerichte. Die Führer der Truppen müssten vielmehr wissen, worum es gehe. Sie hätten sich mit den Mitteln zu verteidigen, mit denen sie angegriffen würden. Kommissare und GPU-Leute seien Verbrecher und als solche zu behandeln.
Diese Einstellung Hitlers fand ihren Niederschlag in dem berüchtigten sogenannten Kommissarbefehl des OKW vom 6.6.1941, der "Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare" enthielt. In ihnen heisst es u.a., die Truppe müsse sich bewusst sein, dass in diesem Kampfe (gegen den Bolschewismus) Schonung und völkerrechtliche Rücksichtnahme gegenüber diesen Elementen (politischen Kommissaren aller Art) falsch sei. Sie seien eine Gefahr für die eigene Sicherheit und die schnelle Befriedung der eroberten Gebiete. Die Urheber barbarischer asiatischer Kampfmethoden seien die politischen Kommissare. Gegen sie müsse daher sofort und ohne weiteres mit aller Schärfe vorgegangen werden. Sie seien deshalb, wenn im Kampf oder Widerstand ergriffen, grundsätzlich mit der Waffe zu erledigen.
Im übrigen unterschieden die Richtlinien zwischen Truppenkommissaren und anderen politischen Kommissaren. Während die Truppenkommissare (politische Kommissare als Organe der feindlichen Truppen) im Operationsgebiet sofort, d.h. noch auf dem Gefechtsfeld abgesondert und nach durchgeführter Absonderung "erledigt" werden sollten (Ziff.I/2 der Richtlinien) unterschied das OKW bei allen anderen politischen Kommissaren zwischen solchen, die sich gegen die Truppe wenden würden - diese sollten ohne Einschaltung der Kriegsgerichte, deren Zuständigkeit für Straftaten feindlicher Zivilpersonen durch Erlass des Führers vom 13.5.1941 aufgehoben worden war, beseitigt werden - und denen, die sich keiner feindlichen Handlung schuldig gemacht hätten oder einer solchen verdächtig seien. Diese sollten zunächst unbehelligt bleiben.
Im rückwärtigen Heeresgebiet sollten die Kommissare, die wegen zweifelhaften Verhaltens ergriffen würden, an die Einsatzgruppen bzw. Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei abgegeben werden.
Der Oberbefehlshaber des Heeres, Generalfeldmarschall von Brauchitsch, erläuterte den OKW-Erlass am 8.6.1941 hinsichtlich der politischen Kommissare noch dahingehend, dass ein Vorgehen gegen diese zur Voraussetzung habe, dass der Betreffende eine besondere erkennbare Handlung oder Haltung gegen die deutsche Wehrmacht gezeigt habe. Bezüglich der Tötung der Truppenkommissare ordnete der OB des Heeres an: "Die Erledigung der politischen Kommissare bei der Truppe hat nach ihrer Absonderung ausserhalb der eigentlichen Kampfzone und unauffällig auf Befehl eines Offiziers zu erfolgen." Der General z.b.V. beim Oberbefehlshaber des Heeres, General Müller, interpretierte die Richtlinien des OKW am 11.6.1941 in Warschau vor einer Reihe von Generalstabsoffizieren u.a. wie folgt:
"In dem kommenden Einsatz müssten Rechtsempfinden unter allen Umständen hinter Kriegsnotwendigkeit zurücktreten. Es sei daher erforderlich, "zum alten Kriegsbrauch zurückzukehren!" Einer von beiden Feinden müsse auf der Strecke bleiben. Die Träger der feindlichen Einstellung dürften nicht konserviert, sondern müssten erledigt werden ...."
Inwieweit der Kommissarbefehl des OKW bei der Truppe befolgt und wie er in der Praxis gehandhabt worden ist, ist hier nicht zu untersuchen. Jedenfalls gelang es einer grossen Zahl von politischen Kommissaren - auch Truppenkommissaren - mit anderen russischen Kriegsgefangenen in die Kriegsgefangenenlager zu kommen. Um diese und auch andere "verdächtige Kriegsgefangene und Zivilpersonen" herauszufinden, wurden durch den Chef der Sipo und des SD im Einvernehmen mit dem OKW, Kommandos der Sicherheitspolizei und des SD, die der Reichsführer SS zur Verfügung stellte, in Stärke von einem SS-Führer und vier bis sechs SS-Männern in die Kriegsgefangenenlager abgestellt. Ihre Aufgaben wurden von Heydrich, dem Chef der Sipo und des SD, in einem Einsatzbefehl Nr.8 und den in diesem Befehl beigefügten "Richtlinien für die Aussonderung von Zivilpersonen und Kriegsgefangenen des Ostfeldzugs in den Kriegsgefangenenlagern im besetzten Gebiet, im Operationsgebiet, im Generalgouvernement und im Reichsgebiet" umrissen. Als Absicht stellte Heydrich heraus: Die Wehrmacht müsse sich umgehend von allen denjenigen Elementen unter den Kriegsgefangenen befreien, die als bolschewistische Triebkräfte anzusehen seien. Die besondere Lage des Ostfeldzuges verlange besondere Massnahmen, die frei von bürokratischen und verwaltungsmässigen Einflüssen verantwortungsfreudig durchgeführt werden müssten.
Politisch handele es sich darum, das deutsche Volk vor den bolschewistischen Hetzern zu beschützen und das besetzte Gebiet alsbald in die Hand zu nehmen.
Um das gesteckte Ziel zu erreichen, befahl Heydrich ein ganz bestimmtes Aussonderungsverfahren. Als erstes sollten die Lagerorgane die Kriegsgefangenen grob einteilen in Zivilpersonen, Soldaten, sowie nach Volkstumsgruppen innerhalb der Zivilpersonen und Soldaten. Danach sollten die Einsatzkommandos der Sipo und des SD aus den Zivilisten und Soldaten
1. politisch untragbare Elemente
2. Personen, die besonders vertrauenswürdig erschienen und für den Einsatz und Wiederaufbau der besetzten Gebiete verwendungsfähig seien,
aussondern.
Über die Weiterbehandlung der als "verdächtig" angesehenen Kriegsgefangenen hatte nach den Weisungen des Chefs der Sicherheitspolizei das Einsatzkommando selbständig zu entscheiden. Jede Woche hatte der Leiter des Einsatzkommandos durch Fernschreiben oder Schnellbrief an das RSHA einen Kurzbericht zu senden, der unter anderem die Zahl der endgültig als verdächtig anzusehenden Personen und die namentliche Benennung von Funktionären der Komintern, massgebende Funktionäre der Partei, Volkskommissare, politische Kommissare und leitende Persönlichkeiten zu enthalten hatte. Aufgrund dieser Tätigkeitsberichte wurden sodann vom RSHA die zu treffenden weiteren Massnahmen mitgeteilt.
In den Richtlinien hiess es weiter, dass Exekutionen nicht im Lager oder in der unmittelbaren Umgebung durchgeführt werden dürften. Über die durchgeführten Sonderbehandlungen (Exekutionen) hatten die Kommandos Listen zu führen. Hinsichtlich der durchzuführenden Exekutionen hatten sich die Leiter der Exekutionskommandos mit den Leitern der örtlich nächstgelegenen Stapoleitstelle bzw. den Kommandeuren der Sicherheitspolizei und des SD in Verbindung zu setzen. In einem Einsatzbefehl Nr.9 vom 21.7.1941 ordnete SS-Obergruppenführer Müller in Vertretung des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD u.a. an, dass die Exekutionen (der als endgültig verdächtig ausgesonderten Personen) nicht öffentlich sein dürften und unauffällig im nächstgelegenen Konzentrationslager durchgeführt werden müssten.
Auch im Konzentrationslager Auschwitz wurden aufgrund dieses Befehls die durch die Einsatzkommandos der Sipo und des SD aus Kriegsgefangenenlagern ausgesonderten politischen Kommissare und andere als verdächtig angesehene Kriegsgefangene "liquidiert". Die Gefangenen wurden, wenn sie in das Lager eingeliefert worden waren, nicht von der Aufnahmeabteilung der politischen Abteilung erfasst und auch nicht in die Lagerstärke aufgenommen. Sie brachten ihre Erkennungsmarken und Karteikarten mit. Nach den Exekutionen wurden die Erkennungsmarken in der Mitte durchgebrochen. Auf den Karteikarten wurde lediglich vermerkt: "liquidiert gemäss OKW-Befehl". Die Erschiessungen der Kriegsgefangenen erfolgten entweder im Vorraum des kleinen alten Krematoriums oder an der schwarzen Wand zwischen Block 10 und 11 durch Genickschüsse. Ein Teil der Kriegsgefangenen wurde auch im Block 11 und im kleinen Krematorium durch Gas getötet. Vereinzelt wurden politische Kommissare auch durch Phenolinjektionen umgebracht. Auf die Vergasung im Block 11, die Erschiessungen der Kriegsgefangenen und eine Tötung durch Phenol eines politischen Kommissars wird noch später zurückzukommen sein.
Ausser zur "Liquidierung" von diesen aus Kriegsgefangenenlagern ausgesonderten sogenannten politisch "untragbaren Elementen" und verdächtigen Personen diente das Konzentrationslager Auschwitz auch selbst als Kriegsgefangenenlager für russische Kriegsgefangene. Im Herbst 1941 wurden ca. 10-12000 Kriegsgefangene in das Lager eingeliefert. Sie waren in einem sehr schlechten körperlichen Zustande, sollten aber für Arbeiten eingesetzt werden. Auch diese Kriegsgefangenen wurden im Lager auf ihre politische Zuverlässigkeit überprüft. Politisch Verdächtige wurden von den übrigen Gefangenen abgesondert und in einem besonderen isolierten Block untergebracht. Tagsüber durften sie den Block nicht verlassen. Ihre Häftlingsnummer bekam den Zusatz "Au". Durch wen ihre Überprüfung erfolgt ist, wurde im einzelnen nicht aufgeklärt. Wahrscheinlich erfolgte sie ebenfalls durch ein besonderes Einsatzkommando der Stapoleitstelle Kattowitz. Die als endgültig verdächtig und politisch untragbar angesehenen Kriegsgefangenen wurden meist nachts exekutiert. SS-Angehörige kamen nachts überraschend in den isolierten Block und riefen die Nummern verschiedener Kriegsgefangener auf. Sie nahmen sie mit und erschossen sie später an der schwarzen Wand. Wieviel russische Kriegsgefangene aufgrund des OKW-Befehls und der auf ihm beruhenden Weisungen und Richtlinien des Chefs der Sipo und des SD im Konzentrationslager Auschwitz erschossen worden sind, bzw. durch Gas oder anderweitig getötet wurden, konnte nicht geklärt werden.
4. Das Konzentrationslager Auschwitz als Vernichtungsstätte kranker und entkräfteter Lagerinsassen
Im KL Auschwitz wurden in grossem Umfang auch im Lager befindliche kranke Häftlinge, insbesondere Juden, die man als arbeitsunfähig ansah, getötet.
a. Im HKB wurden fast täglich von den Häftlingen, die sich krank gemeldet hatten und dem Lagerarzt nach einer Untersuchung durch einen Häftlingsarzt vorgestellt wurden (sogenannter Arztvorsteller) diejenigen ausgesondert, die der Lagerarzt als arbeitsunfähig ansah. Anschliessend wurden sie durch Phenolinjektionen getötet. Die Anzahl der auf diese Weise getöteten Häftlinge konnte nicht festgestellt werden. Es waren auf jeden Fall mehrere Tausend. Nähere Einzelheiten über das Aussonderungsverfahren und die Art der Tötung werden noch im Zusammenhang mit den Straftaten der SDGs Klehr, Scherpe, Hantl) zu erörtern sein.
b. Der Lagerarzt ging ferner von Zeit zu Zeit in Begleitung eines SDG durch die Krankensäle des HKB, um neben der Überprüfung der Ordnung und Sauberkeit festzustellen, ob der HKB überfüllt sei. War dies der Fall, dann sonderte er eine Reihe von Häftlingen aus, die anschliessend ebenfalls durch Phenolinjektionen getötet wurden. Besonders gefährdet waren die Häftlinge, die schon längere Zeit krank im HKB lagen. Die Anzahl der durch diese sogenannten kleinen Selektionen ausgesuchten und anschliessend durch Phenol getöteten Häftlinge konnte ebenfalls nicht festgestellt werden. Auch auf diese kleinen Selektionen wird noch zurückzukommen sein.
c. Ausser diesen kleinen Selektionen fanden in gewissen Zeitabständen sogenannte grosse Selektionen im HKB statt. Bei diesen grossen Selektionen mussten alle kranken Häftlinge, die im HKB lagen, dem Lagerarzt nackt vorgeführt werden. Durch einen Blick entschied dann der Lagerarzt, ob ein Kranker weiter im HKB bleiben könne oder ob er zu töten sei. Häufig wurden bei solchen grossen Selektionen 200 bis 300 Häftlinge zur Tötung bestimmt. Ihre Fieberkurven wurden auf die Schreibstube gebracht, wo eine Liste mit den Nummern der für den Tod bestimmten Häftlinge erstellt wurde. Ein oder zwei Tage später wurden die ausgesuchten Häftlinge dann aufgerufen, auf LKWs verladen und in die Gaskammern gebracht, wo sie durch Zyklon B getötet wurden. Die Anzahl der auf diese Weise getöteten Häftlinge konnte ebenfalls nicht mehr festgestellt werden.
d. Schliesslich fanden von Zeit zu Zeit sogenannte Lagerselektionen statt. Hierbei wurden die Lagerinsassen - mit Ausnahme der Funktionshäftlinge und anderer Häftlinge, die für besondere Tätigkeiten gebraucht wurden - auf ihre Arbeitstauglichkeit gemustert. Solche sogenannte Lagerselektionen fanden sowohl im Stammlager als auch in den verschiedenen Lagerabschnitten des Lagers in Birkenau statt. Die Häftlinge mussten bei diesen Selektionen nackt antreten. Ihre Arbeitstauglichkeit wurde von den SS-Lagerärzten mit einem Blick geprüft. Wer nicht mehr arbeitsfähig erschien - dazu gehörten vor allem die sogenannten Muselmänner -, wurde von den anderen Häftlingen abgesondert und in einen bestimmten Block von anderen Häftlingen isoliert untergebracht. Nach wenigen Tagen wurden dann die ausgesonderten Menschen mit LKWs zu den Gaskammern gebracht und dort durch Gas getötet. Als Todesursache wurde auf den Todesurkunden aller auf diese Weise getöteten Häftlinge natürliche Todesursachen angegeben (z.B. Herzschwäche).
Ob und inwieweit diese Ausmusterungen aufgrund von Befehlen des RSHA oder des WVHA erfolgt sind, konnte nicht geklärt werden. Wahrscheinlich beruhen sie auf der bereits erwähnten Aktion, die unter dem Geheimzeichen 14 f 13 in den Konzentrationslagern lief. Das Schwurgericht ist zugunsten der Angeklagten davon ausgegangen, dass die SS-Ärzte von höheren Dienststellen (wahrscheinlich dem Amt D III im WVHA) die allgemeine Anweisung erhalten haben, kranke und völlig entkräftete Häftlinge, mit deren Arbeitseinsatz nicht mehr zu rechnen sei, auszumustern und auf unauffällige Weise töten zu lassen. Ausser durch die Ärzte wurden solche Ausmusterungen aber auch durch SS-Führer, Unterführer und die SDGs zum Teil ohne Befehl eigenmächtig durchgeführt. Auf konkrete Einzelfälle wird noch im Zusammenhang mit den Erörterungen der Straftaten der Angeklagten zurückzukommen sein.
5. Das KL Auschwitz als Massenvernichtungsanstalt für die Tötung jüdischer Menschen
Das KL Auschwitz diente schliesslich im Rahmen der sogenannten "Endlösung der Judenfrage" als Instrument zur Vernichtung von unzähligen jüdischen Menschen, die nur zum Zweck der Tötung nach Auschwitz verbracht wurden.
Den Hintergrund für diese Massentötungen bildete die radikale antisemitische Politik des NS-Staates, die ebenfalls ein untrennbarer Bestandteil nationalsozialistischer Programmatik war und schliesslich, sich von Stufe zu Stufe steigernd, in der physischen Vernichtung der Juden endete.
Ausgangspunkt für die gesamte Judenpolitik des NS-Staates war das Parteiprogramm der NSDAP vom 24.2.1920, in dessen Punkt 4 es hiess:
"Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist ohne Rücksicht auf die Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein."
Punkt 5 des Parteiprogrammes lautete: "Wer nicht Staatsbürger ist, soll nur als Gast in Deutschland leben können und muss unter Fremdengesetzgebung stehen."
Schon vor der sogenannten Machtergreifung am 30.1.1933 rief Hitler in vielen Parteireden zum leidenschaftlichen Kampf gegen das "Weltjudentum" auf. Seine Partei (die NSDAP) und ihre Gliederungen (SA, SS usw.) hetzten systematisch gegen jüdische Bürger. Gelegentlich kam es auch schon vor der Machtergreifung zu Ausschreitungen gegen Juden.
Nach der Übernahme der Macht wurde der Kampf der nationalsozialistischen Partei gegen die Juden Teil der offiziellen Regierungspolitik in Deutschland. Zahlreiche Gesetze, Verordnungen und Einzelmassnahmen dienten der Entrechtung, Diskriminierung und Verfolgung der jüdischen Bürger. Eine systematische Hetze sollte Hass und Abscheu gegen die Juden in jedem nichtjüdischen Deutschen hervorrufen. Hier sollen die zahlreichen Gesetze, Verordnungen und Einzelmassnahmen, durch die die deutschen Juden aus dem staatlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben ausgeschaltet, von sämtlichen Ehrenämtern ausgeschlossen und aus freien Berufen verdrängt und insgesamt in beschämender Weise entwürdigt, entrechtet und diskriminiert werden sollten und wurden, im einzelnen nicht aufgezählt werden. Sie sind historisch und im grossen und ganzen allgemein bekannt. Erwähnt seien nur die sogenannten Nürnberger Gesetze aus dem Jahre 1935 (das sog. Blutschutzgesetz und das Reichsbürgergesetz), die einen gewissen Höhepunkt der gesetzlichen Massnahmen zur Entrechtung und Diffamierung der jüdischen deutschen Mitbürger bildeten. Das Blutschutzgesetz (RGBl. 1935 I, 1146) verbot die Eheschliessung zwischen Juden und "Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes", sowie den ausserehelichen Geschlechtsverkehr zwischen Juden und diesen Personengruppen. Juden durften keine weiblichen Angestellten "deutschen oder artverwandten Blutes" unter 45 Jahren in ihrem Haushalt beschäftigen.
Das Reichsbürgergesetz führte neben der Staatsangehörigkeit die sogenannte Reichsbürgerschaft ein, die durch Verleihung des Reichsbürgerbriefes erworben werden sollte (wozu es allerdings niemals gekommen ist). Reichsbürger konnten nur Staatsangehörige "deutschen oder artverwandten Blutes" werden. Nur Reichsbürger sollten in den Genuss der vollen politischen Rechte nach Massgabe des Gesetzes kommen.
Eine weitere Diffamierung bedeutete u.a. die Einführung des Kennkartenzwanges für jüdische Bürger durch die Bekanntmachung vom 23.7.1938 und die durch die VO vom 17.8.1938 erlassenen Vorschriften, dass männliche Juden ab 1.1.1939 ihrem nichtjüdischen Vornamen den Vornamen "Israel" und weibliche Juden den Vornamen "Sara" beizufügen hatten.
Verschärft wurde die Judenverfolgung in Deutschland, nachdem der Juden Herschel Grünspan den deutschen Legationssekretär vom Rath in Paris erschossen hatte. In der Nacht vom 8. zum 9.11.1938 kam es zu der bekannten sogenannten "Reichskristallnacht", in der im deutschen Reichsgebiet Synagogen in Brand gesteckt, über 7000 jüdische Geschäfte zerstört und viele jüdische Menschen verletzt, getötet oder verhaftet wurden. Gegen diesen von Dienststellen der Partei und ihrer Gliederungen organisierten Terror schritten die zuständigen Polizeibehörden auf höhere Weisung nicht ein. Den Juden in Deutschland wurde zusätzlich noch die Zahlung einer "Busse" von zunächst 1 Milliarde später 1 1/4 Milliarde Reichsmark auferlegt. Ca. 30000 wohlhabende jüdische Bürger wurden in Konzentrationslager eingewiesen, später allerdings zum grössten Teil wieder entlassen, wenn sie sich zur Auswanderung bereit erklärten.
Nach Beginn des zweiten Weltkrieges wurden die Juden dadurch diskriminiert, dass sie ihre Rundfunkgeräte abliefern mussten, dass man sie zur Kündigung ihrer Fernsprechanschlüsse zwang und dass sie keine Kleiderkarten erhielten und schliesslich, dass man Ausgehverbote gegen sie erliess.
Der erwähnten Gesetze, Verordnungen und administrativen Massnahmen gegen die Juden sowie die Gewalttaten gegen sie zielten zunächst daraufhin, die deutschen Juden möglichst rasch zur Auswanderung zu bringen und damit den "deutschen Volkskörper" von dieser - nach Auffassung der NS-Machthaber - "minderwertigen Rasse" zu reinigen. Nach Ausbruch des Krieges am 1.9.1939 fielen weitgehend die Voraussetzungen für eine Auswanderung bzw. Austreibung der deutschen Juden weg, wenn auch der Weg über neutrale Staaten zunächst noch offenblieb. Man strebte daher bald eine radikalere Lösung des Judenproblems an. Erste Anzeichen einer solchen radikalen Lösung für den Fall eines bewaffneten Konfliktes hatte es schon vor dem Kriege gegeben. So hatte Göring schon in einer Konferenz vom 12.11.1938, bei der Heydrich noch ein grosses Auswanderungsprogramm für die Juden entworfen hatte, erklärt: "Wenn das deutsche Reich in irgendeiner absehbaren Zeit in aussenpolitischen Konflikt kommt, so ist es selbstverständlich, dass auch wir in Deutschland in allererster Linie daran denken werden, eine grosse Abrechnung an den Juden zu vollziehen."
Hitler hatte am 30.1.1939 anlässlich der Feier des Tages der sogenannten Machtübernahme vor dem Reichstag unter anderem erklärt:
"Und eines möchte ich an diesem vielleicht nicht nur für uns Deutsche denkwürdigen Tag nun aussprechen: Ich bin in meinem Leben sehr oft Prophet gewesen und wurde meistens ausgelacht. In der Zeit meines Kampfes um die Macht war es in erster Linie das jüdische Volk, das nur mit Gelächter meine Prophezeiungen hinnahm, ich würde einmal in Deutschland die Führung des Staates und damit des ganzen Volkes übernehmen und dann unter vielen anderen auch das jüdische Problem zur Lösung bringen. Ich glaube, dass dieses damalige schallende Gelächter dem Judentum in Deutschland unterdes wohl schon in der Kehle erstickt ist. Ich will heute wieder ein Prophet sein: Wenn es dem internationalen Finanzjudentum innerhalb und ausserhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa."
Spätestens im Jahre 1941 entschloss sich Hitler zu der in der erwähnten Rede angedeuteten Lösung, nämlich, die in seinem Machtbereich lebenden europäischen Juden auszurotten. Mit der Verwirklichung dieses Planes, den er "die Endlösung der Judenfrage" nannte, beauftragte er Himmler, seinen getreuen Gefolgsmann, der mit der ihm unterstellten Polizei und SS die Gewähr einer genauen Durchführung des Planes bot. Allerdings ist ein schriftlicher Befehl Hitlers über die "Endlösung der Judenfrage" nicht bekannt. Der genaue Zeitpunkt, wann Hitler die physische Vernichtung der Juden befohlen hat, lässt sich nicht mehr genau bestimmen. Hitler muss sie schon vor Ausbruch des Krieges mit Russland mündlich angeordnet haben. Denn die vor Beginn des Russlandfeldzuges entsprechend der Einteilung der Heeresgruppen gebildeten Einsatzgruppen aus Sipo und SD hatten den Auftrag die sogenannten potentiellen Gegner zu vernichten, also zu töten, wobei man sich darüber im klaren war, dass dazu in erster Linie - ausser den politischen Kommissaren - die im rückwärtigen Heeresgebiet anzutreffenden Juden gehörten. Den Führern der Einsatzgruppen, die in Einsatzkommandos und Sonderkommandos gegliedert waren, wurde im Mai 1941 unter strengster Geheimhaltung mündlich befohlen, die Juden zu erschiessen. Nach Einmarsch der deutschen Truppen in das Gebiet der Sowjetunion begannen auch bald im rückwärtigen Heeresgebiet in grossem Umfang Massenerschiessungen von Juden durch die Einsatzkommandos. Schliesslich stellte man diesen Kommandos auch Gaswagen zur Verfügung, in denen die Juden durch Gas getötet wurden. Alle Juden konnten jedoch in dieser ersten Phase der Massentötung nicht beseitigt werden. Die Überlebenden wurden in grosse Ghettos konzentriert und durch einen gelben Judenstern auf Brust und Rücken gekennzeichnet. Bald folgte eine zweite Phase von Massentötungen und eine allmähliche Räumung der Ghettos.
Inzwischen hatten im Reichsgebiet seit Herbst 1941 grosse als "Umsiedlungsaktion" getarnte Deportationen von Juden zu den Ghettos in Lodz, Warschau, Kowno, Minsk, Riga usw. begonnen. Ziel dieser Deportationen war die schliessliche Vernichtung der deportierten Menschen durch Arbeit oder in dafür einzurichtenden Vernichtungslagern oder Vernichtungsanstalten. Hier soll nicht im einzelnen die organisatorische Durchführung der gesamten Aktion im Rahmen der sogenannten "Endlösung der Judenfrage", die verschiedenen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten aufgezeigt werden. Es war nicht Aufgabe des Schwurgerichts, dies im einzelnen aufzuklären und aufzuzeigen. Erwähnt sei nur, dass Göring durch Erlass vom 31.7.1941 Heydrich aufforderte, ihm alsbald die sachlichen und materiellen Voraussetzungen zur angestrebten "Endlösung der Judenfrage" vorzulegen. Auch das spricht dafür, dass Hitler schon vor diesem Zeitpunkt den Befehl für die physische Vernichtung der Juden gegeben hat.
In diesem Erlass heisst es u.a.:
"In Ergänzung der Ihnen bereits mit Erlass vom 24.1.1939 übertragenen Aufgabe, die Judenfrage in Form der Auswanderung oder Evakuierung einer den Zeitverhältnissen entsprechend möglichst günstigen Lösung zuzuführen, beauftrage ich Sie hiermit, alle erforderlichen Vorbereitungen in organisatorischer, sachlicher und materieller Hinsicht zu treffen für eine Gesamtlösung der Judenfrage im deutschen Einflussgebiet in Europa.
Sofern hierbei die Zuständigkeiten anderer Zentralinstanzen berührt werden, sind diese zu beteiligen.
Ich beauftrage Sie weiter, mir in Bälde einen Gesamtentwurf über die organisatorischen, sachlichen und materiellen Vorausmassnahmen zur Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage vorzulegen."
Heydrich berief unter Bezugnahme auf diesen Erlass eine Konferenz am 20.1.1942 im Gebäude der Interpol am grossen Wannsee ein, zu der die zuständigen Behörden zu einer "Staatssekretärbesprechung" geladen wurden.
Die Konferenz (Wannsee-Konferenz genannt) wird allgemein als die organisatorische Grundlage für die sogenannte "Endlösung der Judenfrage" bezeichnet. An ihr nahmen hohe Vertreter der Parteikanzlei, der Reichskanzlei, des Amtes Frank, die Staatssekretäre der einzelnen Ministerien, insbesondere aber Angehörige des RSHA teil. Heydrich, der den Vorsitz führte, betonte zunächst, dass die Federführung bei der Bearbeitung "der Endlösung der Judenfrage" ohne Rücksicht auf geographische Grenzen zentral beim Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei liege. Dann erklärte er u.a., dass die Juden nach ihrer Evakuierung nach dem Osten einem harten Arbeitseinsatz zugeführt werden müssten, wobei zweifellos ein grosser Teil durch natürliche Auslese ausfallen werde. Schliesslich erklärte er: "Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaues anzusprechen ist (siehe die Erfahrung der Geschichte)."
Was mit den Arbeitsunfähigen geschehen solle, wurde in dem Protokoll über diese Konferenz nicht festgehalten. Hier ist auf die Worte "wird entsprechend behandelt werden müssen" hinzuweisen, weil bei den späteren schriftlichen Befehlen, sonstigen Berichten und Schriftstücken, die in Zusammenhang mit der massenweisen Vernichtung der Juden standen, niemals ausdrücklich von einer Tötung die Rede ist. Die Tötungen wurden vielmehr stets mit Worten umschrieben wie "Sonderbehandlung", "Evakuierung", "Judenumsiedlung" und ähnlichen Ausdrücken. Alle Aktionen wurden unter Einhaltung strengster Geheimhaltungsvorschriften durchgeführt. Niemand, der nicht unmittelbar damit befasst war, durfte etwas davon erfahren.
Auf den weiteren Inhalt der Beratungen während der Wannsee-Konferenz soll hier nicht näher eingegangen werden. Das Ergebnis der Konferenz zeigte sich bald: Die bereits begonnenen Deportationen wurden in verstärktem Umfang fortgesetzt. In allen vom deutschen Reich besetzten Ländern Europas wurden Juden zusammengetrieben, in Eisenbahnzüge gepfercht, zum grossen Teil in Güterwaggons, und in Lager nach dem Osten deportiert, wo sie zum grössten Teil getötet wurden. Die in den Ghettos im Osten konzentrierten Juden wurden nach und nach ebenfalls in Vernichtungslager abtransportiert und zum grössten Teil getötet.
Die Zentrale für die Aktion war das RSHA unter Heydrich, später Kaltenbrunner. Im RSHA war das Amt IV unter SS-Obergruppenführer Müller für die Judendeportationen zuständig. Es bediente sich bei der Durchführung der Aktionen er ihm unterstellten Polizei- und SS-Dienststellen. Im Amt IV war Leiter des Referates IV B 4 (Judenangelegenheiten), das später in IV A 4 umbenannt wurde, SS-Obersturmbannführer Eichmann.
Auch das Konzentrationslager Auschwitz wurde als Vernichtungslager für die "Endlösung der Judenfrage" ausersehen. Höss, der erste Lagerkommandant von Auschwitz, erhielt - wie oben schon erwähnt - im Sommer 1941 vom RFSS den Befehl, im KL Auschwitz, die Voraussetzungen für die Massentötungen von Juden zu schaffen. Dabei wurde ihm strengstes Stillschweigen auch Vorgesetzten gegenüber befohlen. Von Eichmann wurde Höss näher in die beabsichtigten Vernichtungsaktionen eingeweiht. Mit ihm besprach er, wie die Tötung der Juden im Lager Auschwitz durchzuführen sei. Beide kamen überein, dass als Tötungsmittel nur Gas in Frage käme, da die Tötung der zu erwartenden Menschenmassen auf andere Weise nicht ausführbar erschien. Bei einer Besichtigung des Geländes stiessen sie auf ein Bauerngehöft in der Nordwestecke des späteren Bauabschnittes B III. Da es durch Wald und Hecken gegen Einsicht geschützt war, hielten sie er für geeignet, um darin - nach entsprechenden Umbauten und der Installierung der erforderlichen technischen Einrichtungen - gleichzeitig mehrere hundert Menschen durch Gas zu töten. Der Umbau des Gehöftes für den vorgesehenen Zweck wurde alsbald in Angriff genommen.
Wann genau die ersten Judentransporte im Rahmen der sogenannten "Endlösung der Judenfrage" in Auschwitz angekommen sind, liess sich nicht mehr mit Sicherheit feststellen. Im damaligen Sprachgebrauch wurden diese Transporte RSHA-Transporte genannt. Die deportierten Juden, die mit diesen Transporten ankamen, nannte man RSHA-Juden. Anfangs - ab Oktober 1941 - wurden vereinzelt kleinere Gruppen von Juden, die im Rahmen des Vernichtungsprogramms Hitlers in Auschwitz getötet werden sollten, in LKWs gebracht. Sie wurden im kleinen (alten) Krematorium teils durch Genickschüsse getötet, teils durch Gas umgebracht. Hierauf wird noch bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten St. zurückzukommen sein. Ab Anfang 1942 kamen grössere RSHA-Transporte aus Ostoberschlesien an, denen dann fast ununterbrochen bis Herbst 1944 eine nicht mehr festzustellende Zahl von Transporten aus allen besetzten Ländern Europas folgte.
Grössere Transporte, die mit Ausnahme der Anfangszeit die Regel wurden, kamen in Eisenbahnzügen an. Die Züge wurden auf einem Anschlussgleis, das man vor der Hauptstrecke Kattowitz - Auschwitz - Krakau auf das freie Feld in die Nähe des Stammlagers geführt hatte, geleitet. Dort liess man die Menschen auf eine eigens für diesen Zweck gebaute 500 m lange Holzrampe, die im Jahre 1943 durch eine Betonrampe ersetzt wurde, aussteigen.
Ursprünglich sollten nach dem Befehl Himmlers alle mit sogenannten RSHA-Transporten angekommenen Menschen getötet werden. Dies geschah auch bei den ersten Transporten aus Ostoberschlesien. Bald aber erging ein weiterer Befehl, dass alle arbeitsfähigen Juden, Männer und Frauen, aus den Transporten auszusuchen und im Lager für Rüstungszwecke einzusetzen seien. In der Folgezeit wurden dann jeweils aus den RSHA-Transporten zwischen 10 und 15%, in seltenen Ausnahmefällen auch mehr, jedoch nie über 25% arbeitsfähiger Männer und Frauen aus den Transporten ausgesucht, die dann in das Lager aufgenommen wurden. Alle anderen jüdischen Menschen wurden durch Gas getötet. Bevor der Umbau des Bauernhauses vollendet war, erfolgten die Tötungen durch Gas im kleinen Krematorium. Ab Sommer 1942 diente das inzwischen in eine Gaskammer umgebaute Bauernhaus als Vernichtungsstätte. Da seine Kapazität zur Tötung der immer dichter werdenden Transporte nicht ausreichte, wurde noch ein weiteres Bauernhaus in der Nähe des ersten zu einer Gaskammer umgebaut und zusätzlich als Vernichtungsstätte benutzt. Beide Gaskammern wurden auch Bunker I und II genannt. Die Leichen der getöteten Menschen wurden zunächst in grossen Gruben begraben, später in langen Gräbern verbrannt.
Da bald vorauszusehen war, dass die Kapazität der beiden Gaskammern für die Tötung der noch zu erwartenden Judentransporte nicht ausreichen werde, wurde der Bau von zwei grossen und zwei etwas kleineren Krematorien mit dazugehörigen Gaskammern in Angriff genommen. Wie oben schon ausgeführt, wurden die grösseren Krematorien (Krematorium I und Krematorium II), die westlich vom Lagerabschnitt B I und B II lagen, im Frühjahr 1943 in Betrieb genommen. Die beiden kleineren Krematorien (Krematorium III und Krematorium IV) wurden ebenfalls im Jahre 1943 vollendet und in Betrieb genommen.
Der Bunker I wurde später bei Beginn des Aufbaues des Lagerabschnitts B III abgerissen, der Bunker II, der nach der Inbetriebnahme der vier neu erbauten Krematorien auch später noch zur Tötung von Menschen benutzt wurde, wenn die Kapazität der vier Krematorien nicht ausreichte oder eine der vier neu gebauten Gaskammern aus irgendeinem Grund ausfiel, wurde nun als Bunker V bezeichnet.
Ab Frühjahr 1944 wurden die Transporte auf die - oben bereits erwähnte - Rampe in Birkenau geleitet, von wo die Menschen unmittelbar nach der Ausmusterung der Arbeitsfähigen in die neu erbauten Gaskammern geführt wurden.
Eine genaue Darstellung über die Empfangnahme, Einteilung und Vernichtung eines RSHA-Transportes, die Ausmusterung der Arbeitsfähigen, die auch als "Selektion" bezeichnet wird, wobei nicht sicher feststeht, ob dieser Ausdruck bereits damals gebraucht worden ist oder man ihn erst später eingeführt hat, wird im Zusammenhang mit der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Mulka gegeben werden.
Die Anzahl der getöteten jüdischen Menschen, die mit sogenannten RSHA-Transporten nach Auschwitz deportiert worden sind, konnte auch nicht annähernd festgestellt werden, da sichere Beweisunterlagen fehlen.
Allein im Jahre 1944, als in grossem Umfang ungarische Juden nach Auschwitz deportiert und mit Ausnahme der als arbeitsfähig Ausgemusterten getötet worden sind, wurden in den Monaten zwischen Mai und Oktober mehr als eine halbe Million jüdischer Menschen getötet.
Zwischenstück:
Beweismittel und Beweisgrundlagen für die im ersten und zweiten Abschnitt getroffenen Feststellungen
1. Die Feststellungen über die Einrichtung und Entwicklung von Konzentrationslagern im NS-Staat beruhen auf den ausführlichen und sachkundigen Gutachten der Sachverständigen Dr. Broszat über "die Entwicklung der nationalsozialistischen Konzentrationslager", Dr. Buchheim über "SS und Polizei im NS-Staat" und den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen aus der damaligen Zeit, die in Gesetz- und Verordnungsblättern veröffentlicht worden sind. Das Gericht hat sich den beiden überzeugenden und fundierten Sachverständigengutachten angeschlossen.
2. Die Feststellungen im zweiten Abschnitt hat das Gericht getroffen auf Grund der Einlassungen der Angeklagten, soweit ihnen gefolgt werden konnte, den glaubhaften Aussagen der Zeugen bzw. der Zeuginnen Dr. F., Fr., Bö., Erich K., Dow K., H., Hu., Kr., Ko., Ka., Kl., Kag., La., Lei., Dr. Li., Dr. M., de Ma., Dr. Mo., Mi., O., P., Pi., R., Po., Scha., So., Dr. T., W., Wa., Wö., Dr. C., Dr. D., Helmut Ba., Dr. Wo. und weiterer Zeugen, die noch bei der Beweiswürdigung im Rahmen der Erörterung der Straftaten der einzelnen Angeklagten anzuführen sein werden, den Skizzen vom Stammlager und vom Lager Birkenau, die in der Hauptverhandlung in Augenschein genommen wurden und deren Übereinstimmung mit den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten in der hier fraglichen Zeit von den Angeklagten bestätigt worden ist, den Gutachten der Sachverständigen Dr. Broszat über "die Entwicklung der nationalsozialistischen Konzentrationslager", Dr. Buchheim über "SS und Polizei im NS-Staat", Dr. Krausnick über "Judenpolitik und Judenverfolgung 1933 bis 1945", Dr. Broszat über "Nationalsozialistische Polenpolitik", Dr. Jakobsen über den "Kommissarbefehl", deren überzeugenden und fundierten Darlegungen sich das Gericht in vollem Umfang angeschlossen hat, und auf Aufzeichnungen, die der erste Lagerkommandant des KL Auschwitz, der frühere und inzwischen hingerichtete SS-Obersturmbannführer Höss während seiner Krakauer Untersuchungshaft im Jahre 1946 handschriftlich niedergeschrieben hat, als er auf seine Aburteilung durch den polnischen Obersten Gerichtshof wartete. Dem Schwurgericht lag allerdings das Original der handschriftlichen Aufzeichnungen nicht vor. Fotokopien der handschriftlichen Aufzeichnungen besitzt das Institut für Zeitgeschichte in München. Der Sachverständige Dr. Broszat hat glaubhaft versichert, dass er sich persönlich in Polen davon überzeugt habe, dass die Fotokopien mit den handschriftlichen Originalen übereinstimmen. An der Urheberschaft des Lagerkommandanten Höss könne nach dem klaren handschriftlichen Befund kein Zweifel bestehen, zumal ein handschriftlicher Vergleich mit von Höss handschriftlich geschriebenen Zeugnissen aus früheren Zeiten möglich gewesen sei. Broszat hat die autobiographischen Aufzeichnungen und die handschriftliche Niederschrift über "Die Endlösung der Judenfrage" in dem Taschenbuch "Kommandant in Auschwitz, autobiographische Aufzeichnung" ungekürzt getreu nach den ihm vorliegenden Fotokopien veröffentlicht. In der Hauptverhandlung sind die in dem Buch abgedruckten autobiographischen Aufzeichnungen zum Teil und die Aufzeichnung über "Die Endlösung der Judenfrage" verlesen worden. Das Schwurgericht ist der Überzeugung, dass die aus dem Buch verlesenen Teile mit dem Original der handschriftlichen Aufzeichnungen des früheren Lagerkommandanten Höss wörtlich übereinstimmen. Das Gericht hat diese Überzeugung nicht nur aus der glaubhaften Versicherung des Sachverständigen Broszat gewonnen, sondern auch aus dem Inhalt der verlesenen Schriften selbst. Daraus ergibt sich nämlich, dass Urheber der Aufzeichnungen eine mit den Verhältnissen in Auschwitz wohl vertraute Person sein muss, die nicht nur einen Teilbereich des Lagers überschauen konnte, sondern einen Gesamtüberblick gehabt haben muss. Die Schilderung der allgemeinen Verhältnisse und die Darstellung über die Abwicklung eines RSHA-Transportes ist auch in vielen Punkten durch die Angeklagten und die oben genannten Zeugen bestätigt worden.
Von den Angeklagten und ihren Verteidigern ist die Übereinstimmung der verlesenen Schriften mit den handschriftlichen Originalen des früheren Lagerkommandanten Höss auch ernstlich nicht bestritten worden.
Das Gericht ist auch überzeugt, dass Höss in den Niederschriften die allgemeinen Dinge über die Gründung des Konzentrationslagers Auschwitz, die dortigen Verhältnisse, die Errichtung und Einrichtung der Krematorien und die Tatsachen über die Vernichtung der RSHA-Transporte richtig dargestellt hat. Seine Angaben sind insoweit glaubhaft. Denn aus dem verlesenen Inhalt der Aufzeichnungen ergibt sich, dass Höss sich mit grossem Eifer um Exaktheit und Sachlichkeit bemüht hat. Mit buchhalterischer Genauigkeit hat er die Einzelheiten geschildert. Da darüber hinaus seine Angaben in den Punkten, über die Zeugen gehört werden konnten, von diesen bestätigt worden sind, erschienen auch die anderen in den verlesenen Niederschriften geschilderten Tatsachen glaubhaft und zutreffend mit Ausnahme verschiedener Zeit- und Datumsangaben, bei denen sich eine gewisse Unsicherheit des Autors ergibt.
Die im zweiten Abschnitt getroffenen Feststellungen beruhen ferner auf der von Höss im Krakauer Untersuchungsgefängnis handschriftlich aus dem Gedächtnis niedergeschriebenen Lagerordnung für das KL Auschwitz und andere Konzentrationslager. Eine Abschrift dieser Niederschrift wurde in der Hauptverhandlung verlesen. Auch hier hat sich der Sachverständige Dr. Broszat von der Übereinstimmung der Abschrift mit dem Original überzeugen können, so dass das Gericht keinen Zweifel hatte, dass die verlesene Abschrift mit der Urschriftsurkunde übereinstimmt. Das Gericht ist überzeugt, dass die von Höss niedergeschriebene Lagerordnung der damals tatsächlich im KL Auschwitz geltenden Lagerordnung entspricht. Diese Überzeugung stützt sich auf folgendes: Die von Höss in der Lagerordnung aufgezeigte innere Organisation der SS im KL Auschwitz ist von den Angeklagten als richtig bestätigt worden. Die Angeklagten haben auch, soweit sie sich über die Aufgabenbereiche ihrer Abteilungen geäussert haben - mit Ausnahme des Angeklagten Mulka - bestätigt, dass von Höss die Aufgaben dieser Abteilungen in der Lagerordnung zutreffend angegeben worden sind. Nur der Angeklagte Mulka bestreitet, dass ihm als Adjutanten - entgegen den Angaben von Höss - die Fahrbereitschaft unterstanden habe. Er behauptet ferner, dass er entgegen der von Höss niedergeschriebenen Lagerordnung weder die Geheimsachen zu bearbeiten noch das Geheimtagebuch zu führen gehabt habe.
Das Gericht ist jedoch überzeugt, dass Höss auch die dem Adjutanten des Lagerkommandanten zufallenden Aufgaben richtig aus dem Gedächtnis wiedergegeben hat. Denn mit dem Adjutanten, als seinem ersten Gehilfen, hatte er am meisten und engsten zusammenzuarbeiten. Es ist daher nur natürlich, dass er dessen Aufgaben am besten kannte. Zieht man weiter in Betracht, dass Höss - wie schon ausgeführt - um Genauigkeit bemüht war und die Aufgaben der übrigen Abteilungen zutreffend geschildert hat, so bestehen keine Zweifel, dass er auch in diesem Punkt nicht geirrt hat. Hinzu kommt aber noch, dass - wie noch bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Mulka im Rahmen der dortigen Beweiswürdigung auszuführen sein wird - eine Reihe von Zeugen bestätigt haben, dass dem Adjutanten die Fahrbereitschaft unterstanden hat. Auch aus Urkunden, die noch zu erörtern sein werden, ergibt sich das gleiche.
Schliesslich beruhen die im zweiten Abschnitt getroffenen Feststellungen auch auf einem Bericht, den der Angeklagte Broad im Jahre 1945 für eine kleine englische Einheit, deren Aufgabe die Vernehmung von deutschen Kriegsgefangenen war, aus freien Stücken allein handschriftlich niedergeschrieben hat (sog. Broad-Bericht).
Dem Gericht lag zwar die Urschrift des Berichtes nicht vor. Es konnte daher nur eine Abschrift gemäss §249 StPO verlesen werden. Das Gericht hat sich jedoch von der genauen Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift überzeugt. Der Zeuge Wi., der einen ausgezeichneten und glaubwürdigen Eindruck gemacht hat und klar, knapp und präzise aussagte, war damals in der genannten englischen Einheit. Er hat - nach seiner glaubhaften Schilderung - dem Angeklagten Broad, der sich freiwillig bei dem Vorgesetzten des Zeugen Wi., dem Zeugen van het Kaa., gemeldet und mündlich über das KL Auschwitz berichtet hatte und daraufhin aus dem Kriegsgefangenenlager herausgenommen und in dem Quartier der englischen Einheit untergebracht worden war, Bleistift und Papier zur Abfassung eines ausführlichen schriftlichen Berichtes gegeben. Broad hat dann, wie der Zeuge weiter glaubhaft ausgesagt hat, in einem Einzelzimmer allein mehrere Tage geschrieben und dann einen längeren handschriftlichen Bericht abgegeben. Der Zeuge, der die deutsche Sprache beherrscht, hat den Bericht Wort für Wort mit der Schreibmaschine abgeschrieben, eine dritte Person hat dabei nicht mitgeholfen. Auch hat niemand irgendwelche Zusätze oder Abstriche gemacht. Die von dem Zeugen Wi. gefertigte Abschrift lag dem Gericht vor und wurde verlesen. Dem Zeugen wurde die Abschrift zur Einsichtnahme vorgelegt. Er bestätigte, nachdem er sich den Bericht angesehen hatte, dass es die von ihm gefertigte Abschrift, die getreu dem Original entspräche, sei.
Die Angaben des Zeugen Wi. wurden in den wesentlichsten Punkten von dem Zeugen van het Kaa., der ebenfalls einen ausgezeichneten und glaubwürdigen Eindruck hinterlassen hat, bestätigt. Es besteht daher kein Zweifel, dass die verlesene Abschrift der handschriftlichen Urschrift entspricht.
Aus dem gesamten Inhalt des Berichtes ergibt sich, dass er von einem intelligenten Autor, der mitten in dem geschilderten Geschehen gestanden hat und, soweit es nicht seine eigene Person betraf, nichts verschweigen und beschönigen wollte, niedergeschrieben worden ist. Dem Bericht ist anzumerken, dass er aus einem eigenen persönlichen unmittelbaren Erleben heraus abgefasst worden ist. Er ist klar, verständlich und übersichtlich. Die geschilderten Verhältnisse im Lager sind, soweit eine Überprüfung möglich war, auch von anderen Angeklagten und Zeugen bestätigt worden. Das Gericht hat daher keine Bedenken, die im zweiten Abschnitt getroffenen Feststellungen auch auf diesen Bericht, zu dem der Angeklagte Broad nicht mehr in allen Punkten stehen wollte, zu stützen und - wie noch später bei der Erörterung der Straftaten der einzelnen Angeklagten auszuführen sein wird - zur Unterstützung anderer Beweismittel mit heranzuziehen.
3. Abschnitt:
Die Straftaten der Angeklagten
A. Die Straftaten des Angeklagten Mulka
I. Lebenslauf des Angeklagten Mulka
Der Angeklagte Mulka ist am 12.4.1895 als Sohn eines Postassistenten in Hamburg geboren. Er besuchte in Hamburg 3 Jahre die Volksschule und anschliessend die Realschule, die er 1911 mit der Obersekundareife verliess. Danach begann er eine kaufmännische Lehre bei der Export-Agentur-Firma Arndt und Cohn. Im August 1914 wurde er als Kriegsfreiwilliger zur Truppe eingezogen. Er war während des ersten Weltkrieges bei verschiedenen Pioniereinheiten in Frankreich, Russland und der Türkei eingesetzt. Sein letzter Dienstgrad war Leutnant der Reserve.
Nach dem ersten Weltkrieg meldete er sich auf Grund eines Aufrufes des damaligen Generalfeldmarschalls von Hindenburg zu der baltischen Landeswehr. Er nahm als Kompanieführer einer Pionierkompanie an den Kämpfen im Baltikum teil. 1920 kehrte er nach Hamburg zurück, wo er eine Tätigkeit als kaufmännischer Angestellter in einer Export-Agentur-Firma aufnahm.
Durch Urteil des Landgerichts Hamburg vom 20.4.1920 wurde der Angeklagte wegen Hehlerei zu einer Gefängnisstrafe von 8 Monaten verurteilt. Ihm wurden ferner die bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von 2 Jahren aberkannt. Der Verurteilung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Einheit des Angeklagten fuhr nach den Einsätzen im Baltikum mit der Eisenbahn nach Deutschland zurück. Im gleichen Zug befand sich ein gewisser Traugott. Dieser wurde unterwegs bei einer Kontrolle in Posheruny wegen des Verdachtes bolschewistischer Umtriebe festgenommen. Er übergab zuvor aber noch dem der Kompanie des Angeklagten angehörenden Unteroffizier Triebel 71000 Rubel mit der Bitte, diese einem Oberleutnant Bauermeister in Berlin zu überbringen. Triebel erklärte jedoch dem Angeklagten Mulka, seinem Kompanieführer, in Berlin, er wolle das Geld lieber mit nach Hause nehmen. Mulka machte daraufhin Triebel den Vorschlag, das Geld zu teilen. Beide teilten dann das Geld mit einem Feldwebel der gleichen Einheit.
Dem Angeklagten Mulka wurde später die Verbüssung der Strafe gegen Zahlung einer Geldbusse zur Bewährung ausgesetzt und schliesslich erlassen. Am 12.12.1936 wurde die Strafe auf Anordnung des Reichsministers der Justiz im Strafregister getilgt.
In der Export-Agentur-Firma arbeitete der Angeklagte bis zum Jahre 1931. Dann gründete er unter der Firma "Robert Mulka" eine selbständige Import-Export-Agentur, die auch im Handelsregister eingetragen wurde.
Der Angeklagte gehörte von 1928-1934 dem "Stahlhelm" an. Er sei im Jahre 1934 - so gibt er an - deswegen aus dem Stahlhelm ausgetreten, weil die Mitglieder des Stahlhelms zwangsläufig in die SA Reserve überführt worden seien. Auf Anregung des "Nationalverbandes deutscher Offiziere", dem der Angeklagte ebenfalls angehörte, stellte er sich der neuen deutschen Wehrmacht zur Verfügung. Er wurde als Oberleutnant der Reserve übernommen. In dem von ihm auszufüllenden Fragebogen verschwieg er die oben erwähnte Vorstrafe, weil sie - so gibt er an - damals bereits im Strafregister gelöscht gewesen sei. Als seine Vorstrafe dennoch bekannt wurde, wurde er aus dem Offizierskorps ausgeschlossen.
Bei Ausbruch des zweiten Weltkrieges wurde der Angeklagte von der Wehrmacht nicht als Offizier übernommen. Man bot ihm an, als einfacher Soldat in die Wehrmacht einzutreten und sich hochzudienen. Das lehnte der Angeklagte jedoch ab. Durch Vermittlung eines Freundes, des Zeugen He., der persönliche Beziehung zur Waffen-SS hatte, wurde der Angeklagte im Jahre 1941 aufgrund freiwilliger Meldung von der Waffen-SS als Führer (Obersturmführer) übernommen. Er tat zunächst Dienst als Kompanieführer beim SS-Pionierbataillon I in Dresden. Da er unter Magenbeschwerden litt, kam er Ende 1941 nach Dresden in das Lazarett. Danach wurde er nur noch garnisonsverwendungsfähig Heimat (g.v.H.). Er wurde nun zum KZ Auschwitz als Kompanieführer einer Wacheinheit abkommandiert. Angeblich wusste er damals nicht, dass in Auschwitz ein Konzentrationslager war.
Dies will er erst bei seiner Meldung bei dem damaligen Lagerkommandanten Höss erfahren haben.
Zunächst war der Angeklagte in Auschwitz Kompanieführer der 1. Kompanie des Wachsturmbannes. Die 1. Kompanie erhielt ihre militärische Grundausbildung und wurde ausserdem zum Wachdienst für das KZ eingesetzt.
Im April 1942 nahm der Angeklagte während der Erkrankung des Adjutanten Obersturmführer Bräuning dessen Dienstgeschäfte wahr.
Durch Kommandanturbefehl Nr.8/42 vom 29.4.1942 (Ziff.20) wurde er vertretungsweise mit den Dienstgeschäften des Adjutanten beauftragt. Durch Kommandantursonderbefehl vom 8.5.1942 wurde der Lagerkommandant Betriebsdirektor sämtlicher in seinem Organisationsbereich befindlichen Betriebe, während der Angeklagte Mulka als Adjutant zum "Sachbearbeiter für betriebliche und wirtschaftliche Angelegenheiten" bestellt wurde. Durch Kommandantursonderbefehl vom 6.6.1942 wurde der Angeklagte mit sofortiger Wirkung von der Wachtruppe zum Kommandanturstab versetzt. Er nahm weiterhin die Geschäfte des Adjutanten wahr. Am 6.7.1942 wurde der Angeklagte aufgrund eines Sonderbefehles vom gleichen Tage zum "Stabsführer" im KL Auschwitz eingesetzt, nachdem durch Verfügung der Amtsgruppe D vom 1.7.1942 der SS-Obersturmführer Lanzius als Adjutant zum KL Auschwitz versetzt worden war.
In seiner Eigenschaft als Stabsführer hatte der Angeklagte Mulka folgende Aufgaben: Er hatte die gesamten Dienstgeschäfte des Kommandanturstabes zu führen und zu leiten. Ihm waren unterstellt:
1. Adjutantur
2. Führerpersonalien und sonstige Personalfragen
3. Gerichtsabteilung als Gerichtsoffizier
4. Abteilung VI - Truppenbetreuung
5. Schulung und Ausbildung der Aufseherinnen des FKL
Der Angeklagte Mulka war weiterhin als Stabsführer Sachbearbeiter für Wirtschaftsfragen in Vertretung des Betriebsdirektors der SS-Wirtschaftsbetriebe. Er hatte die Führung und Kontrolle der eigenen Wirtschaftsbetriebe des KL Auschwitz nach diesem Sonderbefehl zu übernehmen. Durch Kommandanturbefehl vom 7.8.1942 wurde der Befehl vom 6.7.1942 wieder aufgehoben.
Der Angeklagte Mulka, der inzwischen zum Hauptsturmführer befördert worden war, wurde nun endgültig als Adjutant des Lagerkommandanten eingesetzt. Daneben blieb die im Befehl vom 6.7.1942 getroffene Anordnung bezüglich des Angeklagten bestehen. Er blieb weiterhin Stabsführer und Sachbearbeiter für Wirtschaftsfragen. Er war mit Unterbrechungen durch Krankheit Adjutant bis zum 9.3.1943. Dann wurde er wegen einer abfälligen Äusserung nach einer Rede von Dr. Goebbels, die er der Ehefrau des SS-Sturmbannführers Bischoff gegenüber gemacht hatte, abgelöst, vorläufig festgenommen und nach Berlin gebracht. Auf der Fahrt nach Berlin erlitt er zwei schwere Magenkoliken. Deswegen wurde er am 10.3.1943 in das Lazarett Berlin-Lichterfelde eingeliefert. Anfang April kam er - wie er angibt - in das Untersuchungsgefängnis in Berlin-Schöneberg, in dem er - nach seiner Einlassung - ca. 3 Monate bis Juli 1943 blieb. Dann wurde er nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens vom Dienst suspendiert und nach Hamburg beurlaubt. Dort stellte er sich nach dem Beginn der Bombenangriffe auf Hamburg dem Höheren SS- und Polizeiführer "Nordsee", Graf von Bassewitz-Behr, zur Verfügung. Anfang 1944 wurde das gegen ihn schwebende Verfahren eingestellt. Zu gleicher Zeit kam er noch zur SS-Pionierschule in Hradiscko bei Prag, nachdem er sich wieder zur Truppe gemeldet hatte. Anfang 1945 wurde er wegen Krankheit nach Hamburg beurlaubt. Dort erlebte er das Kriegsende.
Am 8.6.1945 wurde er interniert. Er war dann bis zum 28.3.1948 in verschiedenen Internierungslagern in Haft. Von der Spruchkammer in Hamburg-Bergedorf wurde er wegen Kenntnis krimineller Tatbestände zunächst zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, später jedoch als Entlasteter in die Kategorie V eingestuft.
Der Angeklagte behauptet, er habe auf sämtlichen Fragebogen alle Angaben wahrheitsgemäss gemacht. Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen will er nie gewesen sein. Er habe zwar - so gibt er an - einen Antrag auf Aufnahme in die NSDAP gestellt, über seine Aufnahme sei jedoch niemals entschieden worden. Er sei nur Parteianwärter gewesen.
Er hat, wie sich aus seinem Schreiben vom 28.September 1939 an die NSDAP, Kreis II, Ortsgruppe Klosterstern in Hamburg ergibt, an diesem Tag einen Antrag auf Aufnahme in die NSDAP gestellt. In diesem Schreiben heisst es unter anderem wörtlich wie folgt: "Eine vollständige und geschlossene Akte über meine (Mulkas) Unternehmungen mit Bezug auf die gemeldete Strafe des Systemgerichtes von 1919 befindet sich im Besitz meines Anwaltes." In dem Schreiben des Mitgliedschaftsamtes München vom 16.Dezember 1940 an den Gauschatzmeister des Gaues Hamburg der NSDAP in Hamburg heisst es in bezug auf die "Aufnahme des Volksgenossen Robert Mulka, geboren am 12.4.1895" unter anderem wie folgt wörtlich: "Dem Antrag auf Aufnahme (in die NSDAP) wird nunmehr mit Wirkung vom 1.Februar 1940 stattgegeben. Robert Mulka wird nunmehr in die Reichskartei mit Aufnahmedatum 1.Februar 1940 unter der im Betreff genannten Mitgliedsnummer (7848085) und Zuteilung zur Ortsgruppe Hamburg mit obiger Anschrift eingetragen. Bei Aushändigung der beiliegenden Mitgliedskarte ...."
Der Angeklagte hat im Jahre 1920 geheiratet. Aus seiner Ehe sind eine Tochter und zwei Söhne hervorgegangen. Ein Sohn ist am 14.4.1945 gefallen. Seit dem Jahre 1948 betätigt sich der Angeklagte wieder als selbständiger Kaufmann. Der Angeklagte Mulka befand sich vom 8.11.1960 bis zum 6.3.1961 und vom 29.5.1961 bis zum 13.12.1961, vom 22.2.1964 bis zum 22.10.1964 in dieser Sache in Untersuchungshaft. Seit dem 3.12.1964 ist er erneut inhaftiert.
II. Die Mitwirkung des Angeklagten Mulka an der Massentötung jüdischer Menschen in Auschwitz (Tatsächliche Feststellungen)
Der Angeklagte Mulka hat als Adjutant des Lagerkommandanten Höss bei der massenweisen Tötung der sog. RSHA-Juden (vgl. oben 2. Abschnitt VII, 5) mitgewirkt.
In der Zeit, während er Adjutant war, kamen die Eisenbahntransporte mit sog. RSHA-Juden nur auf der alten Rampe in Auschwitz an. Sie wurden jeweils vom RSHA oder der einweisenden Gestapodienststelle, die davon dem RSHA Mitteilung machte, der Kommandantur des Lagers, nicht etwa der Politischen Abteilung, durch Fernschreiben, Funksprüche oder durch gewöhnliche Geheimschreiben angekündigt. Beim Eintreffen der angekündigten Transporte verständigte der Adjutant oder ein anderes Mitglied des Kommandanturstabes telefonisch die verschiedenen Abteilungen des Lagers sowie den Wachsturmbann von der Ankunft des betreffenden RSHA-Transportes und befahl, dass die für den Rampendienst eingeteilten Führer, Unterführer und Männer sich auf die Rampe zu begeben hätten. Die "Abwicklung" eines für die Vernichtung bestimmten RSHA-Transportes war bis ins einzelne organisiert. Bei den verschiedenen Abteilungen des Lagers und beim Wachsturmbann war hierfür ständig ein sog. "Rampendienst" eingeteilt. Die Schutzhaftlagerführung stellte den "Diensthabenden Führer", dessen Aufgabe es war, die Empfangnahme, Einteilung und Vernichtung der in einem Transport angekommenen Menschen zu leiten und zu beaufsichtigen. Vom Wachsturmbann wurde eine bewaffnete Kompanie zum Rampendienst geführt. Sie hatte vor dem Einlaufen des Zuges oder, falls dieser bereits an der Rampe stand, vor dem Aussteigen der in den geschlossenen Wagen wartenden Menschen, in einer gewissen Entfernung von der Rampe um diese einen dichten geschlossenen Ring bewaffneter Wachtposten zu bilden, um Fluchtversuche der angekommenen Menschen nach dem Aussteigen zu verhindern und um Unbefugten den Zutritt zur Rampe zu verwehren. Wenn die Postenkette stand, gab der diensthabende SS-Führer das Zeichen zum Öffnen der Waggons.
Daraufhin öffneten die eingeteilten Blockführer die Waggons und liessen die eingepferchten Menschen aus den Wagen auf die Rampe aussteigen. Das Gepäck blieb auf Befehl der SS-Männer in den Wagen zurück. Es wurde von einem Häftlingskommando unter Führung eines SS-Unterführers oder SS-Mannes ausgeladen, auf die LKWs gebracht und dann in das bereits oben erwähnte Lager "Kanada" gefahren. Das Häftlingskommando holte auch die Leichen der unterwegs verstorbenen Menschen aus den Waggons heraus und trug sie zu anderen LKWs, die sie zu den den Krematorien fuhren.
Die ausgestiegenen Menschen mussten auf Befehl des Rapportführers und der Blockführer in Fünferreihen antreten. Dabei trennten die SS-Unterführer und SS-Männer Frauen mit Kindern, alte Menschen, Krüppel, Kranke und Kinder unter 16 Jahren als arbeitsunfähig von den anderen und liessen sie gesondert Aufstellung nehmen. Die übrigen Männer und Frauen traten in getrennten Kolonnen in Fünferreihen an. Der Transportführer des Zuges übergab die Transportpapiere mit der Anzahl der deportierten Menschen einem Vertreter der Aufnahmeabteilung der Politischen Abteilung. Dieser liess die angetretenen Menschen zählen und verglich die festgestellte Anzahl mit der in den Transportpapieren angegebenen Zahl. Hiernach rückten die Männer und Frauen, die nicht von vornherein als arbeitsunfähig ausgesondert worden waren, auf Befehl der SS-Männer vor und defilierten an den an der Spitzeder beiden Kolonnen stehenden SS-Ärzten und SS-Führern vorbei. Aufgabe der Ärzte war es, die Arbeitsfähigen aus den vorbeimarschierenden Menschen auszuwählen. Dies geschah nach oberflächlicher Betrachtung (gelegentlich unter Befragung nach Alter und Beruf) in der Weise, dass der Arzt mit einer kurzen Handbewegung die Menschen entweder nach rechts oder nach links schickte. Die einen, die der Arzt als arbeitsfähig beurteilt hatte, mussten auf der einen Seite - etwas abgesondert von der Masse der übrigen Menschen - Aufstellung nehmen, während die als arbeitsunfähig beurteilten Menschen nach der anderen Seite in der grösseren Kolonne weitergingen, die dann schliesslich in die Gaskammern geführt wurde. Als arbeitsfähig wurden jeweils zwischen 10 und 15%, selten mehr, jedoch nicht über 25% des betreffenden Transportes ausgesondert.
Ab und zu kam es auch vor, dass ein Transport aus besonderen Gründen geschlossen in das Gas geführt wurde.
Die Arbeitsfähigen wurden später unter Bewachung eines SS-Kommandos in das Schutzhaftlager geführt, dort gebadet, geschoren, eingekleidet und dann in der Aufnahmeabteilung der Politischen Abteilung karteimässig erfasst und in die Lagerstärke aufgenommen. Sie wurden aber nicht wie Schutzhaftgefangene erkennungsdienstlich behandelt. Auf der Karteikarte dieser sog. RSHA-Juden wurde als Einweisungsgrund vermerkt: "Gemäss Erlass des RSHA ..... vom ..... Nr. ....."
Häufig wurden Ärzte, Apotheker und sonstiges Sanitätspersonal schon vor der eigentlichen Auswahl durch den Arzt herausgerufen und auf die Seite der Arbeitsfähigen gestellt. Sie wurden dann ebenfalls in das Lager geführt. War gerade Bedarf an bestimmten Berufen (z.B. Schuster, Schneider, Elektriker usw.) so wurde dies häufig durch den Arbeitseinsatzführer bekanntgegeben. Personen, die sich als Angehörige dieser gesuchten Berufe meldeten, wurden nach kurzer Prüfung zu den Arbeitsfähigen gestellt. Während dieser Aktion, die sich längere Zeit hinzog, achteten SS-Unterführer und Blockführer darauf, dass die Angehörigen des Häftlingskommandos, die das Gepäck auszuladen hatten, nicht mit den angekommenen Menschen sprachen. Dies war streng verboten. Das Sprechverbot sollte verhindern, dass die Deportierten vorzeitig von ihrem bevorstehenden Schicksal erführen. Von ihrem bevorstehenden Tod ahnten sie nichts. Die angekommenen Menschen durften sich auch nicht untereinander unterhalten. Dies wurde ihnen nach dem Aussteigen sofort bekanntgegeben. Die SS-Angehörigen hatten auf die Einhaltung des Verbotes zu achten. Die Häftlinge des Häftlingskommandos wurden besonders von Angehörigen der Politischen Abteilung beobachtet. Diese hatten aber auch ihr Augenmerk auf die beim Rampendienst tätigen SS-Angehörigen zu richten. Nach der getroffenen Auswahl hatten die SS-Männer ferner zu verhindern, dass sich die für den Gastod bestimmten Menschen wieder zu den arbeitsfähigen stellten - etwa, um mit einem Verwandten oder Bekannten zusammenbleiben zu können. Blockführer und Angehörige der Politischen Abteilung durchsuchten auch die Waggons nach zurückgebliebenen Menschen.
Den als arbeitsunfähig beurteilten Menschen erklärte man, dass sie gebadet würden und dann zu arbeiten hätten.
Häufig kam es vor, dass Familien zusammenbleiben wollten. Man beruhigte sich bei der Trennung auf der Rampe, dass sie nach dem Baden bald wieder im Lager zusammenkommen würden. Kranke und nicht gehfähige Personen wurden ab Herbst 1942 mit Lastkraftwagen der Fahrbereitschaft, die im September 1942 eigens zu diesem Zweck angeschafft worden waren, zu den Gaskammern transportiert.
Als die ersten RSHA-Transporte noch im kleinen Krematorium vergast wurden, mussten sich die Menschen im Vorhof dieses Krematoriums entkleiden. Sie wurden dann nackt und ahnungslos in den Vergasungsraum hineingetrieben. Wenn alle, die sich in dem Vorhof entkleidet hatten, im Vergasungsraum waren, wurde dieser von aussen verriegelt. Zwei SS-Männer, die dem sog. Vergasungskommando angehörten und im Umgang mit Zyklon B ausgebildet worden waren, schütteten dann Zyklon B durch zwei Öffnungen von oben in den Vergasungsraum hinein. Das Zyklon B befand sich in körnigem Zustand in verschlossenen Blechdosen. Die SS-Männer öffneten die Dosen unter dem Schutz von Gasmasken erst unmittelbar vor dem Einschütten. Sobald die Körner des Zyklon B durch die Öffnungen in Vergasungsraum hineinrieselten und mit Luft in Berührung kamen, entwickelten sich Blausäuredämpfe, an denen die in der Gaskammer befindlichen Menschen in einigen Minuten qualvoll erstickten. Dabei spielten sich fürchterliche Szenen ab. Die Menschen, die nun merkten, dass sie eines qualvollen Todes sterben sollten, schrien und tobten und schlugen mit den Fäusten gegen die verschlossenen Türen und gegen die Wände. Da sich das Gas vom Boden des Vergasungsraumes aus nach oben ausbreitete, starben die kleinen und schwächlichen Menschen zuerst. Die anderen stiegen dann in ihrer Todesangst auf die am Boden liegenden Leichen, um noch etwas Luft zu erhalten, bis sie schliesslich selbst qualvoll erstickt waren. Um die Todesschreie der im Vergasungsraum befindlichen Menschen zu übertönen, liess man beim kleinen Krematorium häufig Lastkraftwagenmotoren laufen oder SS-Männer mit Motorrädern um das kleine Krematorium herumfahren. Gleichwohl war das Geschrei meist noch in den benachbarten Gebäuden zu hören.
Bei den umgebauten Bauernhäusern, in denen die RSHA-Transporte ab Sommer 1942 in gleicher Weise mit Zyklon B getötet wurden, befanden sich mehrere Baracken, in denen sich die zum Tode bestimmten Menschen auszukleiden hatten. Schilder mit der Aufschrift "Zum Baderaum" und zur "Desinfektion" wiesen zu den Gaskammern in den umgebauten Häusern hin. Die Schilder sollten den Menschen vorspiegeln, dass sie gebadet und desinfiziert würden. Auch hier gingen die Menschen ahnungslos in die Gaskammern hinein. Nach der Verriegelung der Gaskammern wurde das Zyklon B ebenfalls von Angehörigen des Vergasungskommandos durch Öffnungen von oben in die Vergasungsräume hineingeschüttet. Danach spielten sich die gleichen - bereits geschilderten - Szenen ab, bis alle eingeschlossenen Menschen tot waren.
Für die Krematorien I-IV, bei denen sich die Entkleidungs- und Vergasungsräume unter der Erde und die Verbrennungsöfen über der Erde, jedoch im gleichen Gebäude befanden, wurde ein SS-Sonderkommando unter Führung eines SS-Unterführers gebildet.
Die Krematorien selbst wurden durch eine Postenkette aus SS-Männern gesichert. Das Betreten des durch die Posten gesicherten Gebietes war allen Häftlingen und SS-Angehörigen, die nicht unmittelbar mit den Vergasungen zu tun hatten, streng untersagt. Angehörige des SS-Sonderkommandos nahmen die zum Tode bestimmten Menschen, wenn sie von den begleitenden SS-Männern herangeführt worden waren, in Empfang. Sie führten sie dann in die Entkleidungsräume, die unmittelbar vor den Gaskammern lagen. Unruhige und misstrauische Personen wurden - wie es auch schon bei den umgebauten Bauernhäusern geschehen war - unauffällig beiseite genommen und abseits unbemerkt von den anderen durch Genickschüsse getötet. In den Entkleidungsräumen waren Haken zum Aufhängen der Kleider angebracht.
Die SS-Männer schärften den Menschen, die sich völlig entkleiden mussten, ein, sie sollten ihre Kleider und Schuhe sorgfältig aufbewahren und sich die Haken merken, an denen sie ihre Sachen aufgehängt hätten, damit sie ihre Sachen nach dem Duschen wiederfänden. Um die dem Tode Geweihten bis zuletzt über ihr bevorstehendes Schicksal zu täuschen, gingen SS-Männer mit ihnen in die Gaskammern hinein. Erst, wenn alle in den Gaskammern waren, sprangen die SS-Männer heraus und verriegelten die Türen überraschend von aussen. Darüber hinaus hatte man, um auch das letzte Misstrauen zu zerstreuen, in den Gaskammern der Krematorien I und II Attrappen von Brausen angebracht, die einen Duschraum vortäuschen sollten. Zur Tarnung der in der Decke befindlichen Öffnungen, durch die das Zyklon B von aussen hineingeschüttet wurde, hatte man aus durchlöchertem Blech bestehende hohle Säulen installiert, die vom Boden bis zur Decke reichten und die Öffnungen verdeckten. In den Säulen befanden sich Spiralen, die das gekörnte Zyklon B nach dem Einschütten verteilten.
In den Krematorien III und IV waren keine imitierten Brausen und keine Säulen. Hier wurde das Zyklon B durch ein kleines Seitenfenster von den Angehörigen des Vergasungskommandos hineingeschüttet.
Auch in den Gaskammern der Krematorien I bis IV starben die Menschen nach dem Einschütten des Zyklon B durch das sich entwickelnde Gas in der gleichen Weise wie in den Gaskammern des kleinen Krematoriums und der umgebauten Bauernhäuser. Bei den Vergasungen hatte ein Arzt dabei zu sein. Er gab den SS-Männern des Vergasungskommandos das Zeichen zum Einschütten des Zyklon B. Während des Einschüttens des Zyklon B überwachte er die damit beschäftigten Desinfektoren, um im Falle einer Vergiftung sofort eingreifen und ärztliche Hilfe geben zu können. Danach beobachtete er durch ein Guckloch den Todeskampf der eingeschlossenen Menschen. Waren nach seiner Meinung alle tot, gab er dem SS-Kommandoführer den Befehl zum Öffnen der Gaskammer. Dann stellte er den Tod der Opfer fest und gab die Leichen zur Verbrennung frei. Die Leichen wurden nun von einem jüdischen Sonderkommando, das in Block 13 des Lagerabschnittes B II d - isoliert von den anderen Häftlingen des Lagers - und später in den Krematorien selbst untergebracht war, herausgezerrt. In den Krematorien I bis IV wurden sie anschliessend, nachdem ihnen durch Häftlinge die Goldzähne entfernt und den weiblichen Leichen die Haare abgeschnitten worden waren, in den Verbrennungsöfen verbrannt. Von den Vergasungsräumen waren Aufzüge zu den Öfen gebaut worden, damit die Leichen schneller zu den Verbrennungsöfen transportiert werden konnten.
Als die Krematorien I bis IV noch nicht in Betrieb waren, musste das jüdische Sonderkommando - wie oben schon erwähnt - die Leichen zunächst in langen Gruben begraben und später in langen ausgehobenen Gräben verbrennen. Letzteres geschah auch noch später, wenn Vergasungen im Bunker V stattfanden. Die Büchsen mit dem Zyklon B wurden mit einem Rot-Kreuz-Wagen, mit dem meist auch der Arzt und die Angehörigen des Vergasungskommandos fuhren, zu den Gaskammern nach Birkenau gebracht.
Die Oberaufsicht bei dem gesamten Vergasungsvorgang hatte - jedenfalls 1942 bei den umgebauten Bauernhäusern - der Schutzhaftlagerführer oder der Rapportführer. Häufig war auch der Lagerkommandant selbst bei der Empfangnahme, Einteilung und Tötung eines RSHA-Transportes, sowohl auf der Rampe als auch anschliessend bei den Gaskammern dabei. Er übte dann die Oberaufsicht aus. Er hielt seine häufige Anwesenheit für erforderlich, um die genaue Ausführung der gegebenen Befehle zu überwachen und die SS-Führer, Unterführer und SS-Männer in ihrem Dienst psychisch zu stärken. Alle SS-Angehörigen, die bei den Vergasungsaktionen mitwirkten, erhielten Sonderzuteilungen aus Schnaps, Zigaretten und Lebensmitteln. Die Gutscheine für diese Dinge teilte der diensthabende SS-Führer (Schutzhaftlagerführer) aus.
Nach Beendigung einer jeden Aktion meldete die Aufnahmeabteilung der Politischen Abteilung über den Leiter der Politischen Abteilung, der die Meldung unterschrieb, an das RSHA - meist per Fernschreiben - wieviel Menschen getötet und wieviel Menschen in das Lager aufgenommen worden waren. Getötet wurde getarnt mit Ausdrücken wie "gesondert untergebracht" oder es wurden Buchstaben verwendet: a. bedeutete in das Lager aufgenommen, b. bedeutete "vergast". Die Fernschreiben mussten vor ihrem Abgang vom Adjutanten abgezeichnet werden. Ohne das Namenszeichen des Adjutanten durfte die Fernschreibstelle kein Fernschreiben durchgeben.
Der Angeklagte Mulka hat als Adjutant des Lagerkommandanten Höss an mindestens drei verschiedenen Tagen nach Ankündigung je eines RSHA-Transportes persönlich die verschiedenen Abteilungen des Lagers von der Ankunft der Transporte telefonisch benachrichtigt und die Einsatzbefehle für den Rampendienst gegeben. Er war auch selbst in einer unbestimmten Anzahl von Fällen bei der Abwicklung von RSHA-Transporten auf der Rampe. In mindestens einem Fall war er bei einer solchen Aktion der ranghöchste Offizier auf der Rampe. In diesem Fall hat er die Oberaufsicht geführt. Dabei ereignete sich folgendes: 2 SS-Unterführer brachten einen Häftling des Häftlingskommandos zu dem Angeklagten Mulka. Sie meldeten ihm, der Häftling - die SS-Männer sagten "das Schwein" - habe mit den Zugängen gesprochen. Mulka gab daraufhin den Befehl, wobei er auf seine Uhr schaute: "Macht ihn fertig, es ist spät!" Die beiden SS-Unterführer schlugen daraufhin auf den Häftling mit Knüppeln ein, bis er tot war. Die Leiche wurde dann weggebracht.
Ob der Angeklagte Mulka bei der Anwesenheit auf der Rampe als ranghöchster SS-Führer oder bei anderen Gelegenheiten auch selbst arbeitsfähige Juden ausgesondert hat, konnte nicht festgestellt werden. Er hat jeweils durch seine Anwesenheit die anderen SS-Führer, Unterführer und SS-Männer darin bestärkt, den Rampendienst gemäss den ihnen gegebenen Befehlen strikt durchzuführen.
Der Angeklagte Mulka, dem als Adjutant auch die Fahrbereitschaft unterstand, war auch für den Einsatz der LKWs, die die Kranken und nicht gehfähigen jüdischen Menschen zu den Gaskammern brachten, verantwortlich. Der Fahrbereitschaft war eine generelle Anweisung erteilt worden, dass für den Transport dieser Menschen LKWs, die eigens zu diesem Zweck angeschafft worden waren, in Bereitschaft zu halten seien. War ein RSHA-Transport angekündigt, so wurde die Fahrbereitschaft daraufhin benachrichtigt und angewiesen, die für den Rampendienst eingeteilten LKW-Fahrer mit ihren Fahrzeugen zur Rampe zu schicken. In mindestens den drei genannten Fällen hat Mulka auch die Fahrbereitschaft benachrichtigt und den Einsatzbefehl für die LKW-Fahrer an die Fahrbereitschaft durchgegeben. Ob er persönlich auch die genannte generelle Anweisung für den Einsatz der LKWs gegeben hat oder ob das durch den Lagerkommandanten selbst geschehen ist, konnte nicht festgestellt werden.
Der Angeklagte Mulka hat auch bei der Beschaffung von Zyklon B, mit dem die jüdischen Menschen in den Gaskammern getötet wurden, mitgewirkt.
Für Fahrten mit Kraftfahrzeugen über 200 km Strecke (Hin- und Rückfahrt) war sowohl im Heimatkriegsgebiet als auch im besetzten Gebiet die vorherige schriftliche Genehmigung eines Befehlshabers mit der Stellung eines kommandierenden Generals oder Admirals erforderlich. Der Angeklagte Mulka hat in mindestens einem Fall, nämlich am 2.10.1942, eine Fahrzeuggenehmigung für einen 5 t LKW mit Anhänger zur Abholung von Zyklon B für die Tötung von sog. RSHA-Juden in den Gaskammern von Auschwitz beim WVHA beantragt. Auf seinen Antrag hin wurde die Genehmigung durch Funkspruch vom gleichen Tage erteilt. Der Funkspruch hat folgenden Wortlaut:
Funkspruch Nr.16
WVHA angekommen: 2.10.1942 1632
an KL - Au
Betr.: Fahrgen.
Bezug: Dort. Antrag vom 2.10.1942
Fahrgenehmigung für einen 5 t LKW mit Anhänger nach Dessau und zurück, zwecks Abholung von Materialien für die Judenumsiedlung, wird hiermit erteilt.
Dem Kraftfahrer ist diese Fahrgenehmigung mitzugeben.
gez. Liebehenschel
SS-Obersturmbannführer
ständiger Vertreter des Leiters der Dienststelle im Range eines Generalleutnants der Waffen-SS.
F.d.R. gez. Selle
Funkstellenleiter
f.d.R.d.A.
A.B. gez. Mulka
Hauptsturmführer und Adjutant.
Der Angeklagte gab die von ihm beglaubigte Abschrift des Funkspruchs an die Fahrbereitschaft weiter, wo sie dem Fahrer des LKWs für die Fahrt nach Dessau ausgehändigt wurde. Der Fahrer, dessen Namen nicht festgestellt werden konnte, holte dann das Zyklon B in Dessau ab und brachte es zu dem Konzentrationslager Auschwitz, wo es für die Vergasung von Menschen, insbesondere von RSHA-Juden, in den Gaskammern verwendet wurde.
Der Angeklagte wusste, dass der Ausdruck "Materialien für Judenumsiedlung" nur eine Tarnbezeichnung war und dass in Wirklichkeit Zyklon B für die Vergasung von jüdischen Menschen abgeholt werden sollte.
Schliesslich hat sich der Angeklagte Mulka, nachdem der Bau der vier neuen Krematorien mit den dazugehörigen Gaskammern begonnen war, um die rasche Herstellung der für die Gaskammern der Krematorien II und III erforderlichen gasdichten Türen und Fenstern bemüht.
Er war - wie oben schon ausgeführt - Sachbearbeiter für die DAW. Der Leiter der Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei in Auschwitz, SS-Sturmbannführer Bischoff, hatte unter anderem bei den DAW drei gasdichte Türen und eine Tür mit Guckloch für die Gaskammern der Krematorien bestellt. Der Angeklagte Mulka kam als Sachbearbeiter wiederholt in das Betriebsbüro der DAW und erkundigte sich nach der Fertigstellung der Türen und drängte auf die schnelle Ausführung des Auftrages. Die Türen wurden nach ihrer Fertigstellung in die Krematorien II und III eingebaut.
Durch die geschilderten Handlungen hat der Angeklagte Mulka bei der Tötung von mindestens je 750 Menschen aus vier verschiedenen RSHA-Transporten, die zu verschiedenen Zeiten in Auschwitz angekommen sind, mitgewirkt.
Dem Angeklagten Mulka war bekannt, dass die jüdischen Menschen, die mit den sog. RSHA-Transporten ankamen, in den Gaskammern getötet wurden, soweit sie nicht als arbeitsfähig ausgesondert und in das Lager aufgenommen wurden. Er wusste auch, dass sie nur deshalb getötet wurden, weil sie Juden waren. Er war auch darüber informiert, dass die Deportationen der Juden nach Auschwitz unter strengster Geheimhaltung und unter Verwendung von Tarnbezeichnungen erfolgten und dass die Juden in der oben geschilderten Weise über ihr bevorstehendes Schicksal bis zuletzt getäuscht wurden und daher ahnungslos in die Gaskammern hineingingen. Er kannte auch die Ängste, den Schrecken und die Todesqual, die die Opfer jeweils ergriffen, wenn das Gas eingeschüttet worden war und die Opfer merkten, dass sie eines qualvollen Todes sterben sollten. Dem Angeklagten Mulka war auch klar, dass er durch die Benachrichtigung der verschiedenen Abteilungen im Lager nach der Ankündigung der RSHA-Transporte jeweils den gesamten organisierten Vernichtungsapparat in Gang setzte und durch seine Anwesenheit auf der Rampe, durch die Bemühungen um die Beschaffung des Zyklon B und die schnelle Fertigstellung der gasdichten Türen, durch den Einsatz der Fahrbereitschaft, die ihm unterstand und für die er verantwortlich war, selbst auch einen Beitrag zu den Massentötungen leistete.
III. Die Einlassung des Angeklagten Mulka
Der Angeklagte Mulka hat die ihm zur Last gelegte Tat bestritten. Er hat sich dahin eingelassen, dass er erst in der zweiten Hälfte des Jahres 1942 erfahren habe, dass in Auschwitz Menschen erschossen und vergast würden. Er habe auch davon gehört, dass Gaskammern in Auschwitz seien, in denen Menschen durch Gas getötet würden. Er selbst habe aber die Gaskammern nicht gesehen, auch habe er nichts mit den Vergasungen zu tun gehabt. Nur den Gesprächen mit anderen SS-Angehörigen habe er entnommen, dass Vergasungsanlagen tief im Gelände in umgebauten Bauernhäusern sein müssten.
Auf der Rampe sei er nie gewesen, wenn RSHA-Transporte angekommen seien. Die Rampe habe er nur ein einziges Mal besichtigt, als sie leer gewesen sei. Mit der Abwicklung der RSHA-Transporte habe er nichts zu tun gehabt. Hierfür sei die Politische Abteilung verantwortlich gewesen. Die Politische Abteilung habe auch die verschiedenen Stellen im Lager von der Ankunft der RSHA-Transporte benachrichtigen müssen. Die Fernschreibstelle habe ihm als Adjutanten zwar unterstanden, er habe sie aber nie besucht, er habe sich auch nie um die Bücher gekümmert, in denen die ankommenden und abgehenden Fernschreiben hätten eingetragen werden müssen. Allerdings habe er verschiedene Fernschreiben selbst gesehen. Drei- bis viermal seien Fernschreiben vom RSHA gekommen, mit denen Transporte von Juden avisiert worden seien. Die Fernschreibstelle habe diese Fernschreiben zu ihm gebracht, damit er sie dem Kommandanten vorlege. Das habe er auch getan und die Fernschreiben anschliessend durch eine Ordonnanz zur Politischen Abteilung geschickt, da diese für die Abwicklung der Transporte verantwortlich gewesen sei.
Die Fahrbereitschaft habe ihm als Adjutant sachlich nicht unterstanden. Er habe nur die Disziplinargewalt über die Angehörigen der Fahrbereitschaft gehabt.
Fahrgenehmigungen für Fahrten über 30 km habe er nie eingeholt, auch nie eine Genehmigung für eine Fahrt zum Abholen von Zyklon B.
Ursprünglich hat der Angeklagte Mulka auch in Abrede gestellt, davon gewusst zu haben, dass Fahrbefehle für die Abholung von Zyklon B ausgestellt und unterzeichnet worden seien. Auf die Frage, wie das Zyklon B beschafft worden sei, hat er zuerst erklärt, dass die Anforderung von Zyklon B "Geheime Reichssache" gewesen sei. Auf die weitere Frage, woher er das denn gewusst habe, gab der Angeklagte die ausweichende Antwort, er könne die Frage nicht beantworten.
Erst als ihm in der Sitzung vom 11.9.1964 der oben zitierte Funkspruch vom 2.10.1942 vorgehalten worden ist, musste er einräumen, dass er diesen Funkspruch gesehen und die Richtigkeit der Abschrift dieses Funkspruchs als Adjutant bescheinigt habe. Er räumte auch ein, gewusst zu haben, dass "Judenumsiedlung" Vergasung bedeutet habe und dass das Wort "Materialien" eine Tarnbezeichnung für Zyklon B gewesen sei.
Der Angeklagte Mulka hat ferner behauptet, er habe niemals das Schutzhaftlager betreten. Auch hat er in Abrede gestellt, dass er etwas von Standgerichtsverhandlungen im Block 11 gewusst habe und dass er als Adjutant die Verschluss- und Geheimsachen verwaltet und das Geheimtagebuch geführt habe. Schliesslich hat er geleugnet, Meldungen der Aufnahmeabteilung der Politischen Abteilung über die durchgeführten Vergasungen von Juden an das RSHA gesehen zu haben.
IV. Beweiswürdigung
1. Allgemeine Vorbemerkung zur Beweiswürdigung
Bei der Feststellung der individuellen Beteiligung der Angeklagten an den in dem Konzentrationslager Auschwitz begangenen Mordtaten, sei es an Massenmorden, sei es an Einzeltötungen, sah sich das Schwurgericht vor ausserordentlich schwierige Aufgaben gestellt. Die Angeklagten selbst trugen zur Aufklärung nur sehr wenig bei. Soweit sie eine Beteiligung zugaben, schwächten sie diese ab, stellten sie verzerrt dar oder hatten stets eine Reihe von Ausreden zur Hand.
Die wenigen zur Verfügung stehenden Urkunden dienten im wesentlichen nur der Aufklärung allgemeiner Dinge, konnten jedoch über die individuelle Schuld der Angeklagten kaum Aufschluss geben.
Das Gericht war somit bei der Aufklärung der von den Angeklagten begangenen Verbrechen fast ausschliesslich auf Zeugenaussagen angewiesen. Ist ein Zeuge schon nach allgemeiner Erfahrung nicht immer ein sicheres Beweismittel, so galt dies in diesem Prozess um so mehr, weil die Zeugen über Dinge aussagen mussten, die bereits 20 Jahre zurückliegen. Hinzu kommt, dass kaum Zeugen vorhanden waren, die als neutrale Beobachter die Vorfälle im KZ Auschwitz miterlebt haben. Die Zeugen, die als ehemalige Angehörige der Waffen-SS im KL Auschwitz tätig waren, waren fast ausnahmslos in das damalige Geschehen irgendwie verstrickt. Das führte dazu, dass sie in ihren Aussagen eine auffällige Zurückhaltung zeigten, Erinnerungslücken vorschützten und sich scheuten, die Angeklagten zu belasten, offensichtlich aus der Erwägung heraus, dass sie nach belastenden Aussagen selbst von den Angeklagten belastet werden könnten. Die Aussagen dieser Zeugen waren daher - von geringen Ausnahmen abgesehen - meist wenig ergiebig.
Bei einer Reihe dieser Zeugen war es sogar offensichtlich, dass sie die Unwahrheit sagten.
Das Gericht war daher bei der Erforschung der Wahrheit im wesentlichen auf die Aussagen der ehemaligen Häftlinge angewiesen. Wenn auch ein grosser Teil dieser Zeugen ernstlich bemüht war, ihr Gedächtnis zu erforschen und die reine Wahrheit zu sagen, so musste das Gericht jedoch berücksichtigen, dass viele mögliche Fehlerquellen den Wert und den Wahrheitsgehalt dieser Zeugenaussagen in Frage stellen konnten. Fast alle Zeugen haben ihre Beobachtungen in unsäglichem Leid, von Hunger gepeinigt und unter ständiger Angst um ihr eigenes Leben gemacht. Die Namen der SS-Angehörigen waren ihnen vielfach nicht bekannt. Im Lager wurde damals über die allgemeinen Geschehnisse und über die an Einzelvorfällen beteiligten SS-Angehörigen viel gesprochen. Gerüchte breiteten sich in Windeseile unter den Häftlingen aus. Sie vergröberten und verfälschten nicht selten manche Geschehnisse. Namen von beteiligten SS-Leuten wurden verwechselt.
Für die Zeugen war es nun ausserordentlich schwer, zu unterscheiden zwischen dem, was sie selbst persönlich erlebt hatten und dem, was ihnen von anderen berichtet worden war, sei es im Lager, sei es erst später nach der Befreiung. Es bedarf keiner Frage, dass die Gefahr bestand, dass Zeugen guten Glaubens Dinge als eigene Erlebnisse darstellten, die ihnen in Wirklichkeit von anderen berichtet worden waren oder die sie nach der Befreiung in Büchern und Zeitschriften, die sich mit den Geschehnissen in Auschwitz beschäftigten und in grosser Zahl vorhanden sind, gelesen hatten. Weiter musste berücksichtigt werden, dass nach 20 Jahren Erinnerungslücken auftreten konnten, die die Zeugen unbewusst ausfüllten. Vor allem bestand hierbei die Gefahr, dass Zeugen Vorfälle, die sie im KL Auschwitz selbst erlebt hatten, guten Glaubens auf andere Personen, insbesondere die in diesem Verfahren angeklagten früheren SS-Angehörigen projizierten. Das Schwurgericht hat diese Gefahr stets im Auge behalten und bei allen Zeugenaussagen, die konkrete Belastungen eines bestimmten Angeklagten enthielten, sorgfältig geprüft, ob nicht die Möglichkeit einer Verwechslung bestünde.
Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, dass die Zeugen - verständlicherweise - nur selten genaue Angaben über Ort und Zeitpunkt bestimmter Vorfälle machen konnten. Wenn es auch oft als eine Zumutung und Überforderung der Zeugen erschien, sie nach konkreten Einzelheiten ihrer Erlebnisse, nach dem Aussehen der an bestimmten Vorfällen beteiligten SS-Männer, nach dem Ort und der Zeit der Geschehnisse zu fragen und von ihnen eine genaue Beschreibung der Örtlichkeiten zu verlangen, so hielt dies das Schwurgericht zur Aufklärung der schweren Vorwürfe, die den Angeklagten gemacht werden, trotzdem für erforderlich, um die Gefahr von Verwechslungen und wahrheitswidrigen Angaben auszuschalten. Denn dem Gericht fehlten fast alle in einem normalen Mordprozess zur Verfügung stehenden Erkenntnismöglichkeiten, um sich ein getreues Bild des tatsächlichen Geschehens im Zeitpunkt des Mordes zu verschaffen. Es fehlten die Leichen der Opfer, Obduktionsprotokolle, Gutachten von Sachverständigen über die Ursache des Todes und die Todesstunde, es fehlten Spuren der Täter, Mordwaffen usw. Eine Überprüfung der Zeugenaussagen war nur in seltenen Fällen möglich.
Die Glaubwürdigkeit der Zeugen musste daher besonders sorgfältig geprüft werden. Wo geringste Zweifel bestanden oder die Möglichkeit von Verwechslungen nicht mit Sicherheit auszuschliessen war, hat das Gericht Aussagen von Zeugen nicht verwertet.
Von den Verteidigern wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die Zeugen gegen bestimmte Angeklagte ein Komplott geschmiedet und sich verabredet hätten, sie - wenn auch zu Unrecht - zu belasten. Auch sei - so wurde weiter behauptet - in unzulässiger Weise auf die Zeugen eingewirkt worden, gegen bestimmte Angeklagte belastende Aussagen zu machen. Auch das musste das Schwurgericht im Auge behalten. Allerdings haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass solche Verabredungen oder Beeinflussungen erfolgt sind. Soweit bei einzelnen Zeugen der Eindruck bestand, dass sie aus einer gewissen Geltungssucht oder sonstiger Veranlagung heraus zum Erzählen phantasievoller Geschichten neigten oder - aus nicht näher zu erforschenden Gründen - bestimmte Angeklagte zu Unrecht mit konkreten Vorfällen zu belasten schienen, hat das Gericht die Aussagen insgesamt nicht verwertet.
2. Beweisgrundlagen und Beweiswürdigung zu den allgemeinen Feststellungen über die Abwicklung der sog. RSHA-Transporte
Die allgemeinen Feststellungen über die Ankunft und Abwicklung von RSHA-Transporten auf der alten Rampe und später auf der neuen Rampe im Lager Birkenau, die Aufgaben und Tätigkeiten der verschiedenen zum Rampendienst eingeteilten SS-Angehörigen, die Täuschung der zum Tode bestimmten Menschen über ihr bevorstehendes Schicksal, die Einzelheiten über ihre Tötung in den verschiedenen Gaskammern, den Bau und die innere Einrichtung der Gaskammern und Krematorien, die Beseitigung der Leichen, die Aufgaben und Tätigkeiten des SS-Sonderkommandos bei den vier Krematorien und schliesslich die Arbeit des jüdischen Sonderkommandos beruhen auf den Einlassungen der Angeklagten Boger, St., Dylewski, Broad, Hofmann, Kaduk, Baretzki, Dr. L., Dr. Frank, Dr. Sc., Dr. Capesius und Klehr, soweit ihnen gefolgt werden konnte und den glaubhaften Aussagen der Zeugen O., Wal., Wil., N., Schl., Hu., Dr. M., To., Lei., H., Dr. Kremer, Ch. (die alle frühere SS-Angehörige im KL Auschwitz waren) sowie den glaubhaften Aussagen der Zeugen bzw. Zeuginnen Ka., Cou., Ja., van V., Vr., K. Erich, Pa., Sw., Bac., Buk., Bö., ferner auf den handschriftlichen Aufzeichnungen des ersten Lagerkommandanten Höss über die "Endlösung der Judenfrage", und dem sog. Broad-Bericht.
Die Angeklagten bestreiten nicht, dass unzählige jüdische Menschen mit RSHA-Transporten in den Jahren 1941-1944 nach Auschwitz zur Vernichtung gebracht, dort auf der Rampe dem geschilderten Ausmusterungsverfahren unterworfen und anschliessend, soweit sie nicht als arbeitsfähig ausgesondert und in das Lager aufgenommen worden sind, in den Gaskammern auf die geschilderte Art und Weise getötet worden sind. Sie bestreiten auch nicht, dass hierbei SS-Angehörige der verschiedenen Abteilungen mitgewirkt haben. Die Angeklagten, denen eine Mitwirkung an der Vernichtung dieser RSHA-Transporte zur Last gelegt wird, stellen nur in Abrede - was noch bei der Erörterung ihrer Straftaten im einzelnen darzustellen sein wird - entweder überhaupt etwas mit der Tötung dieser jüdischen Menschen zu tun gehabt zu haben (wie z.B. der Angeklagte Mulka) oder speziell an der Ausmusterung der Arbeitsfähigen auf der Rampe beteiligt gewesen zu sein. Soweit Angeklagte eine Mitwirkung einräumen, wird das bei der Erörterung ihrer Straftaten anzuführen sein.
3. Beweiswürdigung im Falle Mulka
Soweit der Angeklagte Mulka eine Mitwirkung bei der Tötung der sog. RSHA-Juden bestreitet und eine Kenntnis der genannten Dinge und Geschehnisse leugnet, ist seine Einlassung schon im Hinblick auf seine Stellung als Adjutant, die örtlichen Gegebenheiten und die allgemeinen Lagerverhältnisse in sich unglaubhaft. Sie ist aber auch durch die Beweisaufnahme in vielen Punkten widerlegt worden.
Zunächst hat die Beweisaufnahme ergeben, dass die Lagerkommandantur und nicht - wie der Angeklagte Mulka behauptet, die Politische Abteilung - für die Abwicklung der RSHA-Transporte zuständig gewesen ist. Der Angeklagte Boger hat erklärt, dass die Lagerkommandantur, die an sich in allen das Lager betreffenden Angelegenheiten dem Inspekteur der KL bzw. dem WVHA, nach dessen Errichtung, unterstand, bzgl. der RSHA-Transporte unmittelbar vom RSHA Befehle und Weisungen erhalten und ihm insoweit direkt unterstanden habe. Diese Einlassung des Angeklagten Boger, der sonst wenig zur Aufklärung des Geschehens im KL Auschwitz beigetragen hat, ist glaubhaft. Denn sie bestätigt die Angabe des ersten und inzwischen hingerichteten Lagerkommandanten Höss in seinen Aufzeichnungen. Danach ist Höss unmittelbar vom RFSS mit der Vernichtung der Juden beauftragt worden. Höss hat deswegen mit dem Leiter des Judenreferates im Amt IV des RSHA, Sturmbannführer Eichmann, unmittelbar verhandelt. Er hat Ende November 1941 in Berlin bei der Dienststelle Eichmann an einer Dienstbesprechung wegen der geplanten Judenaktionen teilgenommen.
Schon daraus ist der Schluss gerechtfertigt, dass für die Abwicklung der RSHA-Transporte nicht die Politische Abteilung, sondern der Lagerkommandant mit seinem Stab verantwortlich war und die Politische Abteilung dabei nur wie andere Abteilungen zu helfen hatte.
Es wäre auch unverständlich und würde jeder Erfahrung widersprechen, dass für eine so gross angelegte Aktion, wie es die Massenvernichtung von Hunderttausenden von Menschen in den Gaskammern von Auschwitz war, an der fast alle im Lager Auschwitz beschäftigten SS-Angehörigen mitwirken mussten, die Leitung des Lagers nicht eingeschaltet gewesen sein sollte - man vielmehr die organisatorische Durchführung der Aktionen einer kleinen Dienststelle, an deren Spitze nur ein SS-Untersturmführer stand, überlassen hätte. Für die Politische Abteilung wäre eine organisatorische Durchführung auch kaum möglich gewesen, weil sie nicht die Befehlsgewalt über die anderen Abteilungen (z.B. die Schutzhaftlagerführung) hatte, somit ihnen keine Einsatzbefehle für die Mitwirkung an der Massenvernichtung hätte erteilen können.
Darüber hinaus ist noch durch einige Zeugen bestätigt worden, dass die Lagerkommandantur und nicht die Politische Abteilung die einzelnen Abteilungen des Lagers von der Ankunft von RSHA-Transporten benachrichtigt hat. So hat der Zeuge O., der in Auschwitz SS-Stabsscharführer und Spiess beim Standortarzt gewesen ist, eindeutig erklärt, dass die Dienststelle des Standortarztes von der Kommandantur über die Ankunft eines RSHA-Transportes benachrichtigt worden sei. Allerdings wollte der Zeuge nicht mehr wissen, wer jeweils der Anrufer gewesen sei. Offensichtlich hat sich der Zeuge gescheut, einen der Angeklagten zu belasten.
Der Zeuge Wil., der in Auschwitz SS-Rechnungsführer bei der Dienststelle des Standortarztes gewesen ist, konnte sich zwar nicht mehr mit Sicherheit erinnern, von wem die Mitteilungen über die Ankunft von RSHA-Transporten gekommen sind, meinte aber, dass sie von der Lagerkommandantur gekommen sein müssten. Der Zeuge N., ebenfalls ein SS-Unterführer im KL Auschwitz, wurde im Jahre 1943 Spiess beim Kommandanturstab. Er hat ebenfalls eindeutig erklärt, dass die Kommandantur die anderen Abteilungen (Schutzhaftlagerführung, Politische Abteilung, Standortarzt usw.) von der Ankunft der RSHA-Transporte verständigt habe. Allerdings wollte er sich ebenfalls nicht mehr erinnern können, ob auch der Angeklagte Mulka, der noch kurze Zeit sein Vorgesetzter gewesen ist, persönlich die Abteilungen benachrichtigt hat. Offenbar hat auch er sich gescheut, den Angeklagten Mulka direkt zu belasten. Er meinte aber, Mulka müsse als Adjutant die Einsatzbefehle an die einzelnen Abteilungen bei der Ankunft von RSHA-Transporten gegeben haben.
Schliesslich hat noch der Zeuge Wal., der im Jahre 1944 Spiess beim Kommandanturstab gewesen ist, geschildert, dass er selbst dabeigestanden habe, als der Adjutant Höcker die einzelnen Abteilungen von der Ankunft von RSHA-Transporten telefonisch benachrichtigt habe. Die Aussage des Zeugen bezieht sich zwar auf eine spätere Zeit, als der Angeklagte Mulka nicht mehr in Auschwitz gewesen ist, sie bestätigt aber mittelbar die getroffenen Feststellungen. Denn wenn im Jahre 1944 die Lagerkommandantur für die Abwicklung der RSHA-Transporte zuständig gewesen ist, so ist der Schluss gerechtfertigt, dass es in dem Jahre 1942 und 1943 ebenso gewesen ist.
Das Gericht hat den Zeugen N., O., Wil. und Wal. die hier wiedergegebenen Angaben geglaubt. Die Zeugen waren in ihren Aussagen sehr zurückhaltend. Sie waren offensichtlich bestrebt, die Angeklagten zu schonen. Das Gericht hatte den Eindruck, dass sie nicht alles, was sie über die damalige Zeit in Auschwitz, insbesondere den Angeklagten Mulka wussten, ausgesagt haben. Dabei mag die Erwägung eine Rolle gespielt haben, dass sie, wenn sie die Angeklagten belasteten, von diesen umgekehrt wegen ihrer Tätigkeit in Auschwitz belastet werden könnten. Es ist daher kein vernünftiger Grund ersichtlich, warum sie über die Verantwortlichkeit und Zuständigkeit für die Abwicklung der RSHA-Transporte für die Angeklagten ungünstige Angaben gemacht haben sollten. Für die Zeugen N. und Wal. gilt dies um so mehr, weil sie sich als Angehörige des Kommandanturstabes mit ihren Angaben indirekt selbst belastet haben. Wenn tatsächlich die Politische Abteilung nach Ankunft von RSHA-Transporten für die Benachrichtigung der anderen Abteilungen und die gesamte Abwicklung des Transportes zuständig gewesen wäre, hätten gerade diese Zeugen das grösste Interesse daran haben müssen, das hervorzuheben.
Auf die Glaubwürdigkeit des Zeugen Wal., die besonders von den Verteidigern des Angeklagten Höcker in Zweifel gezogen worden ist, wird noch bei der Beweiswürdigung im Rahmen der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Höcker zurückzukommen sein.
Die Behauptung des Angeklagten Mulka, er habe in den drei bis vier Fällen die Fernschreiben des RSHA mit der Ankündigung von Judentransporten nur an die Politische Abteilung zur weiteren Veranlassung weitergeleitet, ist daher nicht glaubhaft. Das Schwurgericht ist vielmehr nach der gesamten Sachlage, wie sie sich aus den Aufzeichnungen des früheren Lagerkommandanten Höss, der oben wiedergegebenen Einlassung des Angeklagten Boger und den Aussagen der genannten Zeugen ergibt, überzeugt, dass der Angeklagte Mulka mindestens in diesen drei Fällen die verschiedenen Abteilungen des Lagers über die Ankunft der RSHA-Transporte benachrichtigt und die entsprechenden Einsatzbefehle gegeben hat.
Erwiesen ist ferner, dass Mulka - entgegen seiner Einlassung - bei der Abwicklung von RSHA-Transporten wiederholt auf der Rampe gewesen ist. Mindestens in einem Fall war er der ranghöchste SS-Führer auf der Rampe.
Der Lagerkommandant Höss schildert in seinen autobiographischen Aufzeichnungen glaubhaft, dass er selbst häufig bei der Ankunft von RSHA-Transporten zur Rampe gefahren ist und dort die gesamte Vernichtungsaktion überwacht hat. Er hielt dies für erforderlich, um - wie er sich ausdrückt - "die beteiligten SS-Angehörigen zum psychischen Durchhalten zu zwingen". Aus dem gleichen Grunde zeigte er sich auch bei den Gaskammern, sah durch das Guckloch in den Gasraum, wenn die eingeschlossenen Menschen mit dem Tode rangen, und war auch beim Verbrennen der Leichen dabei, als sie noch in den Gräben verbrannt wurden.
Es erscheint daher schon nach der Lebenserfahrung wahrscheinlich, dass der Angeklagte Mulka als Adjutant den Lagerkommandanten, dessen engster Vertrauter er sein sollte, zu den Aktionen, zumindest ab und zu, begleitet hat. Ferner erscheint es wahrscheinlich, dass Höss, der ersichtlich grossen Wert auf die psychische Stärkung der mit den furchtbaren Vernichtungsaktionen befassten SS-Angehörigen legte und sie zum eisernen Durchhalten zwingen wollte, seinen Adjutanten dann zur Erfüllung dieser Aufgaben auf die Rampe beorderte, wenn er selbst aus irgendwelchen Gründen daran verhindert war. Dabei muss weiter in Betracht gezogen werden, dass Höss mit aller Wahrscheinlichkeit auch von seinem Adjutanten als seinem engsten Mitarbeiter und nächsten Vertrauten noch eher als von seinen anderen Untergebenen "Härte" und "eisernes Durchhalten" bei den Vernichtungsaktionen und "gutes Beispiel" für die Untergebenen hierbei verlangte.
Abgesehen von diesen allgemeinen Erwägungen ist durch eindeutige und klare Angaben des Angeklagten Kaduk bei seiner Vernehmung in der gerichtlichen Voruntersuchung und durch Zeugenaussagen erwiesen, dass der Angeklagte Mulka - entgegen seiner Behauptung - bei der Abwicklung der RSHA-Transporte auf der Rampe gewesen ist. Die vorangestellten allgemeinen Erwägungen unterstützen diese Angaben.
Wie der Zeuge Rei. glaubhaft geschildert hat, wurde ihm der Angeklagte Kaduk bei seiner - des Zeugen - Vernehmung durch den Untersuchungsrichter während der gerichtlichen Voruntersuchung gegenübergestellt. Im Anschluss an die Gegenüberstellung erklärte der Angeklagte Kaduk gegenüber dem Untersuchungsrichter im Beisein des Zeugen, dass er auch den Angeklagten Mulka auf der Rampe gesehen habe. Er erinnere sich mit Sicherheit daran, dass Mulka nach Ankunft von Transporten auf der Rampe gewesen sei. In grosser Erregung äusserte dann Kaduk laut: "Die Herren sollen doch heute nicht leugnen, sie sollen als Männer zu dem stehen, was tatsächlich geschehen ist."
Die Herren, nämlich Höss, Baer, der letzte Lagerkommandant, und Mulka, seien mit Kübelwagen rausgefahren. Sie seien an den Selektionsvorgängen vorbeigegangen und hätten die Abwicklung beobachtet. Praktisch hätten sie die Oberaufsicht geführt.
Nach der glaubhaften Aussage des Zeugen Rei. bestehen keine Zweifel, dass der Angeklagte Kaduk dem Untersuchungsrichter gegenüber diese Äusserung gemacht hat. Kaduk hat dies in der Hauptverhandlung auch nicht in Abrede gestellt. Allerdings hat der Angeklagte Kaduk seine gegenüber dem Untersuchungsrichter gemachten Angaben in der Hauptverhandlung nicht wiederholt. Zunächst hat er in der Hauptverhandlung jede Einlassung zur Sache überhaupt verweigert. Später hat er verschiedentlich Ansätze gemacht, sich über das Geschehen in Auschwitz und die Mitwirkung der Angeklagten auszulassen, konnte sich aber nie über allgemeines Gerede hinaus zu einer klaren und eindeutigen Aussage durchringen. Auf gestellte Fragen nach der Tätigkeit von einzelnen Mitangeklagten, insbesondere auf Fragen, wer auf der Rampe gewesen sei, hat er entweder die Antwort strikt verweigert oder mangelnde Erinnerung vorgeschützt. Das Schwurgericht ist überzeugt, dass die Angaben des Angeklagten Kaduk gegenüber dem Untersuchungsrichter, soweit er den Angeklagten Mulka belastet hat, der Wahrheit entsprechen.
Die Möglichkeit, dass Kaduk den Angeklagten Mulka gegenüber dem Untersuchungsrichter bewusst der Wahrheit zuwider belastet haben könnte, hat das Schwurgericht zwar erwogen, ist jedoch der Überzeugung, dass Kaduk den Angeklagten Mulka nicht zu Unrecht belastet hat.
Das Verhalten der Angeklagten in der Hauptverhandlung hat gezeigt, dass sie von einem falsch verstandenen Gefühl der Kameradschaft und Solidarität durchdrungen sind. Jeder hat es ängstlich vermieden, andere Mitangeklagten in irgendeiner Weise zu belasten. Auch der Angeklagte Kaduk, der als Block- und Rapportführer im Stammlager genaue Kenntnis von den Vorgängen im Lager und den Handlungen der Mitangeklagten gehabt haben muss, hat sich an diese stillschweigende Übereinkunft der Angeklagten gehalten. Er hat zur Aufklärung des Geschehens im KL Auschwitz kaum etwas beigetragen. Es ist kein Grund ersichtlich, warum er in der Voruntersuchung, entgegen dieser in der Hauptverhandlung gezeigten falsch verstandenen Kameradschaft und Solidarität Mulka wahrheitswidrig belastet haben sollte. Hass oder Rache scheiden aus. Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass im KL Auschwitz oder später zwischen Mulka und Kaduk irgendwelche Differenzen bestanden haben. Zudem hätte es nahegelegen, dass Kaduk, wenn ihn Rache- oder Hassgefühle gegen Mulka beherrscht hätten, seine früheren gegenüber dem Untersuchungsrichter gemachten Angaben in der Hauptverhandlung wiederholt hätte. Seine spontanen Äusserungen vor dem Untersuchungsrichter, die gegen die später gezeigte Kameradschaft und Solidarität zu verstossen scheinen, sind zwanglos daraus zu erklären, dass Kaduk ehrlich darüber empört war, dass Mulka als früherer SS-Führer und Adjutant feige jegliche Beteiligung am Geschehen in Auschwitz leugnete und irgendeine Verantwortlichkeit völlig verneinte. Diese vorübergehende und verständliche Empörung veranlasste ihn, die Dinge wenigstens in einigen Punkten richtigzustellen.
Die Angaben Kaduks werden ausser durch die vorangestellten allgemeinen Erwägungen durch weitere Zeugenaussagen gestützt: Der Zeuge Wilh., der im KL Auschwitz als SS-Angehöriger Schreiber in der Dienststelle des Standortarztes gewesen ist, hat Mulka zwar nicht selbst auf der Rampe bei der Abwicklung von RSHA-Transporten gesehen. Ihm ist aber - wie er glaubhaft ausgesagt hat - damals im KL Auschwitz von dem Leiter der Politischen Abteilung, dem inzwischen hingerichteten SS-Untersturmführer Grabner erzählt worden, dass Mulka bei Vergasungsaktionen dabei gewesen sei. Warum Grabner bereits damals dem Zeugen etwas Falsches berichtet haben sollte, ist nicht ersichtlich. Seine damaligen gegenüber dem Zeugen Wilh. gemachten Angaben unterstützen daher die Aussage des Angeklagten Kaduk vor dem Untersuchungsrichter.
Schliesslich hat ein früherer Häftling, der Zeuge Vr. aus London, bekundet, dass er den Angeklagten Mulka öfters auf der Rampe gesehen habe, wenn RSHA-Transporte angekommen seien. Der Zeuge gehörte damals - wie er glaubhaft bekundet hat - zu dem Häftlingskommando, das die Gepäckstücke der angekommenen Juden aus den Eisenbahnwagen zu holen und auf die LKWs zu laden hatte. Auch musste er mit anderen Häftlingen des Sonderkommandos die Leichen der auf der Fahrt verstorbenen Menschen aus den Wagen schaffen. Aus diesem Grunde war er sehr oft während der Abwicklung von RSHA-Transporten auf der Rampe. Der Zeuge kannte den Angeklagten Mulka damals nicht mit Namen. Er hat ihn aber in der Hauptverhandlung wiedererkannt. Er konnte sich noch gut daran erinnern, dass er ihn als SS-Führer in Offiziersuniform und in Offiziersmantel mit weissem Pelzkragen öfters auf der Rampe bemerkt hat, wenn Transporte ausgeladen worden sind.
Das Gericht war sich darüber im klaren, wie problematisch ein Wiedererkennen nach über zwanzig Jahren ist. Die Möglichkeit einer Verwechslung mit einem anderen SS-Führer war ernstlich in Betracht zu ziehen. Hier scheidet aber nach der Überzeugung des Gerichts eine Verwechslung aus. Der Angeklagte Mulka hat ein markantes Gesicht mit einer charakteristisch gebogenen Nase. Er war damals bereits 47 oder 48 Jahre alt. In der Zwischenzeit sind seine Gesichtszüge zwar gealtert, haben sich aber gegenüber damals kaum verändert. Hiervon konnte sich das Gericht durch Vergleich seines heutigen Aussehens mit Fotografien des Angeklagten Mulka aus der damaligen Zeit, die in der Hauptverhandlung in Augenschein genommen worden sind, überzeugen. Die hohe Gestalt des Angeklagten Mulka in SS-Führeruniform war damals für die Häftlinge in Auschwitz - auch für den Zeugen Vr. - eine auffällige Erscheinung. Es waren zwar stets mehrere SS-Führer auf der Rampe, ihre Anzahl war aber im Vergleich zu den SS-Angehörigen in Unterführer- und Mannschaftsuniform relativ gering.
Der Zeuge Vr., der in der Hauptverhandlung einen ausgezeichneten und intelligenten Eindruck gemacht hat, hat mit wachen und scharfen Augen die Vorgänge auf der Rampe und im Lager damals beobachtet. Er hatte hierfür einen besonderen Grund: Er hat Fluchtmöglichkeiten erkundet, weil er fliehen wollte und er hat alles Geschehen und alle Vorfälle besonders sorgfältig und genau beobachtet, weil er nach gelungener Flucht der Aussenwelt über die Dinge in Auschwitz berichten wollte. Ihm ist später auch die Flucht gelungen und er hat in der Freiheit einen Bericht über das KL Auschwitz geschrieben, den er durch mehrfache Vermittlung dem Vatikan hat zukommen lassen.
Der Zeuge Vr. hat den Angeklagten Mulka somit nicht nur auf Grund eines einmaligen früheren Sehens wiedererkannt, sondern auf Grund scharfer Beobachtungen während eines längeren Zeitraumes. Er musste bei der Abwicklung vieler RSHA-Transporte Gepäckstücke zu den LKWs schleppen. Dabei kam er immer wieder an der Gruppe der SS-Führer vorbei. Er konnte sich daher immer wieder deren Aussehen einprägen und ihr Verhalten beobachten. Es ist daher nicht ungewöhnlich, dass der Zeuge Vr. den Angeklagten Mulka wiedererkannt hat.
Es kommt aber noch ein weiteres wichtiges Ereignis hinzu: Dem Zeugen Vr. hat sich damals das Bild eines SS-Führers besonders tief eingeprägt und zwar aus einem besonderen Grund: Er beobachtete einmal, wie zwei SS-Unterführer zu einem SS-Führer auf der Rampe einen Häftling brachten mit der Meldung,
dass dieser (die Unterführer nannten den Häftling "Schwein") mit Zugängen gesprochen habe. Der Führer sagte daraufhin - was der Zeuge Vr. hören konnte -: "Macht ihn fertig, es ist schon spät!" Danach schlugen die beiden SS-Unterführer den Häftling mit Knüppeln, bis er tot war. Ein solches schreckliches Erlebnis und die daran beteiligten Personen prägen sich erfahrungsgemäss tief in das Gedächtnis ein. Der Zeuge Vr. hat in der Hauptverhandlung mit aller Bestimmtheit den Angeklagten als den SS-Führer bezeichnet, der damals das Totschlagen des Häftlings angeordnet hat. Schliesslich hat der Zeuge Vr., nachdem ihm ein Ganzfoto des Angeklagten Mulka in Uniform aus der damaligen Zeit vorgelegt worden war, mit Bestimmtheit erklärt, dass der abgebildete SS-Führer identisch sei mit dem Führer, der damals das "Fertigmachen" des Häftlings befohlen und den er öfters auf der Rampe gesehen habe.
Dagegen hat er nach Betrachten einer Fotografie des SS-Führers Müller in Uniform aus der damaligen Zeit, die dem Zeugen gleichzeitig mit dem Foto des Angeklagten Mulka vorgelegt worden ist, erklärt, dass der abgebildete SS-Führer nicht derjenige sei, den er damals auf der Rampe gesehen habe.
Aus alledem hat das Schwurgericht die Überzeugung gewonnen, dass Vr. zutreffend den Angeklagten Mulka wiedererkannt hat und dass eine Verwechslung mit anderen Personen ausscheidet. Es besteht auch kein Anlass, an der Richtigkeit der Darstellung des Zeugen Vr. zu zweifeln. Der Zeuge hat einen glaubwürdigen Eindruck hinterlassen. Er hat seine Aussage leidenschaftslos, ruhig und frei von Hass- und Rachegefühlen gemacht. Irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass er Mulka wider besseres Wissen belasten wollte, liegen nicht vor. Seiner Aussage, die er mit dem Eid bekräftigt hat, hat das Gericht daher vollen Glauben geschenkt. Das Gericht sieht daher auch als erwiesen an, dass der Angeklagte Mulka in der von dem Zeugen geschilderten Weise die Tötung des Häftlings angeordnet hat. Die Tatsache, dass die beiden SS-Unterführer den Häftling, der sich - im Sinne der SS - eines schweren Vergehens schuldig gemacht hatte, zu dem Angeklagten Mulka und nicht etwa zu einem anderen SS-Führer (etwa dem diensthabenden Führer) gebracht haben, spricht ferner eindeutig dafür, dass Mulka in dieser Nacht der ranghöchste SS-Führer auf der Rampe gewesen ist. Wäre ausser Mulka noch der Lagerkommandant anwesend gewesen, hätten die SS-Unterführer in einer so wichtigen Angelegenheit ohne Zweifel dessen Entscheidung eingeholt, zumindest hätte Mulka die SS-Unterführer an den Lagerkommandanten zur Entscheidung des Falles verwiesen. Aus dem Umstand, dass er selbständig die Entscheidung getroffen hat, hat das Schwurgericht die Überzeugung gewonnen, dass er in dieser Nacht als ranghöchster SS-Führer die Oberaufsicht über die gesamte Abwicklung des RSHA-Transportes übernommen hat.
Die Beweisaufnahme hat ferner ergeben, dass dem Angeklagten Mulka als Adjutanten die Fahrbereitschaft unterstanden hat und er für den Einsatz der Fahrzeuge verantwortlich war. Zunächst bestimmte die für das KL Auschwitz gültige - oben bereits erwähnte - Lagerordnung ausdrücklich, dass die Fahrbereitschaft dem Adjutanten unterstehe und dass der Adjutant für die ordnungsgemässe Handhabung und Ausstellung der Fahrbefehle verantwortlich sei.
Die praktische Regelung im KL Auschwitz entsprach dieser Bestimmung der Lagerordnung auch in der Zeit, während der der Angeklagte Mulka Adjutant war.
So hat der Zeuge Heg., der im KL Auschwitz im Rang eines SS-Unterführers als Fahrer des Lagerkommandanten Höss und dann als Stellvertreter des Leiters der Fahrbereitschaft eingesetzt war, glaubhaft bekundet, dass die Fahrbefehle von dem Kommandanten oder dem Adjutanten unterzeichnet worden seien. Auch Mulka habe Fahrbefehle unterzeichnet. Für den Einsatz der LKWs im Rampendienst habe es allerdings keiner schriftlichen Fahrbefehle bedurft. Ihr Einsatz sei aber mündlich angeordnet worden. Diese mündlichen Befehle seien von der "Kommandantur" erteilt worden, entweder vom Lagerkommandanten selbst oder dem Adjutanten. Für die Transporte von der Rampe zu den Gaskammern seien stets besondere Fahrzeuge, etwa sieben oder acht Wagen, bereitgehalten worden. Wenn sie gebraucht worden seien, seien sie von der Kommandantur angefordert worden.
Die Frage, ob der Angeklagte Mulka auch solche mündlichen Einsatzbefehle gegeben habe, hat der Zeuge nicht klar beantwortet. Er konnte sich angeblich nicht mehr an einen bestimmten Fall erinnern. Offensichtlich scheute sich der Zeuge, wie andere Zeugen auch, den Angeklagten Mulka zu belasten. Er selbst will von Mulka keine mündlichen Fahrbefehle bekommen haben. Er meinte aber, dass Mulka als Adjutant solche Fahrbefehle erteilt haben müsse, da kein Fahrzeug ohne Befehl die Halle hätte verlassen dürfen.
Zieht man in Betracht, dass der Zeuge Heg., der nur sehr zögernd und mit aller Zurückhaltung seine Aussage gemacht hat, den Angeklagten Mulka offensichtlich schonen wollte, so sprechen seine Angaben dafür, dass der Angeklagte Mulka als Adjutant - entsprechend der in der Lagerordnung vorgesehenen Regelung - tatsächlich für die Fahrbereitschaft verantwortlich war.
Auch der Zeuge Si., der ebenso wie der Zeuge Heg. bei seiner Vernehmung sehr zögernd und zurückhaltend war, hat angegeben, dass der Adjutant grundsätzlich die Fahrbefehle für Fahrten nach ausserhalb des Lagerbereiches zu unterschreiben hatte. Der Zeuge war im KL Auschwitz zunächst als SS-Kraftfahrer und dann später als stellvertretender und schliesslich ab 1943 als erster Werkstattleiter in der Pragahalle eingesetzt. Schliesslich ergibt sich aus Urkunden, dass Kraftfahrzeuganforderungen von SS-Dienststellen im Kommandanturbereich an den Adjutanten zu richten waren und dass dieser die Fahrten nach ausserhalb zu genehmigen hatte. So enthält z.B. eine Urkunde vom 29.7.1942, die verlesen worden ist, eine Kraftfahrzeuganforderung. Die Urkunde enthält den Genehmigungsvermerk des Angeklagten Mulka. Mulka hat anerkannt, dass das Namenszeichen von ihm stamme und dass er die Fahrt eines 4 bis 5 t LKWs für die Beförderung von Fleisch erteilt habe.
Aus der Tatsache, dass der Adjutant Mulka Kraftfahrzeuganforderungen aller Abteilungen und Dienststellen, nicht nur solche des engeren Kommandanturstabes, zu genehmigen hatte, folgt ebenfalls, dass er für die Fahrbereitschaft und den Einsatz der Kraftfahrzeuge zuständig und verantwortlich war.
Der Angeklagte Mulka hat auch in mindestens einem Fall bei der Beschaffung von Zyklon B mitgewirkt. Aus dem oben zitierten Funkspruch vom 2.10.1942 ergibt sich zwar nicht, wer die Genehmigung für die Fahrt zur Abholung des Zyklon B beim WVHA beantragt hat. Aus dem Funkspruch ergibt sich nur, dass ein solcher Antrag gestellt worden ist, da der Funkspruch auf einen solchen Antrag Bezug nimmt. Das Gericht hat aber keinen Zweifel, dass Mulka als Adjutant den Antrag gestellt hat. Denn nach der bereits mehrfach erwähnten Lagerordnung hatte der Adjutant den gesamten Schriftverkehr mit aussenstehenden Dienststellen zu bearbeiten. Ferner war er - wie sich aus den obigen Ausführungen ergibt - für die Fahrbereitschaft und den Einsatz der LKWs verantwortlich. Aus dieser Funktion ergibt sich dann weiter zwangsläufig, dass er für Fahrten, die über eine bestimmte Entfernung hinausgingen, und für die er nicht befugt war, Fahrbefehle auszustellen, die Genehmigung der übergeordneten Dienststelle einzuholen hatte. Es ergibt sich weiter daraus, dass er nach Erteilung der Genehmigung den Einsatz des LKWs für die Fahrt zu befehlen hatte. Das Schwurgericht ist daher überzeugt, dass er, nachdem er die Richtigkeit der Abschrift des Funkspruchs bescheinigt hatte, die beglaubigte Abschrift der Genehmigung an die Fahrbereitschaft zur Abholung des Zyklon B weitergegeben hat. Dass das Zyklon B auch tatsächlich von Dresden abgeholt worden ist, hat Mulka nicht in Abrede gestellt. Er hat auch - wie schon ausgeführt - eingeräumt, dass er gewusst hat, dass mit dem Ausdruck "Materialien" Zyklon B gemeint war und dass es für die Tötung von RSHA-Juden Verwendung finden sollte.
Schliesslich ist auf Grund der Aussage des Zeugen Se. erwiesen, dass der Angeklagte Mulka bei den DAW nach der Fertigstellung von gasdichten Türen gefragt und auf deren Fertigstellung gedrängt hat. Der Zeuge war als Häftling im Betriebsbüro der DAW tätig. Dabei erfuhr er - wie er glaubhaft bekundet hat -, dass die DAW gasdichte Türen und Fenster für die Krematorien III und II herzustellen hatte. Der Zeuge hat auch Schriftwechsel darüber gelesen.
Seine Aussage wird bestätigt durch ein Schreiben der Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei in Auschwitz vom 31.3.1943, dass die DAW für die Zentralbauleitung auf Grund eines Auftrages vom 18.1.1943 drei gasdichte Türen und nach einem Auftrag vom 6.3.1943 eine Gastür mit Guckloch aus doppeltem Glas mit Gummidichtung für die Gaskammern herzustellen hatten. Der Zeuge Se. hat den Angeklagten Mulka gekannt. Er hat ihn wiederholt gesehen, wenn er in das Büro der DAW gekommen ist. Dabei hat er gehört, dass Mulka nach der Erledigung der Aufträge gefragt und auf deren Erledigung gedrängt hat.
Die Aussage des Zeugen, gegen dessen Zuverlässigkeit in anderer Hinsicht gewisse Bedenken bestehen, ist insoweit glaubhaft. Denn Mulka hat eingeräumt, dass er Sachbearbeiter beim DAW gewesen sei. Es liegt daher nahe, dass er sich auch im die Erledigung von wichtigen Aufträgen persönlich gekümmert hat. Die Errichtung der Krematorien und die Lieferung der für die Krematorien erforderlichen Teile war für die SS eine äusserst wichtige Angelegenheit, weil immer häufiger RSHA-Transporte ankamen und die Kapazität der vorhandenen Gaskammern in den umgebauten Bauernhäusern nicht mehr ausreichte.
Dass Mulka als Adjutant über die Einzelheiten der massenweisen Vernichtung der RSHA-Juden in den Gaskammern genau Bescheid gewusst haben muss, kann nach der ganzen Sachlage nicht zweifelhaft sein. Dies ergibt sich schon aus seiner Funktion als Adjutant. Als nächster Mitarbeiter und Vertrauter des Lagerkommandanten, dem der Auftrag für diese Aktion erteilt worden war, muss er davon zwangsläufig erfahren haben. Darüber hinaus hat er - wie im einzelnen dargelegt worden ist - bei der Abwicklung der RSHA-Transporte auch selbst mitgewirkt. Auf der Rampe musste er das ganze Geschehen aus eigener Anschauung mit erleben.
Es war nicht möglich, die Anzahl der Transporte, an deren Abwicklung der Angeklagte Mulka mitgewirkt hat, und die Zahl der Opfer an deren Tötung der Angeklagte Mulka beteiligt gewesen ist, exakt zu ermitteln. Das Schwurgericht hat sich daher, da es unsichere Schätzungen dem Urteil nicht zugrunde legen durfte, auf die Feststellung von Mindestzahlen, die mit jeden Zweifel ausschliessender Sicherheit getroffen werden konnten, beschränkt. Mit Sicherheit hat der Angeklagte - wie im einzelnen dargelegt - bei drei verschiedenen RSHA-Transporten die einzelnen Abteilungen des Lagers benachrichtigt und die Einsatzbefehle für die zum Rampendienst eingeteilten SS-Angehörigen gegeben. Er war ferner mit Sicherheit mindestens zweimal bei der Abwicklung von RSHA-Transporten auf der Rampe anwesend. Denn sowohl der Zeuge Vr. als auch der Angeklagte Kaduk haben ihn öfters, also mehr als einmal auf der Rampe bei solchen Gelegenheiten gesehen. Indiesen beiden Fällen kann Mulka jedoch schon vorher die einzelnen Abteilungen benachrichtigt und die Einsatzbefehle gegeben haben, so dass mit Sicherheit nur eine Mitwirkung bei insgesamt drei verschiedenen RSHA-Transporten festgestellt werden konnte.
Hinzu kommen seine Bemühungen um die Beschaffung von Zyklon B und die Fertigstellung gasdichter Türen für die neuen Krematorien. Insoweit konnte mit Sicherheit nur festgestellt werden, dass diese Tätigkeiten zur Vernichtung von mindestens einem weiteren RSHA-Transport beigetragen haben. Die grosse Menge des Zyklon B, die mit einem 5 t LKW mit Anhänger von Dresden abgeholt worden ist, hat mit Sicherheit ausgereicht, um mehr als drei Transporte, also mindestens noch einen weiteren Transport zu vernichten. Ebenso ermöglichten die gasdichten Türen nach ihrem Einbau in die Gaskammern und deren Inbetriebnahme zusammen mit den anderen technischen Einrichtungen der Gaskammern die Tötung einer Vielzahl von RSHA-Transporten, also mindestens von einem. Da jedoch nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass gerade das Zyklon B, das unter Mitwirkung des Angeklagten Mulka herbeigeschafft worden ist, in den Gaskammern verwendet worden ist, in die die gasdichten Türen eingebaut worden sind, konnte mit Sicherheit nur festgestellt werden, dass Mulka zur Vernichtung mindestens eines weiteren RSHA-Transportes beigetragen hat.
Somit konnte mit Sicherheit nur festgestellt werden, dass der Angeklagte Mulka durch die geschilderten Handlungen an der Vernichtung von mindestens vier RSHA-Transporten beteiligt war.
Im Jahre 1942 und in der ersten Zeit des Jahres 1943 schwankte die Stärke der RSHA-Transporte zwischen 1000 und 2000 Personen. Dies ergibt sich aus den Einlassungen der Angeklagten, soweit ihnen gefolgt werden konnte und den Aussagen der Zeugen Philipp Mü., Kag., Wa., Lak. und Vr. Mit den kleinsten Transporten wurden somit mindestens 1000 Menschen nach Auschwitz deportiert. Diese Mindeststärke hat das Schwurgericht der Feststellung der unter der Mitwirkung des Angeklagten Mulka getöteten Opfer zugrunde gelegt. Von ihr war die Zahl derjenigen jüdischen Menschen abzuziehen, die als arbeitsfähig ausgesondert und in das Lager aufgenommen worden sind. Es waren zwischen 10 und 15%, in seltenen Fällen mehr, jedoch nie über 25%. Das ergibt sich ebenfalls aus den Einlassungen der Angeklagten, dem Broad-Bericht, der von 10 bis 15% spricht und den Aussagen einer Vielzahl von Zeugen. Das Schwurgericht ist, um ganz sicher zu gehen, zu Gunsten des Angeklagten Mulka davon ausgegangen, dass bei den vier RSHA-Transporten, an deren Vernichtung er beteiligt war, je 25% also 250 Menschen als arbeitsfähig ausgesondert und in das Lager aufgenommen worden sind. Somit ergibt sich die Feststellung, dass er an der Tötung von je 750 Menschen je Transport, somit an der Tötung von insgesamt 3000 Menschen beteiligt war.
V. Rechtliche Würdigung
1. Taten und Strafbarkeit der Haupttäter
Haupttäter der unter II. geschilderten Vernichtungsaktionen waren Hitler als Urheber des Befehls über "die Endlösung der Judenfrage" und Himmler, der diesen Befehl zu seinem eigenen Anliegen gemacht und mit fanatischem Eifer seine Ausführung betrieben hat, sowie weitere Personen des engsten Führungskreises wie Göring, Heydrich und andere, deren Feststellung im einzelnen nicht Aufgabe des Schwurgerichts war. Die Haupttäter haben die Tötungen der jüdischen Menschen im Rahmen der sog. "Endlösung der Judenfrage" geplant, die organisatorischen Voraussetzungen hierfür geschaffen und ihre Durchführung angeordnet.
Die Verwirklichung ihres Vernichtungsprogramms haben sie durch das Reichssicherheitshauptamt, insbesondere durch dessen Amt IV und die dem RSHA nachgeordneten Gestapostellen unter Mitwirkung sonstiger Dienststellen der Polizei und SS und einiger Dienststellen des Reiches und der Reichsbahn, deren Hilfe notwendig war, sowie vieler SS-Angehöriger, die in den Vernichtungslagern an den Tötungsaktionen teilzunehmen hatten, ausführen lassen.
Ihre, d.h. der Haupttäter Handlungsweise erfüllt den Tatbestand des Mordes nach §211 alter Fassung, soweit Juden im Rahmen der Endlösung der Judenfrage vor dem 11.9.1941 (dem Tag, an dem die Neufassung des §211 auf Grund des Gesetzes vom 4.9.1941 in Kraft trat - eine Woche nach Verkündigung dieses Gesetzes -) getötet worden sind, weil die Haupttäter mit Überlegung gehandelt haben, was bei der planmässigen Durchführung der Aktionen keiner weiteren Begründung bedarf. Die nach dem 11.9.1941 durchgeführten Vernichtungsaktionen erfüllen den Tatbestand des Mordes nach §211 StGB in der Fassung des Gesetzes vom 4.9.1941. Denn sie erfolgten aus niedrigen Beweggründen. Niedrig sind Beweggründe dann, wenn das Handeln des Täters von Vorstellungen bestimmt war, die nach gesundem Empfinden sittlich verachtenswert sind (vergleiche Schönke-Schröder, Kommentar zum Strafgesetzbuch 11.Auflage Anm.11 zu §211). Die Tötungen der unschuldigen jüdischen Menschen haben die Haupttäter aus Rassenhass angeordnet und durchführen lassen. In ihrer Verblendung und ihrem Rassenwahn haben sie den jüdischen Menschen, nur weil sie ihnen wegen ihrer Abstammung als Angehörige einer sog. "minderwertigen Rasse" missliebig waren, jeden Menschenwert abgesprochen und ihnen kein Lebensrecht zuerkannt. Sie haben ihnen deswegen erbarmungslos ohne die geringsten rechtlichen Sicherungen, die nach der übereinstimmenden Rechtsüberzeugung aller Kulturvölker auch dem gebühren, der eine schwere strafbare Handlung begangen hat, das Leben genommen. Das Handeln aus einer solchen Gesinnung heraus steht auf tiefster sittlicher Stufe und ist als gemein und verächtlich zu bezeichnen (vgl. BGHSt. 2, 63; 3, 133).
Die Tötungen erfolgten auch heimtückisch. Heimtückisch tötet, wer die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers für die Tat ausnutzt (vgl. Schwarz Komm. zum StGB 25.Aufl. Anm.1 Bb d) zu §211; Schönke-Schröder Anm.13 zu §211; BGHSt. 6, 120). Arglos ist, wer sich im Zeitpunkt der Tat keines Angriffs versieht (vgl. Schönke-Schröder a.a.O.; BGHSt. 7, 218).
Die im KL Auschwitz getöteten Opfer aus den sog. RSHA-Transporten waren arglos, weil sie über ihr bevorstehendes Schicksal - wie unter II. im einzelnen geschildert worden ist - getäuscht worden sind und ohne etwas von dem bevorstehenden Angriff auf ihr Leben zu ahnen, in die Gaskammern hineingingen.
Sie waren, da sie unbewaffnet im geschlossenen Wagen unter strenger Bewachung nach Auschwitz deportiert wurden und unter ebenso strenger Bewachung aussteigen mussten, gegenüber dem Aufgebot an bewaffneten SS-Posten in Auschwitz auch wehrlos, was keiner näheren Begründung bedarf.
Diese Arg- und Wehrlosigkeit hat man bei den Tötungsaktionen bewusst ausgenutzt, um die Aktionen schnell und planmässig durchführen zu können. Die Aktionen verliefen daher auch fast ausnahmslos ohne Zwischenfälle.
Schliesslich waren die Tötungen in den Gaskammern auch grausam.
Grausam ist eine Tötung dann, wenn sie besonders schwere Leiden körperlicher oder seelischer Art durch die Stärke oder durch die Dauer oder durch die Wiederholung der Schmerzverursachung hervorruft und wenn sie ausserdem aus einer gefühllosen, unbarmherzigen Gesinnung hervorgeht (vgl. Schönke-Schröder Anm.17 zu §211; BGHSt. 3, 181). Die Opfer, die in den Gaskammern zusammengepfercht waren, überfiel nach dem für sie überraschenden Einschütten des Zyklon B eine verzweifelte Todesangst. Dies zeigte sich an dem fürchterlichen Geschrei, das jedesmal entstand, wenn das Zyklon B eingeschüttet worden war und an dem verzweifelten Klopfen und Pochen der Opfer an den Türen und Wänden der Gaskammern. In dieser Angst schwebten sie während mehrerer Minuten in einer ausweglosen Situation. Dabei mussten sie noch den Todeskampf ihrer nächsten Angehörigen und Bekannten miterleben. Hinzukommt, dass sie erkennen mussten, dass sie in einer jeglicher Menschenwürde hohnsprechenden Weise umgebracht wurden. All dies hat ihnen schwerste seelische Qualen während mehrerer Minuten bereitet. Dabei kann es dahingestellt bleiben, ob die Opfer auch schwere körperliche Schmerzen während der Einwirkungen des Zyklon B erlitten haben, was anzunehmen ist, da die Leichen nach dem Öffnen der Gaskammern häufig ineinander verkrampft und mit verzerrten Gesichtszügen da lagen.
Eine solche Tötungsart kann nur anordnen, wer gefühllos, roh und unbarmherzig ist. Aus dieser Gesinnung heraus hat man die Tötung der Opfer in den Gaskammern angeordnet.
Die Haupttäter kannten die tatsächlichen Umstände, die die Beweggründe für die Tötungen als niedrig und die Art ihrer Ausführung als heimtückisch und grausam kennzeichnen. Sie wussten, dass sie die jüdischen Menschen nur deswegen töten liessen, weil sie Juden waren.
Sie hatten befohlen, dass die Tötungen unter strenger Geheimhaltung und unter Täuschung der Opfer zu erfolgen hatten und sie wussten, dass dies auch so geschah. Ihnen waren auch die Umstände bekannt, unter denen die Tötungen erfolgten. Himmler selbst hatte sich den Todeskampf der Opfer in den Gaskammern bei seinem Besuch in Auschwitz angesehen, wie aus den Aufzeichnungen des Lagerkommandanten Höss hervorgeht. Nicht erforderlich ist, dass die Haupttäter ihre Beweggründe selbst als niedrig und die Art der Ausführung der Tötungen als heimtückisch und grausam werteten. Es genügt, dass sie die tatsächlichen Umstände, aus denen sich diese Wertung nach richtiger Rechtsauffassung und dem für alle Menschen verbindlichen allgemeinen Sittengesetz ergeben, kannten.
Die Haupttäter handelten rechtswidrig.
Dass die Massentötungen schuldloser jüdischer Menschen, insbesondere auch von Kindern, unter Versagen der geringsten rechtlichen Sicherungen offenbares Unrecht darstellen, liegt auf der Hand.
Die Rechtswidrigkeit dieser Tötungen ist nicht dadurch ausgeschlossen worden, dass sie auf einen Befehl Hitlers, dem alleinigen und höchsten Machthaber und Inhaber des höchsten Staats- und Regierungsamtes des damaligen deutschen Reiches, beruhten. Als Gesetz kann dieser Befehl schon deswegen nicht angesehen werden, weil er nur streng geheim erteilt und nie veröffentlicht worden ist. Aber auch wenn dieser Befehl in Gesetzesform oder in Form einer Verordnung veröffentlicht worden wäre, hätte er aus Unrecht niemals Recht schaffen können. Denn die Freiheit eines Staates, für seinen Bereich darüber zu bestimmen, was Recht und was Unrecht ist, ist nicht unbeschränkt. Im Bewusstsein der zivilisierten Völker besteht bei allen Unterschieden, die die einzelnen nationalen Rechtsordnungen im einzelnen aufweisen, ein gewisser Kernbereich des Rechts, der nach allgemeiner Rechtsüberzeugung von keinem Gesetz und keiner obrigkeitlichen Massnahme verletzt werden darf. Er umfasst bestimmte als unantastbar angesehene Grundsätze menschlichen Verhaltens, die sich bei allen Kulturvölkern auf dem Boden übereinstimmender sittlicher Grundanschauungen im Laufe der Zeit herausgebildet haben und die als rechtsverbindlich gelten, gleichgültig ob einzelne Vorschriften nationaler Rechtsordnungen es zu gestatten scheinen, sie zu missachten (vgl. BGHSt. 2, 234). Der unter Missbrauch staatlicher Machtfülle gegebene Geheimbefehl Hitlers konnte daher die Rechtswidrigkeit der Massentötungen unschuldiger Menschen nicht aufheben. Hitler stand als Inhaber des höchsten staatlichen Amtes und als Gesetzgeber nicht über dem Recht. Er war wie jeder andere Mensch an die allen Kulturnationen gemeinsamen überstaatlichen Normen gebunden und auch dem staatlichen Strafgesetz, das auch im NS-Staat die Tötung unschuldiger Menschen ohne jede rechtliche Sicherung verbot, unterworfen.
Abwegig ist die von einem Verteidiger vertretene Ansicht, Hitler habe die Geltung des §211 des StGB teilweise suspendiert. Abgesehen davon, dass die Rechtsordnung eine Teilsuspendierung einer Verbotsnorm nicht kennt, dass ein Gesetz nur durch ein anderes Gesetz aufgehoben werden kann, dass die Aufhebung des Tötungsverbotes nur in bezug auf eine bestimmte Menschengruppe, wodurch diese für vogelfrei erklärt würde, in eklatanter Weise gegen den Gleichheitsgrundsatz und damit gegen die Gerechtigkeit verstossen würde, ist das Verbot der Tötung anderer Menschen - auch der jüdischen Menschen - im NS-Staat nie, auch nicht durch den Geheimbefehl Hitlers, aufgehoben worden. Dies ist leicht daraus zu ersehen, dass die Tötung eines Juden durch andere (gleichgültig ob durch Zivilisten oder Militärpersonen) auch im NS-Staat nach §211 verfolgt und bestraft wurde. Selbst Angehörige der Polizei und SS wurden, wenn sie Juden eigenmächtig töteten, zur Verantwortung gezogen. Dabei ist es unerheblich, dass in solchen Fällen häufig nur geringe Strafen ausgesprochen wurden.
Hitler hat sich nur unter Missbrauch seiner Machtfülle über das auch für ihn geltende in §211 StGB enthaltene Tötungsverbot hinweggesetzt und seine strafrechtliche Verantwortung kraft seiner unumschränkten Macht verhindert und auch die Bestrafung seiner die Tötungsbefehle ausführenden Komplizen kraft seiner faktischen Macht unmöglich gemacht. Dass die Haupttäter das Unrecht ihrer Handlungsweise selbst klar erkannten, ergibt sich daraus, dass sie alles taten, um die Vernichtungsaktionen zu tarnen und geheim zu halten. Hitler und seine genannten Hauptkomplizen haben die Tötungen allerdings nicht eigenhändig durchgeführt. Sie haben sich bei der Durchführung der Vernichtungsaktionen willfähriger Personen, die auf Grund eines militärähnlichen Gehorsamsverhältnisses tätig wurden, bedient und die Tötungen durch sie durchführen lassen. Somit haben sie als mittelbare Täter in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken gehandelt. Dass sie auch vorsätzlich gehandelt haben, bedarf kaum einer näheren Begründung. Sie wollten den Tod der jüdischen Menschen und haben deren Tötung in klarer Kenntnis der gesamten Tatumstände befohlen und ausführen lassen. Dass sie dabei auch das Bewusstsein, Unrecht zu tun, gehabt haben, ist bereits oben ausgeführt worden.
Wenn auch die massenweise Tötungen der jüdischen Menschen während eines Zeitraumes von mehreren Jahren auf einem Willensentschluss und einer Willensäusserung Hitlers beruhten, können die gesamten Vernichtungsaktionen nicht als eine einzige Handlung angesehen werden. Das deutsche Strafrecht kennt nicht den Begriff des Massenmordes. Das Schwurgericht vermag sich auch nicht der teilweise vertretenen Ansicht anzuschliessen, dass die gesamten auf den Befehl Hitlers beruhenden Tötungen jüdischer Menschen ebenso wie die auf den Euthanasiebefehl Hitlers beruhenden Tötungen geisteskranker Personen als eine einzige Handlung im Rechtssinne anzusehen seien.
Zwar können mehrere natürliche Handlungen, die auf einem Willensentschluss des Täters beruhen und von denen jede an sich den Tatbestand einer strafbaren Handlung erfüllen würde, bei natürlicher Betrachtungsweise als Teilstücke eines einheitlichen Ganzen erscheinen und rechtlich zu einer Einheit zusammengefasst werden (Gegenstück zur fortgesetzten Handlung; vgl. Schönke-Schröder Vorbemerkung 9 vor §73 StGB). Mehrere Einzelhandlungen, die - auf einem Willensentschluss beruhend - zeitlich und räumlich in einem engen und unmittelbaren Zusammenhang stehen und ohne scharfe Trennung ineinander übergehen, sind in der Regel als eine solche (einzige) Handlung im Rechtssinne anzusehen. Der gesetzliche Tatbestand einer strafbaren Handlung ist in einem solchen Falle durch ein und dieselbe Handlung (im Rechtssinne) mehrfach (nämlich durch die Einzelhandlungen) verletzt, es liegt gleichartige Idealkonkurrenz vor (vgl. BGHSt. 1, 170).
Der Annahme einer solchen gleichartigen Handlungseinheit steht die höchstpersönliche Natur des verletzten Rechtsguts nicht unbedingt entgegen, sie ist also auch bei Tötungsdelikten denkbar (vgl. Schönke-Schröder Anm.2 zu §73 StGB; BGHSt. 1, 21; 6, 82). Ist somit die Auffassung, die Massentötungen jüdischer Menschen im Rahmen der sog. "Endlösung der Judenfrage" rechtlich als eine einzige Handlung im Sinne einer gleichartigen Idealkonkurrenz (§73 StGB) anzusehen, grundsätzlich möglich, so erscheint sie dem Schwurgericht jedoch aus tatsächlichen Gründen nicht zutreffend.
Die Auslösung der einzelnen Aktionen in den verschiedenen Ländern Europas bedurfte einer Vielzahl von Willensentschlüssen der verschiedensten Personen in den oberen, mittleren und unteren zuständigen Dienststellen und jeweils eines besonderen Einsatzbefehles. Mit der Durchführung der Aktionen war eine Vielzahl von Personen befasst, die sich ebenfalls jeweils auf Grund besonderer Willensentschlüsse zur Mitwirkung bereitfanden. Die Tötungsaktionen selbst erfolgten nicht einheitlich und erforderten unzählige Willensbetätigungen einer grossen Anzahl von Personen. So wurden in Russland die Juden durch Sonderkommandos erschossen. Hierzu bedurfte es der Befehle von Vorgesetzten und einer Vielzahl von Willensbetätigungen der die Tötungen vollziehenden Angehörigen der Einsatzkommandos. In den verschiedenen Vernichtungslagern wurden die Juden auf verschiedene Weise umgebracht, teils durch Erschiessen, teils in Gaswagen, teils in festen Gaskammern wie im Konzentrationslager Auschwitz. Das Einwerfen des Zyklon B erforderte jeweils einen besonderen Entschluss und besondere Willensbetätigungen der damit beauftragten Personen. Die Orte der Vernichtung lagen weit auseinander. Die Aktionen selbst erstreckten sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Ein enger räumlicher und zeitlicher Zusammenhang fehlt daher. Auch kann nicht von einem Ineinanderübergreifen der verschiedenen einzelnen Aktionen gesprochen werden. Zwar kamen im Konzentrationslager Auschwitz ab 1942 fast pausenlos RSHA-Transporte an. Auch war die Stätte der Vernichtung die gleiche, wenn man den Gesamtbereich des KL Auschwitz als Einheit auffasst und nicht auf die verschiedenen Gaskammern abstellt. Auch die Tötungsart war die gleiche. Die einzelnen RSHA-Transporte kamen aber aus den verschiedensten Ländern Europas. Zur Auslösung der Aktionen in den verschiedenen Ländern bedurfte es jeweils besonderer Einsatzbefehle und der Mitwirkung ganz verschiedener Personengruppen. Die einzelnen Vernichtungsaktionen erfolgten jeweils durch besondere Willensbetätigungen der zum Rampendienst eingeteilten SS-Angehörigen und insbesondere der mit dem Einwerfen des Zyklon B beauftragten SS-Männer. Die besonderen Willensbetätigungen, zu denen sich die damit befassten SS-Männer jeweils neu entschliessen mussten, stellen eine im Sinne des §74 StGB selbständige Handlung dar, die sich jeweils gegen das Leben einer bestimmten Gruppe von Menschen richtete. Durch diese selbständigen Handlungen wurde letztlich die Gruppe der in den Gaskammern eingesperrten Menschen getötet, der Tatbestand des §211 StGB also durch ein und dieselbe Handlung (das Einwerfen des Zyklon B) mehrfach verletzt. Nach Auffassung des Schwurgerichts kann bei natürlicher Betrachtungsweise daher nur jede einzelne Vernichtungsaktion, durch die jeweils eine Gruppe von Menschen getötet worden ist, als eine selbständige Handlung angesehen werden, durch die §211 mehrfach verletzt worden ist (gleichartige Tateinheit).
Die einzelnen Vernichtungsaktionen bildeten mehrere selbständige Handlungen im Sinne des §74 StGB.
2. Strafrechtliche Beurteilung der Beteiligung des Angeklagten Mulka an den Vernichtungsaktionen
Der Angeklagte Mulka hat durch die unter II. geschilderten Handlungen, nämlich durch die Benachrichtigung der verschiedenen Abteilungen und das Geben der Einsatzbefehle nach der Ankündigung von RSHA-Transporten, durch die Führung der Oberaufsicht in mindestens einem Fall während der Abwicklung eines RSHA-Transportes auf der Rampe, durch seine Anwesenheit auf der Rampe in mindestens einem weiteren Fall sowie durch die Bemühungen um die Beschaffung des Zyklon B und die Fertigstellung von gasdichten Türen für die Gaskammern, mindestens vier Tötungsaktionen gefördert, somit in vier Fällen einen kausalen Tatbeitrag zu den Massentötungen geleistet. Durch seine Anwesenheit auf der Rampe hat er die mit der Durchführung der Aktionen befassten SS-Angehörigen psychisch gestärkt und unterstützt und dafür gesorgt, dass die gegebenen Befehle prompt ausgeführt wurden.
Er hat die Tatbeiträge auf Befehl seiner Vorgesetzten geleistet. Da er Angehöriger der Waffen-SS war, ist seine strafrechtliche Verantwortlichkeit nach §47 Militärstrafgesetzbuch zu beurteilen. Denn nach §§1-4 der VO über eine Sondergerichtsbarkeit in Strafsachen für Angehörige der SS und für die Angehörigen der Polizeiverbände bei besonderem Einsatz vom 17.10.1939 (RGBl. I, 2107) fand auf Handlungen der diesen Verbänden angehörenden Personen das Militärstrafgesetzbuch entsprechende Anwendung. Nach §47 MStGB war grundsätzlich der Vorgesetzte allein verantwortlich, wenn durch die Ausführung eines Befehls in Dienstsachen ein Strafgesetz verletzt wurde. Jedoch traf den gehorchenden Untergebenen die Strafe des Teilnehmers, wenn er entweder den erteilten Befehl überschritten hatte (Abs.1 Nr.1) oder wenn ihm bekannt gewesen ist, dass der Befehl des Vorgesetzten eine Handlung betraf, welche ein allgemeines oder militärisches Verbrechen oder Vergehen bezweckte (Abs.1 Nr.2).
Der Angeklagte Mulka hat gewusst, dass der Befehl, die unschuldigen jüdischen Menschen zu töten, verbrecherisch war und dass die Tötungen selbst trotz des Befehls Hitlers ein allgemeines Verbrechen darstellten. Er selbst beruft sich nicht darauf, dass er an die Rechtmässigkeit der Tötungen geglaubt habe. In seiner Einlassung hat er die Tötungen als "himmelschreiendes Unrecht" und "Verbrechen" bezeichnet.
Dass im übrigen alle SS-Angehörigen in Auschwitz die
befohlenen Tötungsaktionen als Verbrechen ansahen, ergibt sich weiter aus folgendem:
Wie der Zeuge Dr. M. glaubhaft ausgesagt hat, wurden die Selektionen auf der Rampe und die Tötungen der Juden durch Gas von allen SS-Angehörigen, mit denen der Zeuge gesprochen hat, "freimütig abgelehnt" und "verworfen". Ferner hielt es die höhere Führung für erforderlich, durch weltanschauliche Vorträge des damaligen für die Truppenbetreuung zuständigen Oberscharführers Knittel den SS-Angehörigen immer wieder einhämmern zu lassen, dass die Vernichtung der Juden im Interesse des deutschen Volkes notwendig sei. Gleichwohl konnten diese Vorträge auch einfache SS-Männer nicht davon überzeugen, dass die Vernichtungsaktionen zu rechtfertigen seien. So hat der Angeklagte Baretzki bekundet, der selbst von einfacher Denkungsart ist, dass Knittel immer wieder von ihm und anderen SS-Männern gefragt worden sei, wie man denn die Tötung unschuldiger Juden, insbesondere von Frauen und Kindern rechtfertigen könne. Knittel sei immer wieder gefragt worden, was denn die Juden, insbesondere die Frauen und Kinder, getan hätten. Knittel hat daraufhin keine befriedigende Erklärung geben können. Er hat die SS-Männer nur mit der ausweichenden Antwort abgespeist, "dass man einem Kind, wenn es in das erste Schuljahr komme, auch nicht ein Schulbuch des fünften Schuljahres, sondern ein solches des ersten Schuljahres gebe". Baretzki hat selbst freimütig eingeräumt, dass er schon damals die Auffassung gehabt habe, dass die Judentötungen "hundertprozentiges Unrecht" seien.
Wenn schon Baretzki, der von einfacher Denkungsart und weniger intelligent als alle übrigen Angeklagten ist, das Unrecht der Vernichtungsaktionen klar erkannt hat, so ist der Schluss gerechtfertigt, dass auch die übrigen Angeklagten erkannt haben, dass die befohlenen Massentötungen jüdischer Menschen verbrecherisch waren.
Auch der frühere Lagerkommandant Höss hat in seinen Aufzeichnungen bestätigt, dass in allen "Zweifel" wegen der Vernichtungsaktionen "genagt" hätten, was nach der Überzeugung des Schwurgerichts bedeutet, dass alle SS-Angehörigen das Verbrecherische der Aktionen erkannten. Höss hat daher auch seine häufige Anwesenheit auf der Rampe für notwendig gehalten, um die SS-Angehörigen zum Durchhalten zu zwingen. Im übrigen ist die Tötung schuldloser Personen, insbesondere von kleinen Kindern, nur wegen ihrer Abstammung, ein so krasser Verstoss gegen die auch dem primitivsten Menschen bewussten Grundsätze über das Recht eines jeden Menschen auf sein Leben und ein so krasser Verstoss gegen die auch dem Staat nur in Ausnahmefällen zustehende Befugnis, den Tod eines Menschen zu fordern, wenn er in schwerwiegender Weise gegen die Rechtsordnung verstossen hat, dass sämtliche Angeklagten keine Zweifel an der Rechtswidrigkeit der befohlenen Judenvernichtung haben konnten und nach der Überzeugung des Schwurgerichts auch nicht gehabt haben.
Hinzu kommt, dass die Tötungen unter strengster Geheimhaltung und unter bewusster Täuschung der Opfer erfolgten und die Vollziehung der Tötungen durch Tarnbezeichnungen gemeldet werden musste, was den Angeklagten, insbesondere auch dem Angeklagten Mulka, alles bekannt war.
Die geschilderten Tatbeiträge zu den Vernichtungsaktionen hat der Angeklagte Mulka als Gehilfe geleistet.
Für die Frage, ob der Angeklagte Mulka als Mittäter oder (nur) als Gehilfe anzusehen ist, kommt es entscheidend auf seine Willensrichtung, auf seine innere Einstellung und Haltung zu den Taten, die er gefördert hat, im Zeitpunkt der Taten an. Denn Mittäter ist derjenige, der die Tat als eigene, Gehilfe derjenige, der die Tat eines anderen unterstützen, sie also als fremde will (ständige Rechtsprechung des BGH; statt aller anderen: Vergleiche BGHSt. 18, 87 und die dort zitierten Entscheidungen des BGH).
Die Willensrichtung des Angeklagten Mulka zur Zeit der Taten kann, da er selbst keinen Aufschluss hierüber gegeben hat, nur anhand von äusseren Umständen, die von seiner Vorstellung erfasst waren, aus seinem Verhalten bei den Vernichtungsaktionen, seinen Äusserungen und seinem sonstigen Verhalten, aus denen Schlüsse auf seine innere Einstellung gezogen werden können, ermittelt werden.
Die Besonderheit in diesem Verfahren, die es gleichzeitig schwer macht, den tatsächlichen Willen und die wahre innere Einstellung des Angeklagten Mulka und auch der anderen Angeklagten vor 20 Jahren zu erforschen, liegt darin, dass es sich um staatlich befohlene Massenmorde handelt, bei denen die Verbrechensantriebe von dem Träger der höchsten Staatsgewalt ausgingen, auf dessen Befehl eine riesige Organisation zur Tötung von Millionen Menschen aufgebaut worden war. Der Angeklagte Mulka war in diesem Apparat hineinbefohlen worden. In Auschwitz war er ein Rad in der gesamten "Vernichtungsmaschinerie", die durch das Zusammenwirken einer Vielzahl von Menschen "funktionierte".
Die Abwicklung der RSHA-Transporte in Auschwitz lief, nachdem sich die Organisation eingespielt hatte, fast zwangsläufig ab. Wenn die RSHA-Transporte in Auschwitz ankamen, war das Schicksal der deportierten Menschen bereits an sich besiegelt. Für die Ausmusterung der Arbeitsfähigen blieb nur ein geringer Ermessensspielraum. Die einzelnen SS-Angehörigen, die bei den Vernichtungsaktionen mitwirkten, beherrschten das Tatgeschehen kaum noch. Nur der Lagerkommandant, dem der Auftrag für die Massenvernichtung der Juden in Auschwitz erteilt worden war und für ihre genaue Durchführung verantwortlich war, hatte in Auschwitz noch eine gewisse Tatherrschaft über das Geschehen. Die anderen hatten bei der militärisch gegliederten inneren Organisation des Lagers und der ebenso auf militärischem Gehorsam aufgebauten Organisation der Vernichtungsaktionen seine Befehle auszuführen. Das hat der erste Lagerkommandant Höss auch klar erkannt, der seine häufige Anwesenheit auf der Rampe und bei den Krematorien für notwendig hielt, um selbst die Oberaufsicht bei den Vernichtungsaktionen zu führen und die anderem zum psychischen Durchhalten zu zwingen. Auch der Adjutant, der nur sein Gehilfe war, hatte wenig Spielraum für selbständiges Handeln. Bei einer solchen Situation wird man im Zweifel davon ausgehen müssen, dass die mitwirkenden Befehlsempfänger nur die von der staatlichen Macht befohlenen Taten fördern und unterstützen wollten, wenn sie als Glied des gesamten Vernichtungsapparates nur das taten, was ihnen aufgetragen und als besondere Aufgabe zugewiesen worden war. Nur wenn sie über ihre befohlene Tätigkeit hinaus besonderen Eifer zeigten, sich bei den Vernichtungsaktionen besonders rückhaltlos einsetzten, ihre Untergebenen aneiferten oder sonst zu erkennen gaben, dass sie die Massentötungen für richtig und notwendig hielten, wird man auf Täterwillen schliessen müssen (vgl. hierzu auch BGHSt. 18, 87).
Bei dem Angeklagten Mulka könnte sich ein Anhaltspunkt dafür, ob er die verbrecherischen Ziele der Taturheber zur Grundlage seiner eigenen Überzeugung gemacht, die Massentötungen der Juden also innerlich bejaht hat, zunächst aus der Tatsache ergeben, dass er erst im Jahre 1941 im Alter von 46 Jahren freiwillig in die Waffen-SS eingetreten ist. Denn hierfür bestand keine Notwendigkeit. Niemand hat ihn hierzu aufgefordert. Irgendwelche Nachteile wären ihm nicht erwachsen, wenn er den Eintritt unterlassen hätte. Im Jahre 1941 war bereits bekannt und kann auch dem Angeklagten Mulka nicht verborgen geblieben sein, dass jüdische Menschen aufs schwerste verfolgt wurden. Die "Reichskristallnacht" am 9.11.1938 hatte gezeigt, dass die SS besonders aktiv bei den Judenverfolgungen mitgewirkt hatte. Ferner war allgemein bekannt, dass KZ-Lager existierten, die unter dem Befehl Himmlers und seiner SS standen. Zwar mögen viele Deutsche - auch der Angeklagte Mulka - die Zustände in den Lagern im einzelnen nicht gekannt haben, es war aber bis zum Jahre 1941 zumindest durchgesickert, dass dort Terror und ungesetzliche Zustände herrschten und dass dafür die SS verantwortlich war. Niemand konnte daran zweifeln, dass die SS ein Machtinstrument in der Hand der NS-Führung war, die sich rücksichtslos für deren Ziele einsetzte. Jeder, der Mitglied der SS wurde, musste damit rechnen, unter völliger Aufgabe seiner Persönlichkeit sich ebenso rückhaltlos für die Ziele der NS-Machthaber, auch solche verbrecherischer Art, einsetzen zu müssen.
Wenn Mulka gleichwohl noch im Jahre 1941 in die Waffen-SS freiwillig eintrat, so könnte das darauf hindeuten, dass er Ziele und Politik der NS-Machthaber, auch die schweren Verfolgungen jüdischer Bürger, den Terror in den Konzentrationslagern und sonstige ihm bekannten ungesetzlichen Massnahmen innerlich billigte und sich für deren Verwirklichung einzusetzen bereit war. Mit Sicherheit kann diese Schlussfolgerung jedoch nicht gezogen werden. Die Möglichkeit, dass Mulka aus anderen Motiven freiwillig in die SS eingetreten ist, und gar nicht daran gedacht hat, er könne für verbrecherische Ziele der NS-Machthaber, insbesondere für die Judenverfolgung eingesetzt werden, kann nicht ausgeschlossen werden. Hierfür spricht immerhin folgendes: Der Angeklagte Mulka hatte sich vor dem Krieg freiwillig als Offizier der Wehrmacht zur Verfügung gestellt und war zum Oberleutnant der Reserve befördert worden. Das sah er - wie ihm geglaubt werden kann - als eine besondere Ehre an. Wegen der von ihm verschwiegenen Vorstrafe wurde er aus der Wehrmacht ausgeschlossen. Das Anerbieten der Wehrmacht zu Beginn des Krieges, Mulka solle als einfacher Soldat in die Wehrmacht eintreten und sich "hochdienen", empfand der Angeklagte Mulka - ob zu Recht oder Unrecht sei dahingestellt - als Zumutung und lehnte es aus gekränktem Ehrgefühl ab. Als ehemaliger Offizier des ersten Weltkrieges sah er es unter seiner Würde an, als einfacher Soldat Dienst zu tun. In dieser Situation bot sich ihm die Möglichkeit, in der Waffen-SS sofort als SS-Führer angenommen zu werden. Den SS-Führer mag er aus seiner damaligen Sicht dem Offizier der Wehrmacht gleichgeachtet haben. Da er sofort als SS-Obersturmführer übernommen werden konnte, der rangmässig einem Oberleutnant der Wehrmacht gleichstand, mögen Ehrgeiz und der Wunsch, auf diesem Wege zu erreichen, was ihm die Wehrmacht versagt hatte, nämlich wieder "Offizier zu werden", die Triebfeder für seinen freiwilligen Eintritt in die Waffen-SS gewesen sein. Es kann ihm nicht widerlegt werden, dass er innerhalb der Waffen-SS nur den gleichen Dienst wie in der Wehrmacht leisten wollte.
Die Waffen-SS wurde - wie damals allgemein bekannt war - ebenso wie die Wehrmacht an der Front eingesetzt. In der Heimat bildeten Ersatzeinheiten der Waffen-SS - ebenso wie das Ersatzheer der Wehrmacht - Rekruten für den Fronteinsatz aus. Der Wunsch des Angeklagten Mulka mag es gewesen sein, entweder als SS-Führer an der Front oder bei einem Ersatztruppenteil als Ausbildungsoffizier eingesetzt zu werden. Möglicherweise hat er dabei nicht bedacht, dass er auch für andere Zwecke verwendet werden könnte. Tatsächlich wurde er zunächst auch als Kompanieführer bei einem SS-Pionierbataillon in Dresden verwendet. Erst infolge seiner Erkrankung, die einen Lazarettaufenthalt erforderlich machte, erhielt er die Abkommandierung in das KL Auschwitz, da er nur noch garnisonsverwendungsfähig war. Diese Entwicklung konnte er nicht ohne weiteres bei seinem freiwilligen Eintritt in die SS voraussehen. Die Tatsache des freiwilligen Eintritts in die Waffen-SS im Jahre 1941 gibt daher keinen Aufschluss über Mulkas innere Einstellung zu den späteren Massentötungen, an denen er in Auschwitz mitgewirkt hat.
Ferner könnte die Tatsache, dass der Angeklagte Mulka sich als Adjutant des Lagerkommandanten Höss von April 1942 bis zu seinem Weggang im März 1943 bewährt hat, dafür sprechen, dass er zu dieser Zeit mit den Zielen der NS-Machthaber übereinstimmte und die Massentötungen der Juden aus innerster Überzeugung bejahte.
Als er im April 1942 zunächst vertretungsweise mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Adjutanten betraut wurde, war er bereits als Kompanieführer einige Monate im Wachsturmbann tätig. In dieser Zeit hat er nach der Überzeugung des Gerichts bereits genauere Einzelheiten über die Zustände und den Terror im Lager und die entwürdigende und jedem Recht widersprechende Behandlung der Häftlinge erfahren, auch wenn er selbst das Schutzhaftlager nicht betreten durfte. Nach der glaubhaften Aussage des Zeugen Dr. M. wusste jeder SS-Angehörige, der in Auschwitz eingesetzt wurde, innerhalb kurzer Zeit über alles, was in Auschwitz geschah, Bescheid. Viele Zeugen haben bestätigt, dass man spätestens nach zweiwöchigem Aufenthalt im Konzentrationslagerbereich über den Terror und die schrecklichen Zustände im Lager informiert war. Während der Angeklagte Mulka zunächst nur vertretungsweise die Geschäfte eines Adjutanten wahrnahm, kamen bereits RSHA-Transporte an. Hiervon muss er auf Grund seiner Stellung als Adjutant erfahren haben.
Er musste nun damit rechnen, dass er, wenn er endgültig zum Adjutanten ernannt werden würde, in viel stärkerem Masse mit den Aktionen im Rahmen der "Endlösung der Judenfrage" befasst werden würde als in dem Wachsturmbann. Gleichwohl hat er gegen seine Ernennung nichts unternommen. Er hat auch später keine erkennbaren Anstrengungen gemacht, um als Adjutant abgelöst zu werden. Er hat sich im Gegenteil in seiner Position im Sinne der SS bewährt. Das folgt daraus, dass er alsbald nach seiner Ernennung zum Adjutanten zum SS-Hauptsturmführer befördert und zum Stabsführer ernannt worden ist. Es folgt weiter daraus, dass er seine Stellung bis zu seinem Abgang von Auschwitz gehalten hat. Diese Bewährung spricht dafür, dass der Angeklagte Mulka der Judenvernichtung nicht ablehnend gegenüberstand, da sie zu einem wichtigen Aufgabenbereich der Lagerkommandantur gehörte.
Ein sicherer Beweis, dass er aus innerster Überzeugung die befohlenen Massentötungen bejaht und sich mit den Zielen der NS-Machthaber identifiziert, die Tötungen der Juden also als eigene Tat gewollt hat, ist damit jedoch noch nicht gegeben. Möglich ist, dass er nach dem in der SS herrschenden Prinzip des blinden Gehorsams gar nicht auf die Idee gekommen ist, sich gegen die Ernennung zum Adjutanten zu wehren. Auch kann er sich aus einer falsch verstandenen Pflichtauffassung und Befehlsergebenheit entsprechend dem gegebenen SS-Eid auf seinem Adjutantenposten bewährt und an der Judenvernichtung mitgewirkt haben. Anhaltspunkte dafür, dass er mit fanatischem Eifer die Vernichtung der Juden gefördert hätte, liegen nicht vor. So konnte nicht festgestellt werden, dass er aus eigenem Antrieb - ohne Befehl oder eine allgemeine Anweisung des Lagerkommandanten - zur Rampe oder zu der Gaskammer nach der Ankunft von RSHA-Transporten gegangen wäre. Auch bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass er sich für eine besonders kritische Aussonderung von Arbeitsfähigen eingesetzt hätte, um die Anzahl der Opfer zu erhöhen. Auch sonstige Äusserungen oder Handlungen, die auf Hass gegen die Juden oder auf seine Überzeugung von der Notwendigkeit ihrer Ausrottung schliessen liessen, konnten nicht festgestellt werden. Auch war nicht ersichtlich, dass er seine Untergebenen zu Hass gegen die Juden angefeuert und die Notwendigkeit ihrer Vernichtung plausibel zu machen versucht hätte.
Allerdings beweist die von dem Angeklagten Mulka befohlene Tötung eines Häftlings, der auf der Rampe mit den Zugängen gesprochen hatte, dass Mulka mit brutaler und rücksichtsloser Härte gegen Häftlinge vorging, die gegen die Disziplin und gegebene Befehle verstossen hatten.
Im Falle der Tötung dieses Häftlings war Mulka ohne Zweifel Täter. Hier ging der Tatantrieb allein von ihm aus. Er hat die Tötung des Häftlings aus eigenem Ermessen befohlen. Eine Bestrafung in diesem Fall konnte nur deswegen nicht erfolgen, weil der Fall nicht angeklagt und vom Eröffnungsbeschluss nicht erfasst ist.
Die Täterschaft des Angeklagten Mulka in diesem Fall zwingt jedoch nicht zu dem Schluss, dass er auch die Tötung der mit den RSHA-Transporten angekommenen Menschen als eigene Tat gewollt hat, also auch in diesen Fällen mit Täterwillen gehandelt hätte.
Das Motiv für die Tötung des einen Häftlings kann darin gelegen haben, dass sich der Häftling nach der Auffassung Mulkas einer schweren Disziplinlosigkeit schuldig gemacht hatte. Die Unterhaltung mit den Zugängen war streng verboten. Man befürchtete, die angekommenen Menschen könnten vorzeitig über ihr Schicksal aufgeklärt werden. Das hätte Unruhe und Widerstand hervorrufen können. Das Sprechverbot sollte das verhindern. Der Verstoss gegen dieses Verbot war wegen der sich daraus ergebenden möglichen Folgen ein schwerwiegendes Vergehen im Sinne der SS. Mulka hielt daher eine sofortige "Bestrafung", insbesondere wohl auch aus Abschreckungsgründen, für erforderlich. Er hat den Häftling nicht töten lassen, weil er Jude war - was übrigens nicht sicher feststeht -, sondern weil er sich - aus der Sicht Mulkas gesehen - eines todeswürdigen Vergehens schuldig gemacht hatte. Der Beweggrund für die Tötung dieses Häftlings stimmte also nicht mit den Beweggründen der NS-Machthaber, die sie zu den Massentötungen der Juden bestimmten, überein. Mulka wollte durch die abschreckende Bestrafung des Häftlings die reibungslose Durchführung der befohlenen Vernichtungsaktion, für die er verantwortlich war, sicherstellen.
Bei Abwägung all dieser Gesichtspunkte bleibt zwar ein erheblicher Verdacht, dass der Angeklagte Mulka als Adjutant die Massentötung der Juden innerlich bejaht und sie bereitwillig unterstützt, somit mit Täterwillen gehandelt hat; letzte Zweifel lassen sich jedoch nicht ausräumen, dass er mehr aus einer Befehlsergebenheit und falsch verstandenen "Pflichtauffassung" heraus für die reibungslose Durchführung der Vernichtungsaktionen besorgt war, somit nur die Taten der Haupttäter fördern und unterstützen wollte.
Rechtfertigungsgründe für das Handeln des Angeklagten Mulkas sind nicht ersichtlich. Der Angeklagte Mulka hat die vier Vernichtungsaktionen auch vorsätzlich gefördert. Er wusste - wie oben unter II. festgestellt - dass die Juden, die mit den RSHA-Transporten ankamen und an deren Tötung er in der geschilderten Weise mitwirkte, getötet wurden und dass seine gewollte Mitwirkung mitursächlich für ihren Tod gewesen ist. Er kannte auch die gesamten Tatumstände - wie sich ebenfalls aus den Feststellungen unter II. ergibt -, die die Beweggründe der Haupttäter als niedrig und die Art der Tötungen als heimtückisch und grausam kennzeichneten. Nicht erforderlich ist, dass er selbst aus den gleichen niedrigen Beweggründen gehandelt und die Arg- und Wehrlosigkeit der Opfer selbst persönlich ausgenutzt hat. Es genügt die bewusste und gewollte Förderung der Haupttaten in Kenntnis der gesamten Umstände, die die Tatbestandsmerkmale des Mordes erfüllen.
Der Angeklagte Mulka wusste auch, dass die Massentötungen der Juden rechtswidrig waren. Oben ist bereits ausgeführt worden, dass ihm klar war, dass auch der Geheimbefehl Hitlers die Rechtswidrigkeit der Tötungen nicht beseitigen konnte.
Er hat auch nicht irrig angenommen, dass die Befehle, unschuldige jüdische Menschen zu töten, trotz ihres verbrecherischen Zweckes für ihn verbindlich seien, weil sie auf einen Befehl des Führers, des Inhabers der höchsten staatlichen Macht und Autorität, beruhten. Hierauf beruft er sich selbst nicht.
Im übrigen musste allen SS-Angehörigen in Auschwitz klar sein und war nach der Überzeugung des Gerichts auch klar, dass die verbrecherischen Befehle nicht verbindlich sein konnten, weil sie unter Beachtung strengster Geheimhaltungsbestimmungen gegeben wurden, weil über die Vernichtungsaktionen strengstes Stillschweigen befohlen war, sogar die Unterhaltung mit anderen SS-Angehörigen hierüber untersagt wurde, weil - was allen bekannt war - die ganzen Aktionen nur unter Tarnbezeichnungen liefen und schliesslich, weil die Tötungsbefehle den Stempel des Unrechts so klar auf der Stirn trugen, dass sie keinem, auch nicht dem primitivsten Menschen, dem die allen Angehörigen der Kulturnationen gemeinsamen Grundsätze über das Recht eines jeden Menschen auf sein Leben geläufig sind, als verbindlich erscheinen konnten.
Beim Angeklagten Mulka ist darüber hinaus noch hervorzuheben, dass ihm als reifen Menschen, aus gut bürgerlichem Milieu stammend, und als Offizier des Ersten Weltkrieges, der erst spät zur Waffen-SS gekommen war und auch sonst sich bis dahin kaum in nationalsozialistischen Gliederungen betätigt hatte, klar sein musste und nach der Überzeugung des Schwurgerichts auch völlig klar war, dass auch ein Befehl Hitlers, der solche Massenmorde unschuldiger Menschen anordnete, nicht verbindlich sein konnte.
Nur am Rande sei darauf hingewiesen, dass ein Irrtum über die Verbindlichkeit der verbrecherischen Befehle kein Tatbestandsirrtum im Sinne des §59 StGB wäre, der zur Straffreiheit führen müsste, sondern ein "Verbotsirrtum" im Sinne der vom Grossen Senat für Strafsachen des BGH (BGHSt. 2, 194) zur Irrtumslehre entwickelten Grundsätze, der vermeidbar gewesen wäre und nur bei der Strafzumessung (Strafrahmen) hätte Berücksichtigung finden können.
Ein solcher Verbotsirrtum liegt aber - wie bereits gesagt - bei keinem der Angeklagten, die an den Massentötungen beteiligt waren, vor.
Der Angeklagte Mulka hat sich auch nicht in einem Nötigungsnotstand (§52 StGB) befunden. Voraussetzung hierfür wäre, dass ihm seine Mitwirkung bei den Vernichtungsaktionen durch unwiderstehliche Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger, auf andere Weise nicht abwendbare Gefahr für Leib oder Leben wider seinen Willen abgenötigt, sein Wille also gebeugt worden wäre.
Dies war bei dem Angeklagten Mulka jedoch nicht der Fall. Er selbst beruft sich nicht auf eine solche Notlage. Die gesamten Umstände sprechen auch dagegen, dass sein Wille gebeugt und er nur um einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben zu entgehen, die Vernichtungsaktionen gefördert hätte.
Hätte er aus Zwang handeln müssen, so wäre nicht verständlich, dass er nicht alles versucht hätte, um einer endgültigen Ernennung zum Adjutanten zu entgehen oder um auf seinem Adjutantenposten wieder abgelöst zu werden. Hierfür hätten sich viele Möglichkeiten gegeben: Er hätte seine Dienstgeschäfte als Adjutant nachlässig verrichten können, um das Missfallen des Lagerkommandanten zu erregen. Er hätte Auseinandersetzungen ungefährlicher Art mit dem Lagerkommandanten provozieren können, um dessen Vertrauen zu verlieren und abgelöst zu werden. Er hätte Krankheit vorschützen können, was ihm ohne Zweifel nicht schwergefallen wäre; denn er litt - wie er selbst angegeben hat und was ihm das Gericht glaubt - unter häufigen Magenkoliken. Er ist im Herbst 1942 auch wegen dieser Koliken im Lazarett gewesen und hat deswegen eine Kur bewilligt bekommen. All' diese Versuche hat er jedoch nicht unternommen. Er hat sich im Gegenteil - wie oben schon ausgeführt - als Adjutant bewährt und seine Dienstgeschäfte zur vollsten Zufriedenheit seiner Vorgesetzten erledigt. All' dies spricht gegen eine erzwungene Mitwirkung. Der Angeklagte Mulka hat als williger Befehlsempfänger getreu seinem SS-Eid die befohlenen Handlungen geleistet, ohne dass ihm überhaupt der Gedanke gekommen wäre, seine Mitwirkung zu verweigern oder sich auf irgendeine andere Weise der Mitwirkung zu entziehen.
Vor allem lässt die von ihm eigenmächtig befohlene Tötung eines Häftlings auf der Rampe klar erkennen, dass seine Anwesenheit auf der Rampe nicht erzwungen war. Denn andernfalls hätte er als ranghöchster SS-Führer nicht nur versucht, von den Menschen aus den RSHA-Transporten möglichst viele vor dem Tode zu retten durch Aussonderung einer möglichst hohen Zahl von Arbeitsfähigen, was jedoch nicht der Fall war, sondern er hätte auch für den wegen des verbotenen Sprechens mit den Zugängen gemeldeten Häftling eine relativ harmlose Strafe gefunden, woraus ihm keine Nachteile hätten erwachsen können.
Der Angeklagte Mulka befand sich auch nicht im allgemeinen Notstand (§54 StGB). Hier gilt das bereits zu §52 StGB Gesagte. Der Angeklagte Mulka hat sich nicht etwa nur deswegen an den Tötungsaktionen beteiligt, um sich aus einer nicht verschuldeten gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben zu retten.
Schliesslich liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Angeklagte Mulka irrig die tatsächlichen Voraussetzungen für eine Notstandslage nach den §§52, 54 StGB angenommen hätte. Er selbst beruft sich nicht darauf. Bei seinem bereits erörterten Gesamtverhalten ist das auch ausgeschlossen. Er hat die Befehle - wie schon ausgeführt - als williger Befehlsempfänger getreu dem geleisteten SS-Eid ausgeführt, ohne überhaupt eine Verweigerung der Mitwirkung in Erwägung zu ziehen.
Der Angeklagte Mulka hat mindestens vier Vernichtungsaktionen bewusst gefördert. Die Beihilfehandlungen zu jeder dieser vier Aktionen sind jeweils als eine Handlung im Sinne einer gleichartigen Tateinheit (§73 StGB) anzusehen, durch die jeweils 750 Menschen getötet worden sind, §211 StGB also jeweils durch ein und dieselbe Handlung 750mal verletzt worden ist. Das folgt zwar noch nicht daraus, dass bei den Haupttätern insoweit ebenfalls je eine Handlung im Sinne einer gleichartigen Idealkonkurrenz vorliegt; denn die Tat im Sinne der §§73, 74 StGB ist für den Gehilfen nicht die Haupttat, sondern sein eigener, hinsichtlich der Konkurrenz selbständig zu beurteilender Tatbeitrag (BGH 1 StR 457/62 vom 22.1.1963). Dass die Beihilfehandlungen des Angeklagten Mulka als Mitwirkung zu vier selbständigen Handlungen anzusehen sind, ergibt sich aber daraus, dass die Beteiligung des Angeklagten Mulka an den verschiedenen Vernichtungsaktionen jeweils auf einem Entschluss beruhte und bei natürlicher Betrachtungsweise jeweils als eine Einheit anzusehen ist.
Wie sich aus dem gesamten unter II. geschilderten Sachverhalt ergibt, hat der Angeklagte Mulka seine Tatbeiträge in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken mit anderen Angeklagten und sonstigen mit den Vernichtungsaktionen befassten Personen geleistet (§47 StGB). Er war daher wegen gemeinschaftlicher Beihilfe (§§47, 49 StGB) zu gemeinschaftlichem Mord (§§47, 211 StGB) in vier Fällen (§74 StGB), jeweils begangen in gleichartiger Tateinheit (§73 StGB), an 750 Menschen zu bestrafen.
VI. Hilfsbeweisanträge
Der Hilfsbeweisantrag des Verteidigers des Angeklagten Mulka. die englischen Kriegsverbrecherakten gegen Mulka über die deutsche Botschaft beizuziehen zum Beweise dafür, dass die polnischen Gerichte kein Interesse an einer Auslieferung und Verurteilung des Angeklagten Mulka als Kriegsverbrecher gehabt hätten, war gemäss §244 StPO abzulehnen, da die zu beweisende Tatsache für die Entscheidung ohne Bedeutung ist. Denn auch wenn die polnischen Gerichte (früher) kein Interesse an einer Auslieferung und Verurteilung des Angeklagten Mulka gehabt haben, als dessen Auslieferung noch möglich war, ist das weder ein Beweis noch ein Indiz dafür, dass der Angeklagte die festgestellten Taten im KL Auschwitz nicht begangen hat. Es ist möglich, dass den polnischen Behörden über die Tätigkeit des Angeklagten Mulka damals noch nichts bekannt war.
Der weitere Hilfsantrag des Verteidigers des Angeklagten Mulka, den Sachverständigen Dr. Ser. zum Beweis für die Tatsache zu hören, dass der Angeklagte Mulka Veranlassung hatte, bei einer Weigerung zur Teilnahme an den Vernichtungen konkrete Nachteile für Leib und Leben zu befürchten, war ebenfalls gemäss §244 StPO abzulehnen. Denn die in das Wissen des Sachverständigen gestellte Tatsache ist im Falle Mulka für die Entscheidung ohne Bedeutung (§244 Absatz III, Satz 2). Das Gericht hat festgestellt, dass der Angeklagte Mulka gar nicht auf den Gedanken gekommen ist, eine Mitwirkung an den Massenvernichtungen zu verweigern oder sich einer solchen Mitwirkung zu entziehen. Somit steht fest, dass ihm seine Mitwirkung nicht abgezwungen, sein Wille also nicht gebeugt worden ist. Bei dieser Sachlage kommt es nicht darauf an, wie es gewesen wäre, wenn Mulka sich hätte weigern wollen, an den Massenvernichtungen mitzuwirken.
VII. Strafzumessung
1. Allgemeine Erwägungen zu der Bemessung der Strafen wegen Beihilfe zum Mord
Bei Bemessung der jedem einzelnen Angeklagten, soweit er nur wegen Beihilfe zum Mord verurteilt worden ist, zuzuerkennenden Strafe konnte es dem Schwurgericht nicht darum gehen, die Gesamtheit der im KL Auschwitz begangenen Verbrechen zu sühnen. Angesichts der unzähligen Opfer eines verbrecherischen Regimes und dem unsäglichen Leid, das die in der Geschichte beispiellose, planmässig betriebene, auf teuflische Weise ersonnene Ausrottung von Hunderttausenden von Familien nicht nur über die Opfer selbst, sondern über unzählige Menschen, vor allem über das gesamte jüdische Volk gebracht und das deutsche Volk mit einem Makel belastet hat, erscheint es kaum möglich, durch irdische Strafen eine dem Umfang und der Schwere der im KL Auschwitz begangenen Verbrechen angemessene Sühne zu finden.
Zieht man das in Betracht und sieht man nur auf den grauenhaften Gesamterfolg der im KL Auschwitz begangenen Verbrechen, zu dessen Verwirklichung die Angeklagten - jeder auf seine Weise - bestimmte Tatbeiträge geleistet haben, so erscheint es zunächst, als ob Milderungsgründe für die einzelnen Angeklagten nicht mehr von Bedeutung sein könnten und als Sühne nur die im Gesetz vorgesehenen Höchststrafen in Betracht kommen könnten. Dem ist aber nicht so. Das Schwurgericht durfte sich nicht dazu verleiten lassen, den durch ein verbrecherisches Regime, dem alle organisatorischen und technischen Mittel für die planmässige Ausführung der Verbrechen zu Verfügung standen, bewirkten Gesamterfolg allen Angeklagten unterschiedslos anzulasten. Seine Aufgabe und Verpflichtung war es, jedem Angeklagten die nach dem Umfang seines persönlich geleisteten, nachgewiesenen Tatbeitrages und seiner persönlich nachgewiesenen strafrechtlich wertbaren Schuld gerecht erscheinende Strafe zuzumessen.
Für alle festgestellten Beihilfehandlungen der Angeklagten, gleichgültig, wann sie begangen wurden, gilt ein Strafrahmen von 3 Jahren Zuchthaus bis zu lebenslangem Zuchthaus. Eine Unterschreitung der untersten Grenze dieses Strafrahmens nach Versuchsgrundsätzen kam bei keinem der Angeklagten in Betracht, da keiner der Angeklagten in vermeidbarem Verbotsirrtum die festgestellten Beihilfehandlungen begangen hat. Andererseits waren alle Beihilfehandlungen bereits zur Tatzeit mit der Todesstrafe bedroht, an deren Stelle jetzt die lebenslange Zuchthausstrafe tritt. Für die nach dem Inkrafttreten der Verordnung vom 29.5.1943 (RGBl. Seite 341) begangenen Beihilfehandlungen ergibt sich das unmittelbar aus den durch diese VO geänderten Bestimmungen der §§44 und 49 StGB. Aber auch die vor Inkrafttreten dieser VO von den Angeklagten geleisteten Beihilfehandlungen zum Mord waren bereits mit der Todesstrafe bedroht.
Das ergibt sich aus §4 der VO gegen Gewaltverbrecher vom 15.12.1939 (RGBl. I, Seite 2378). Nähere Ausführungen hierzu erfolgen im 6. Abschnitt unter II. bei der Erörterung der Frage, ob die Straftaten der Angeklagten verjährt sind. Hier kann auf diese Ausführungen Bezug genommen werden. Es war somit möglich, für alle Beihilfehandlungen zum Mord die lebenslange Zuchthausstrafe zu verhängen.
Das Schwurgericht hat bei jedem Angeklagten, der sich der Beihilfe zum Mord schuldig gemacht hat, geprüft, ob für die geleisteten Beihilfehandlungen lebenslanges Zuchthaus die angemessene Sühne sei, die Frage nach Abwägung aller für die Strafzumessung massgebenden Gesichtspunkte jedoch verneint.
Allgemein ist für alle der Beihilfe zum Mord schuldigen Angeklagten zu sagen, dass nicht unberücksichtigt bleiben konnte, dass die Tatantriebe zu den Verbrechen von der höchsten Staatsführung ausgingen und in einer Zeit geschahen, in der unter der Herrschaft des Nationalsozialismus eine beispiellose geistige Verwirrung herrschte. Durch jahrelange Propaganda und geschickte psychologische Beeinflussung hatten es die NS-Machthaber verstanden, die überkommenen Wertvorstellungen in Frage zu stellen und die Grenzen zwischen Recht und Unrecht zu verwischen. In der SS waren die Angeklagten dieser Propaganda und Beeinflussung besonders intensiv ausgesetzt. Die Angeklagten wurden von dem verbrecherischen Regime, dem sie unbedingten Gehorsam geschworen hatten, missbraucht. Sie hatten ihr Leben, bevor sie in das KL Auschwitz kamen, straffrei verbracht oder mussten zumindest als straffrei angesehen werden. Unter normalen Verhältnissen, wie sie in einem geordneten Staatswesen herrschen, hätten sie wohl trotz ihrer teilweise schwachen charakterlichen Eigenschaften kaum jemals Mord oder Beihilfe zum Mord begangen. Das zeigt sich auch darin, dass sie nach dem Zusammenbruch des sog. Dritten Reiches alle wieder in ein geordnetes, arbeitsames Leben zurückgefunden haben. In der Atmosphäre des KL
Auschwitz, in die sie hineinbefohlen wurden und die - wie der Zeuge Dr. M. sich ausdrückte - bewirkte, dass jeder, der nach Auschwitz kam, nach zwei Wochen nicht mehr "normal reagieren" konnte und durch das negative Beispiel ihrer Vorgesetzten, vor allem der höheren Führung, war für alle Angeklagten die Gefahr, die überkommenen Wertvorstellungen über Bord zu werfen und an den Verbrechen mitschuldig zu werden, ohne Zweifel erheblich grösser, als in einer geordneten Umgebung.
Damit kann zwar ihre Beteiligung an den Verbrechen nicht entschuldigt werden. Ihre Schuld erscheint jedoch im Hinblick auf die damaligen Zeitverhältnisse und die im KL Auschwitz herrschende Atmosphäre gegenüber der Schuld der Haupt- und Mittäter in einem milderen Licht, so dass als Sühne für ihre Tatbeiträge zeitige Zuchthausstrafen in dem gesetzlich vorgesehenen Strafrahmen zwischen 3 Jahren Zuchthaus und 15 Jahren Zuchthaus als ausreichend erscheinen.
Andererseits war bei keinem der Angeklagten die Schuld so gering, dass ein Absehen von Strafe nach §47 Abs.III MStGB in Frage hätte kommen können.
2. Strafzumessung bezüglich des Angeklagten Mulka
Beim Angeklagten Mulka lag es besonders nahe, die lebenslange Zuchthausstrafe für alle vier Fälle der Beihilfe zum Mord in Betracht zu ziehen. Das Schwurgericht hat jedoch auch bei ihm zeitige Zuchthausstrafen für ausreichend angesehen. Allerdings ist der Unrechtsgehalt der von ihm geleisteten Tatbeiträge sehr hoch. Als Adjutant hat er in einer wichtigen und verantwortlichen Stelle an der Verwirklichung des Vernichtungsprogrammes der NS-Machthaber mitgewirkt. Als er Adjutant wurde, waren zwar bereits jüdische Menschen im Rahmen der sog. "Endlösung der Judenfrage" umgebracht worden, das Vernichtungsprogramm lief aber zu seiner Zeit erst richtig an. Die organisatorischen
Voraussetzungen für eine Massenvernichtung im grossen Stil wurden gerade während seiner dienstlichen Tätigkeit geschaffen (Umbau der Bauernhäuser zu Gaskammern, Einrichtung der vier neuen Krematorien mit unterirdischen Gaskammern). An ihrer Verwirklichung hat er als Adjutant zumindest indirekt aber auch dadurch direkt mitgewirkt, dass er sich um die Fertigstellung der gasdichten Türen bemüht und eine Fahrgenehmigung für das Abholen von Zyklon B aus Dessau, das für die Tötung der jüdischen Menschen bestimmt war, eingeholt hat. Ihn trifft daher eine besonders hohe Verantwortung.
Wenn das Schwurgericht gleichwohl zeitige Zuchthausstrafen für ausreichend hielt, so nur deswegen, weil bei ihm wegen seines hohen Alters und seines angegriffenen Gesundheitszustandes eine besondere Strafwirkung besteht und weil auch für ihn die unter 1. gemachten Ausführungen zutreffen. Er ist zwar erst in reiferen Jahren freiwillig in die SS, und zwar zu einem Zeitpunkt eingetreten, in dem er damit hätte rechnen müssen, in Verbrechen verstrickt zu werden. Nicht sicher ist jedoch - wie schon oben ausgeführt - dass er überhaupt daran gedacht hat, für Verbrechen missbraucht zu werden. Wie alle anderen Angeklagten ist auch der Angeklagte Mulka erst im KL Auschwitz durch die Befehle der NS-Staatsführung zum Verbrecher geworden. Vorher hat er ein ordentliches, straffreies Leben geführt. Die Strafe aus dem Jahre 1920 hatte ausser Betracht zu bleiben, da sie inzwischen im Strafregister getilgt ist. Wäre er nicht magenkrank geworden, sondern kriegsverwendungsfähig geblieben, wäre er wahrscheinlich nie in das KL Auschwitz gekommen und wohl nie zum Gehilfen von Mördern geworden. Die Verkettung unglücklicher Umstände hat dazu beigetragen, dass er in den Vernichtungsapparat eingespannt wurde.
Als Sühne konnten bei ihm allerdings nur Strafen in Frage kommen, die an der oberen Grenze des für zeitige Zuchthausstrafen geltenden Strafrahmens liegen. Wie schon ausgeführt, hatte er im KL Auschwitz neben dem Lagerkommandanten, der für die Verwirklichung des Vernichtungsprogramms verantwortlich war, eine wichtige Schlüsselstellung inne. Als Adjutant und Stabsführer war er nach dem Lagerkommandanten und neben dem ersten Schutzhaftlagerführer nach Rang und Amtsstellung eine der wichtigsten Persönlichkeiten im KL Auschwitz sowohl für das Lager als auch für die durchzuführenden Massenmorde. Dass er hierbei die gegebenen Befehle zumindest bedenken- und skrupellos ausgeführt hat, ergibt sich daraus, dass er sich als Adjutant - wie oben schon ausgeführt - im Sinne der SS "bewährt" hat.
Durch die Benachrichtigung der einzelnen Abteilungen und das Geben der Einsatzbefehle nach der Ankunft der RSHA-Transporte hat er die gesamte Mordmaschinerie in Gang gesetzt, also einen entscheidenden Beitrag für die Vernichtung der mit den Transporten angekommenen Menschen geleistet. Besonders gravierend ist, dass er auch mehrfach mit auf der Rampe gewesen ist und zumindest in einem Fall die Vernichtung eines RSHA-Transportes geleitet und die Oberaufsicht geführt hat. Dadurch hat er dazu beigetragen, dass die ihm untergebenen SS-Führer, Unterführer und Mannschaften die ihnen übertragenen Aufgaben bei der Verwirklichung des Mordplanes bedenkenlos ausführten. Dass er mit eiserner Strenge und brutaler Härte darüber wachte, dass die "Abwicklung" des betreffenden RSHA-Transportes reibungslos vonstatten ging, zeigt die befohlene Tötung des Häftlings, der sich gegen das Schweigegebot vergangen hatte.
Der Angeklagte Mulka hat auch sonst nichts getan, um dem Terror im Schutzhaftlager zu steuern oder das Los der erniedrigten, ausgehungerten und jeder Menschenwürde beraubten Häftlinge zu erleichtern. Er hat zumindest vor dem Geschehen im Lager bewusst die Augen verschlossen. Als Gerichtsoffizier hätte er die Möglichkeit gehabt, ja, er wäre sogar dazu verpflichtet gewesen, Übergriffe der SS-Angehörigen, der Kapos und Blockältesten gegenüber den Häftlingen, die auch von der höheren SS-Führung missbilligt wurden, abzustellen. Er hat sich darum aber nicht gekümmert. Das wirft ein ungünstiges Licht auf seine Persönlichkeit.
Nach Abwägung all dieser Gesichtspunkte hielt das Schwurgericht für jeden Fall der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord (mindestens 4 Fälle) eine Einzelstrafe von je 10 Jahren Zuchthaus für eine angemessene Sühne.
Aus diesen Einzelstrafen war gem. §74 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden. Im Hinblick auf die wichtige Stellung, die der Angeklagte Mulka im KL Auschwitz innehatte, den hohen Unrechtsgehalt seiner Tatbeiträge und die grosse Zahl der Opfer, an deren Tötung er mitgewirkt hat und die Persönlichkeit des Angeklagten erschien eine Gesamtstrafe in Höhe von 14 Jahren als angemessene Sühne.
B. Die Straftaten des Angeklagten Höcker
I. Lebenslauf des Angeklagten Höcker
Der Angeklagte Höcker ist am 11.12.1911 als Sohn eines Maurermeisters, der im Ersten Weltkrieg im Jahre 1915 gefallen ist, geboren. Er war das jüngste von 6 Kindern. Seine Mutter betrieb eine kleine Landwirtschaft. Der Angeklagte besuchte von 1918 bis 1926 die Volksschule in Preussisch-Oldendorf. Anschliessend absolvierte er in einer Maschinenfabrik eine vierjährige kaufmännische Lehre bis zum Jahre 1933. Danach arbeitete er in einem Eisenwarengeschäft in Preussisch-Oldendorf als Buchhalter. 1931 wurde er arbeitslos. Er erhielt angeblich keine Unterstützung. Von Anfang 1933 an leistete er freiwillig ein halbes Jahr lang Notstandsarbeiten (Flussregulierungen usw.) bei einem Tageslohnsatz von 1.80 RM. Im Juni 1933 wurde er als Kassengehilfe bei der Amtskasse in Preussisch-Oldendorf eingestellt. Später wechselte er zur Zweigstelle der Kreissparkasse von Preussisch-Oldendorf nach Lübbecke über.
Im Oktober 1933 bewarb sich der Angeklagten um Aufnahme in die allgemeine SS. Damals sei - so gibt der Angeklagte an - eine Anordnung ergangen, dass alle im öffentlichen Dienst Beschäftigten um Aufnahme in die Partei oder eine ihrer Gliederungen nachsuchen sollten. Er habe der SA beitreten wollen, sei aber zurückgewiesen worden. Daher habe er sich um Aufnahme in die SS bemüht. Ihm sei der Unterschied zwischen SA und SS damals nicht klar gewesen. Bei Kriegsausbruch war der Angeklagte SS-Staffelmann.
Im Jahre 1937 wurde der Angeklagte als Anwärter in die NSDAP aufgenommen. Er gibt an, er habe sich aus beruflichen Gründen um die Aufnahme in die Partei beworben.
Am 16.11.1939 wurde der Angeklagte zum 9. SS-Infanterieregiment nach Danzig eingezogen und erhielt dort zunächst eine militärische Ausbildung. Als später 2 Bataillone dieses Regiments nach Prag verlegt werden sollten, wurde eine allgemeine Untersuchung der SS-Angehörigen dieser Einheit durchgeführt, bei der der Angeklagte nur als g.v.H. befunden wurde. Er wurde nach Berlin geschickt und von dort zum KL Neuengamme versetzt. Dort versah er kurze Zeit Wachdienst, kam anschliessend zur Kompanieschreibstube und dann zur Schreibstube der Kommandantur, wo er Sachbearbeiter für Personalangelegenheiten der zum KZ Neuengamme gehörenden SS-Truppe war. Während seiner Tätigkeit in Neuengamme wurde der Angeklagte zum SS-Unterscharführer befördert. Im Frühjahr 1942 wurde der Angeklagte als Stabsscharführer in das KZ "Nebenlager Arbeitsdorf" in die Nähe von Wolfsburg versetzt. Nach Auflösung dieses Lagers kam er im Herbst 1942 für einige Wochen auf den Truppenübungsplatz Debica bei Krakau zur militärischen Ausbildung. Anschliessend wurde er zu einer Vorbereitungslehrkompanie für die SS-Junkerschule in Braunschweig nach Dachau "Truppenlager" kommandiert. Nach Absolvierung der SS-Junkerschule wurde der Angeklagte Ende Mai 1943 zum SS-Untersturmführer befördert und über das SS-WVHA in Berlin als Adjutant zu dem KL Majdanek bei Lublin versetzt. Der Angeklagte will dieser Versetzung widersprochen haben. Er habe - so gibt er an - zur kämpfenden Truppe gewollt. Man habe ihm aber befohlen, nach Lublin zu gehen. Im Juli 1943 erkrankte der Angeklagte. Er kam für 1/4 Jahr in das Lazarett. Dann kehrte er wieder nach Lublin zurück (November 1943). Im Mai 1944 wurde er zu dem KZ Auschwitz versetzt. Dort wurde er als Adjutant des Lagerkommandanten Baer eingesetzt und am 21.Juni 1944 zum SS-Obersturmführer befördert. Nach der Auflösung des KZ Auschwitz im Januar 1945 wurde der Angeklagte Adjutant im KZ Nordhausen, wo er etwa 4-6 Wochen verblieb. Alsdann kam er zu einer Kampftruppe, die sich im Norden formierte. Er kam aber nicht mehr zum Einsatz. Gegen Kriegsende geriet der Angeklagte in britische Gefangenschaft. Er gab sich als Unteroffizier der Wehrmacht aus. Über seine Tätigkeit in Lublin, Majdanek und Auschwitz sowie seine Zugehörigkeit zur SS machte er keine Angaben. Nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft Ende Januar 1946 meldete er sich beim Arbeitsamt. Er war dann einige Zeit in der Landwirtschaft und an verschiedenen Stellen als Buchhalter tätig. 1952 erstattete der Angeklagte Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld gegen sich selbst, um ein Spruchkammerverfahren gegen sich durchführen zu lassen. Durch Strafbescheid vom 19.1.1953 erhielt er wegen Zugehörigkeit zu einer verbrecherischen Organisation (SS) eine Gefängnisstrafe von 9 Monaten, die er jedoch nicht zu verbüssen brauchte. Der Angeklagte war bei der Kreissparkasse in Lübbecke bis zum 30.6.1963 als Hauptkassierer beschäftigt. Dann wurde er entlassen. Vom 1.7.1963 bis Mitte November 1963 war er als Arbeiter tätig. Danach wurde er arbeitslos.
Der Angeklagte hat im Jahre 1937 geheiratet. Aus der Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen.
Seit dem 25.3.1965 befindet sich der Angeklagte auf Grund des Haftbefehls des erkennenden Schwurgerichts vom 25.3.1965 in Untersuchungshaft.
II. Die Mitwirkung des Angeklagten Höcker an der Massentötung jüdischer Menschen in Auschwitz (Tatsächliche Feststellungen)
Der Angeklagte Höcker hat als Adjutant des Lagerkommandanten Baer im KL Auschwitz ab Mai 1944 ebenfalls an der Vernichtung der RSHA-Transporte mitgewirkt.
Auch nach der oben erwähnten Dreiteilung des Gesamtlagerbereichs in die Lager A I, A II und A III blieb die Kommandantur des Lagers A I weiterhin für die Abwicklung der RSHA-Transporte zuständig. Zeitweise kam im Jahre 1944 auch der frühere Lagerkommandant Höss, der im Oktober 1943 anstelle von Liebehenschel Amtschef des Amtes D I der Amtsgruppe D im WVHA geworden war, als "Sonderbeauftragter für die Judenumsiedlung" nach Auschwitz, um hier die Vernichtung der RSHA-Transporte, die in der Zeit zwischen Mai und Spätsommer 1944 pausenlos aus Ungarn ankamen (sog. Ungarn-Transporte) persönlich zu leiten. Höss war während dieser Zeit gleichzeitig Standortältester, während sonst diese Funktion durch den Lagerkommandanten des Lagers A I ausgeübt wurde. Der Angeklagte Höcker war gleichzeitig Adjutant des Standortältesten.
Die RSHA-Transporte wurden ebenso wie zur Zeit Mulkas vom RSHA oder den Gestapoleitstellen, die davon dem RSHA Mitteilung machten, der Kommandantur des Lagers A I meist per Fernschreiben angekündigt. Der Adjutant oder ein Mitglied des Kommandanturstabes des Lagers A I benachrichtigten daraufhin die verschiedenen Abteilungen der Lager Auschwitz I und Birkenau und gaben die Einsatzbefehle für die zum Rampendienst eingeteilten SS-Angehörigen.
In mindestens drei Fällen hat der Angeklagte Höcker telefonisch nach der Ankündigung von RSHA-Transporten die verschiedenen Abteilungen der Lager von der Ankunft der Transporte verständigt und die Einsatzbefehle für den Rampendienst gegeben. Der Angeklagte Höcker war auch mehrfach, mindestens zweimal, mit ranghöheren SS-Führern während der Vernichtung von sog. RSHA-Juden bei einem der vier Krematorien anwesend. Dass er hierbei eine bestimmte Tätigkeit entfaltet hätte, konnte nicht festgestellt werden.
Dem Angeklagten Höcker unterstand als Adjutanten auch die Fahrbereitschaft. Er war verantwortlich für den Einsatz der LKWs, die die Kranken und gehunfähigen RSHA-Juden von der Rampe in Birkenau zu den Gaskammern transportierten. Allerdings war der Einsatz dieser LKWs bereits vor der Ankunft Höckers in Auschwitz allgemein geregelt. Der Angeklagte Höcker brauchte daher für die Abwicklung von RSHA-Transporten keine besonderen Einsatzbefehle an die Fahrbereitschaft mehr zu geben. Es bedurfte lediglich der Benachrichtigung der Fahrbereitschaft, dass ein Transport angekündigt sei und sich die LKW-Fahrer an der Rampe einzufinden hätten. In den drei genannten Fällen hat der Angeklagte Höcker auch die Fahrbereitschaft in dieser Weise benachrichtigt.
Durch die geschilderten Handlungen hat der Angeklagte Höcker bei der Tötung von mindestens je 1000 Menschen aus drei verschiedenen RSHA-Transporten, die zu verschiedenen Zeiten in Auschwitz angekommen sind, mitgewirkt.
Dem Angeklagten Höcker war bekannt, dass die jüdischen Menschen, die mit diesen sog. RSHA-Transporten ankamen, in den Gaskammern getötet wurden, soweit sie nicht als arbeitsfähig ausgesondert und in das Lager aufgenommen wurden. Er wusste auch, dass sie nur deshalb getötet wurden, weil sie Juden waren. Er war auch darüber informiert, dass die Deportationen der Juden nach Auschwitz unter strengster Geheimhaltung und unter Verwendung von Tarnbezeichnungen erfolgten und dass die Juden in der oben geschilderten Weise über ihr bevorstehendes Schicksal bis zuletzt getäuscht wurden und daher ahnungslos in die Gaskammer hineingingen. Er kannte auch die Ängste, den Schrecken und die Todesqual, die die Opfer jeweils ergriffen, wenn das Gas eingeschüttet worden war und die Opfer merkten, dass sie eines qualvollen Todes sterben sollten. Dem Angeklagten Höcker war auch klar, dass er jeweils durch die Benachrichtigung der verschiedenen Abteilungen im Lager nach der Ankündigung der RSHA-Transporte jeweils den gesamten Vernichtungsapparat in Auschwitz in Gang setzte und dadurch selbst einen Beitrag zu den Massentötungen leistete.
III. Die Einlassung des Angeklagten Höcker
Der Angeklagte Höcker bestreitet jede Mitwirkung bei der Vernichtung der RSHA-Transporte. Er behauptet, dass das Lager A I damit überhaupt nichts zu tun gehabt habe. Die Fernschreibstelle habe die Fernschreiben, die die RSHA-Transporte angekündigt hätten, sofort nach dem Lager Birkenau weitergegeben. Die dortige Kommandantur hätte dann den Standortarzt, die Politische Abteilung, die Fahrbereitschaft und die Abteilungen ihres Lagers von der Ankunft der Transporte benachrichtigt und die Abwicklung der RSHA-Transporte, die sofort in das Lager Birkenau auf die dortige Rampe gefahren worden seien, in eigener Zuständigkeit durchgeführt. Er selbst habe nie RSHA-Transporte gesehen. Er sei auch nie auf der Rampe in Birkenau gewesen und habe nie eine Selektion miterlebt. Die Vollzugsmeldungen und die durchgeführten Vergasungen seien durch das Lager Birkenau erfolgt. Es könne sein, dass sie durch seine Hand gegangen seien. Er habe sie jedoch nicht unterzeichnet, höchstens abgezeichnet.
Über die Behandlung der Juden und über die "Sonderbehandlung" habe er keine Fernschreiben oder sonstige Schreiben gesehen. Die Bezeichnung "SB" habe er nicht gekannt, als er nach Auschwitz gekommen sei. Er wisse nicht mehr, wann er diese Bezeichnung zum ersten Mal gehört habe. Von den Ungarn-Transporten habe er nur zufällig aus Fernschreiben erfahren.
Der Angeklagte Höcker behauptet ferner, er sei nie im Lager Birkenau gewesen. Er habe erst im Laufe der Zeit in Auschwitz erfahren, dass in Birkenau Gaskammern seien. Mit Abscheu habe er von den Vergasungen Kenntnis genommen. Der Angeklagte Höcker behauptet schliesslich, die Fahrbereitschaft habe dem Lagerkommandanten unterstanden. Die Fahrbefehle habe der Leiter der Fahrbereitschaft, Untersturmführer Wiegand, unterschrieben. Auf Grund einer generellen Anordnung des Lagerkommandanten habe die Fahrbereitschaft dem Lager A II jeden Tag eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen zur Verfügung stellen müssen. Der Einsatz dieser Fahrzeuge sei durch den Kommandanten des Lagers Birkenau befohlen worden.
IV. Beweiswürdigung
Die Einlassung des Angeklagten Höcker ist unglaubhaft. Unwahrscheinlich ist zunächst, dass er als Adjutant die RSHA-Transporte nie gesehen und von den Gaskammern erst im Laufe der Zeit erfahren haben will. Ebenso ist schon an sich unwahrscheinlich, dass die Kommandantur des Lagers A II die Dienststelle des Standortarztes, die Politische Abteilung und die Fahrbereitschaft von der Ankunft von RSHA-Transporten benachrichtigt haben soll und diesen Dienststellen die Einsatzbefehle für den Rampendienst gegeben haben soll. Denn diese Dienststellen unterstanden nicht - auch nicht nach der Einlassung des Angeklagten Höcker - der Kommandantur des Lagers Birkenau und waren auch nicht dort, sondern in A I untergebracht.
Seine Einlassung ist aber auch durch die Beweisaufnahme widerlegt worden. Der Angeklagte Höcker selbst hat angegeben, dass der Lagerkommandant des Lagers A I, Sturmbannführer Baer, nach dem Anlaufen der sog. Ungarn-Aktion ihm gegenüber geäussert habe: "Dieser Eichmann kann doch nicht machen, was er will, er soll die Juden in Ungarn behalten!" Höcker hat dann weiter erklärt, Baer sei dann wegen dieser Ungarn-Aktion in Berlin im WVHA bei SS-Obergruppenführer Pohl und im RSHA bei SS-Gruppenführer Müller vorstellig geworden. Das Gericht hat keine Zweifel, dass Höcker insoweit die Wahrheit gesagt hat.
Wenn sich Baer als Kommandant des Lagers A I wegen der Ungarn-Aktion mit den massgebenden Dienststellen in Verbindung gesetzt hat, so beweist das, dass er auch für deren Abwicklung in Auschwitz zuständig gewesen ist. Hätte die Kommandantur des Lagers A I nichts damit zu tun gehabt, hätte für Baer keine Veranlassung bestanden, deswegen mit den Dienststellen in Berlin zu verhandeln. Dies wäre Sache des Kommandanten von Birkenau gewesen.
War aber Baer als Kommandant des Lagers A I mit den Vernichtungsaktionen der RSHA-Juden befasst, so beweist dies, dass - entgegen der Einlassung des Angeklagten Höcker - die Kommandantur des Lagers A I und nicht die Kommandantur des Lagers A II für die Abwicklung der RSHA-Transporte zuständig gewesen ist. Daraus ergibt sich weiter, dass Höcker als Adjutant des Kommandanten von A I mit den RSHA-Transporten zu tun gehabt haben muss.
Dass die Kommandantur des Lagers A I auch im Jahre 1944 für die Abwicklung der RSHA-Transporte zuständig gewesen ist, wird ferner bestätigt durch die Zeugin Ba. Diese Zeugin kam - nach ihrer glaubhaften Aussage - am 23.11.1943 als Fernschreiberin nach Auschwitz und blieb dort bis zur Evakuierung des Lagers. Sie hat bekundet, dass sie im Jahre 1944 nachts Fernschreiben, die RSHA-Transporte angekündigt hätten, nach "oben" d.h. zur Kommandantur des Lagers A I gebracht habe. Die Zeugin hat nichts davon gewusst, dass diese Fernschreiben nach Birkenau zu der dortigen Kommandantur hätten weitergeleitet werden sollen oder weitergeleitet worden sind. Nach Ansicht der Zeugin sind auch solche Fernschreiben, die tagsüber in der Fernschreibstelle eingelaufen sind, ebenfalls zur Kommandantur des Lagers A I gebracht worden. Allerdings konnte sich die Zeugin nicht mehr konkret daran erinnern.
Auch der Angeklagte Baretzki hat die Zuständigkeit der Kommandantur des Lagers A I für die Abwicklung der RSHA-Transporte bestätigt. Baretzki, der als Blockführer im Lagerabschnitt B II d eingesetzt war, hat glaubhaft erklärt, dass ihm die RSHA-Transporte stets von der Kommandantur A I angekündigt worden seien, wenn er sich in der Blockführerstube aufgehalten habe und dass auch von dieser Kommandantur die Einsatzbefehle für den Rampendienst gekommen seien.
Schliesslich hat der bereits oben erwähnte Zeuge Wal., der 1944 Spiess bei der Kommandantur im Lager A I gewesen ist, bei seiner Vernehmung am 25.3.1965 bekundet, dass die Fernschreiben, mit denen RSHA-Transporte angekündigt worden seien, dem Adjutanten vorgelegt worden seien. Nur wenn der Adjutant gerade abwesend gewesen sei, habe er als Spiess die Fernschreiben bekommen und quittieren müssen. Später habe er dann diese Fernschreiben dem Adjutanten übergeben, sobald dieser zurückgekommen sei. Einige Male habe er Höcker auf diese Weise Fernschreiben hingebracht. Höcker habe daraufhin jedesmal sofort telefonisch die einzelnen Abteilungen von der Ankunft der Transporte benachrichtigt, unter anderem das Schutzhaftlager, die Politische Abteilung und das Lager Birkenau. Dies habe er selbst mit eigenen Ohren mit angehört. Das Schwurgericht hat dem Zeugen Wal. geglaubt. Von der Verteidigung sind gegen die Glaubwürdigkeit des Zeugen Bedenken geltend gemacht worden, weil der Zeuge bei seiner ersten Vernehmung am 13.8.1964 in einer Reihe von Punkten offensichtlich die Unwahrheit gesagt habe.
Es ist zwar richtig, dass der Zeuge Wal. den Angeklagten Höcker bei seiner ersten Vernehmung am 13.8.1964 nicht belastet hat. Er hat nichts davon erwähnt, dass Höcker Fernschreiben mit der Ankündigung von RSHA-Transporten erhalten und die einzelnen Abteilungen von der Ankunft der Transporte verständigt habe. Der Zeuge hielt aber bei dieser Vernehmung offensichtlich mit der Wahrheit zurück. Er machte einen unsicheren und gequälten Eindruck.
Das Schwurgericht gewann die Überzeugung, dass er aus Angst, sich selbst belasten zu müssen und aus Angst, von dem Angeklagten Höcker umgekehrt belastet zu werden, falls er die Wahrheit sage, in vielen Punkten die Unwahrheit gesagt hat. So gab der Zeuge bei dieser Vernehmung z.B. an, er habe nichts von Erschiessungen an der Schwarzen Wand und von Tötungen durch Phenol gehört und auch nichts davon gewusst, auch sei er nie auf der Rampe gewesen. Der Angeklagte Baretzki hat demgegenüber sofort spontan nach dieser Aussage erklärt, dass er den Zeugen Wal. oft auf der Rampe gesehen habe. Wal. sei mit dem Motorrad dort hingekommen.
Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft wurde der Zeuge Wal. nach seiner Vernehmung am 13.8.1964 wegen des Verdachtes, vorsätzlich falsch ausgesagt zu haben, vorläufig festgenommen. Am nächsten Tag, den 14.8.1964, berichtigte und ergänzte der Zeuge Wal. seine Aussage vom vorhergehenden Tag. Er gab an, dass er auf Grund der Vorladung verwirrt und deprimiert gewesen sei. Er gab nun zu, selbst auf der Rampe gewesen zu sein. Mit aller Bestimmtheit erklärte er, dass Höcker auf Grund von Fernschreiben, die auf seinem Tisch gelegen hätten, die verschiedenen Abteilungen des Lagers telefonisch von der Ankunft der RSHA-Transporte verständigt und befohlen habe, man möge das Entsprechende veranlassen. Unter anderem habe er das Schutzhaftlager, die Politische Abteilung und die Abtlg. Verwaltung angerufen.
Von der Verteidigung sind Bedenken gegen die Richtigkeit dieser Aussage geltend gemacht worden, weil Wal. diese Aussage nicht frei gemacht habe, sondern unter dem Druck seiner vorläufigen Festnahme gestanden und eine erneute Verhaftung befürchtet habe. Seine vorläufige Festnahme sei nicht wegen einer vorsätzlichen falschen Aussage, sondern wegen einer etwaigen Beteiligung des Zeugen an Verbrechen in Auschwitz erfolgt. Dem Zeugen sei am 13.8.1964 vor Beendigung seiner Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft gesagt worden, dass seine vorläufige Festnahme entfalle, wenn er in der Hauptverhandlung vom 14.8.1964 seine Aussage berichtige. Dem Zeugen sei auch nicht von selbst am 14.8.1964 die geschilderte Tätigkeit des Angeklagten Höcker in Erinnerung gekommen. Ihm sei vielmehr von den vernehmenden Staatsanwälten vorgehalten worden, dass es so gewesen sein müsse, und dass Wal. als damaliger Spiess das wissen müsse. Die Aussage des Zeugen Wal. sei daher nicht verwertbar.
Das Schwurgericht hat den Zeugen Wal. am 25.3.1965 erneut vernommen. Bei dieser Vernehmung hat Wal. die am 14.8.1964 gemachte Aussage bestätigt und dahin präzisiert, dass er Höcker einige Male Fernschreiben hingebracht habe, und dass dieser daraufhin jedesmal in seiner Gegenwart die einzelnen Abteilungen von der Ankunft der Transporte verständigt habe und die Veranlassung des Erforderlichen befohlen habe.
Das Schwurgericht ist davon überzeugt, dass der Zeuge Wal. bei dieser Vernehmung die Wahrheit gesagt hat. Wenn er auch am 13.8. offensichtlich eine falsche Aussage gemacht hat, so ist das noch kein Grund, seine späteren Angaben als unglaubhaft und nicht verwertbar anzusehen. Die erste falsche Aussage war motiviert durch die Angst vor Strafe. Dem Zeugen war diese Angst in der Vernehmung anzumerken.
Bei der Vernehmung am 25.3.1965 war der Zeuge wie erleichtert. Er sprach frei und gelöst. Irgendeine Zwangslage bestand für ihn nicht. Auch eine erneute Verhaftung oder vorläufige Festnahme brauchte er nicht zu befürchten. Denn der Zeuge Staatsanwalt Wie. hat die bereits am 14.8.1964 von dem Zeugen Wal. gemachte Aussage bestätigt, dass ihm - Wal. - am 13.8.1964 durch die Staatsanwälte Wie. und Kü. keine Versprechungen gemacht worden sind, und dass er - Wal. - auch in keiner Weise unter Druck gesetzt worden sei. Nach der glaubhaften Aussage des Zeugen Staatsanwalt Wie. ist der Zeuge Wal. nur wegen des Verdachtes einer vorsätzlichen falschen Aussage festgenommen worden.
Sollte der Zeuge Wal. bei seiner Vernehmung am 14.8.1965 wegen der Festnahme am 13.8.1965 unter einem gewissen Druck gestanden haben, so war dieser am 25.3.1965 jedenfalls nicht vorhanden. Nach der Überzeugung des Schwurgerichts hat der Zeuge Wal. den Angeklagten Höcker nicht wahrheitswidrig belastet. Irgendein Motiv hierfür bestand für den Zeugen nicht. Vor allem konnte er aus einer wahrheitswidrigen Belastung des Angeklagten Höcker keine Vorteile für sich ziehen. Er musste sich im Gegenteil zumindest indirekt selbst belasten. Wenn er - wie er ausgesagt hat - dem Angeklagten Höcker die Fernschreiben gebracht hat, hat er nämlich ebenfalls einen - wenn auch geringen - Tatbeitrag für die Abwicklung der RSHA-Transporte geleistet. Wäre - wie es der Angeklagte Höcker behauptet - allein die Kommandantur des Lagers Birkenau für die Benachrichtigung der einzelnen Abteilungen zuständig gewesen, so hätte der Zeuge das ohne Zweifel bei seiner ersten Vernehmung angegeben. Denn damit hätte er auch sich in jeder Beziehung entlasten können.
Schliesslich stimmen die Angaben des Zeugen Wal., die er in der Vernehmung vom 25.3.1965 gemacht hat, auch überein mit der aus den anderen Beweismitteln gewonnenen Erkenntnis und Überzeugung, dass die Kommandantur des Lagers A I, und nicht die Kommandantur des Lagers Birkenau, für die Benachrichtigung der einzelnen Abteilungen und die Abwicklung der RSHA-Transporte zuständig gewesen ist.
Der Angeklagte Höcker war auch während der Tötung jüdischer Menschen in Begleitung höherer SS-Führer bei den Gaskammern. Dies ist erwiesen auf Grund der Aussage des Zeugen Pa. Der Zeuge hat den Angeklagten Höcker in der Hauptverhandlung wiedererkannt. Allerdings kannte der Zeuge weder in Auschwitz noch jetzt den Namen des Angeklagten Höcker. Es war daher die Möglichkeit einer Verwechslungsgefahr in Erwägung zu ziehen. Bezüglich des Angeklagten St. hat sich der Zeuge Pa. geirrt. Er hat geglaubt, ihn auch an den Krematorien gesehen zu haben. St. war aber im Jahre 1944 bereits von Auschwitz weg. Der Zeuge hat ihn daher offensichtlich mit einem anderen SS-Mann verwechselt. Bei St. konnte der Zeuge aber keine näheren Angaben machen.
Bezüglich des Angeklagten Höcker konnte sich der Zeuge aber noch erinnern, dass er mit anderen höheren SS-Führern zusammen gewesen sei. Vor diesen habe er salutiert. Auf Grund dieser näheren Angaben hat das Gericht die Überzeugung gewonnen, dass sich Pa. in der Person des Angeklagten Höcker nicht geirrt hat. Denn es erscheint naheliegend, dass Höcker als Adjutant den Kommandanten Baer oder den "Sonderbeauftragten für die Judenumsiedlung", Höss, zu den Krematorien begleitet hat. Da Pa. nichts über eine besondere Tätigkeit des SS-Führers, der vor höheren SS-Führern salutiert hat, berichten konnte, entspricht auch die Schilderung des Zeugen der Stellung undTätigkeit eines Lageradjutanten.
Schliesslich hat dem Angeklagten Höcker auch die Fahrbereitschaft unterstanden. Dies folgt nicht nur aus der Lagerordnung, sondern auch aus einer Reihe von Urkunden, die verlesen worden sind. So ergibt sich aus den Kraftfahrzeuganforderungen der Abteilung II vom 26.5.1944, 31.5.1944, 5.7.1944, einer weiteren Anforderung vom 26.5.1944, aus den Kraftfahrzeuganforderungen der Technischen Abteilung vom 30.5.1944 und der Kraftfahrzeuganforderung der Abteilung Verwaltung vom 31.5.1944, dass Höcker all diese Anforderungen als Adjutant genehmigt hat. Wenn er aber die Benutzung und den Einsatz von Kraftfahrzeugen zu genehmigen hatte, so folgt daraus, dass ihm die Fahrbereitschaft unterstanden hat. Schliesslich ist auch auf Grund einer Reihe von Standortbefehlen erwiesen, dass der Angeklagte Höcker Adjutant des Standortältesten gewesen ist. Aus den verlesenen Standortbefehlen vom 3.8.1944, 30.8.1944, 20.10.1944 und 11.10.1944 ergibt sich, dass der damalige Lagerkommandant des Lagers A I, Baer, zu dieser Zeit Standortältester und Höcker Adjutant desselben gewesen ist. Denn Baer hat die Befehle unterzeichnet, während der Angeklagte Höcker für die Richtigkeit die Abschriften gezeichnet hat.
Aus dem Standortbefehl vom 27.6.1944 ergibt sich, dass Höss zu dieser Zeit Standortältester gewesen ist, und dass Höcker auch in diesem Fall f.d.R. der Abschrift gezeichnet hat, also Adjutant des Standortältesten gewesen ist.
Weiter ergibt sich aus einem Aktenvermerk vom 17.6.1944, dass Höss zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Standortältester in Auschwitz gewesen ist.
Die Zahl der Transporte, an deren Vernichtung der Angeklagte Höcker mitgewirkt hat, konnte nicht festgestellt werden. Das Schwurgericht hat daher - genau wie im Falle Mulka -, da es sich nicht auf unsichere Schätzungen einlassen durfte, nur die Mindestzahl der Transporte, an deren Vernichtung der Angeklagte Höcker mit jeden Zweifel ausschliessender Sicherheit mitgewirkt hat, seinen Feststellungen und seinem Urteil zugrunde gelegt.
Der Zeuge Wal. hat glaubhaft bekundet, dass er den Angeklagten Höcker "einige Male" dabei beobachtet habe, wie er nach der Ankündigung von RSHA-Transporten die einzelnen Abteilungen benachrichtigt und die Einsatzbefehle für den Rampendienst gegeben habe. Das bedeutet, dass Höcker mehr als zweimal, mindestens also dreimal den gesamten Vernichtungsapparat in Bewegung gesetzt, also mindestens bei drei verschiedenen Transporten an der Vernichtung beteiligt gewesen ist. Die Ungarn-Transporte, die ab Mai 1944 in Auschwitz ankamen, waren nach der glaubhaften Aussage des Zeugen Hi., der in der damaligen Zeit bei der Güterabfertigung am Bahnhof Auschwitz beschäftigt gewesen ist, durchschnittlich 3000 Personen stark. Rechnet man hiervon 25% ab, die im Höchstfall als arbeitsfähig ausgesondert und in das Lager aufgenommen worden sind, so verbleiben 2250 Menschen, die getötet worden sind. Um ganz sicher zu gehen und allen möglichen Schwankungen Rechnung zu tragen, ist das Schwurgericht nur davon ausgegangen, dass von jedem der drei Transporte, an deren Vernichtung der Angeklagte Höcker mitgewirkt hat, mindestens 1000 Menschen getötet worden sind.
V. Rechtliche Würdigung
Der Angeklagte Höcker hat durch die Benachrichtigung der verschiedenen Abteilungen nach Ankündigung von RSHA-Transporten und das Geben der Einsatzbefehle in mindestens 3 Fällen die Tötungen von mindestens je 1000 Menschen gefördert, also jeweils einen kausalen Tatbeitrag zum Mord (vgl. oben unter A. (Mulka) V.) jeweils begangen in gleichartiger Tateinheit geleistet.
Auch Höcker hat auf Befehl seiner Vorgesetzten gehandelt. Seine Taten sind daher, da er ebenfalls Angehöriger der Waffen-SS gewesen ist, im Rahmen des §47 Militärstrafgesetzbuch zu beurteilen.
Der Angeklagte Höcker hat klar erkannt, dass die Befehle, die die Tötung jüdischer Menschen anordneten, ein allgemeines Verbrechen bezweckten. Das hat er selbst eingeräumt. Hierzu kann im übrigen auf die Ausführungen, die bei der rechtlichen Würdigung der Straftaten des Angeklagten Mulka gemacht worden sind, verwiesen werden.
Dafür, dass der Angeklagte Höcker aus innerster Überzeugung die Tötungen der jüdischen Menschen bejaht und die Ziele der damaligen Machthaber, die Juden auszurotten, zu seinem eigenen Anliegen gemacht, also die Tötungen als eigene Taten gewollt habe, haben sich keine sicheren Anhaltspunkte ergeben. Irgendwelche Umstände, aus denen auf einen besonderen Eifer des Angeklagten Höcker geschlossen werden könnte, sind nicht bekannt geworden. So konnte nicht festgestellt werden, dass er aus eigenem Antrieb auf die Rampe gegangen und die SS-Führer, Unterführer oder Mannschaften zu radikalem Vorgehen angetrieben oder sie auf sonstige Weise in ihrer Tätigkeit bestärkt hätte. Nach den getroffenen Feststellungen hat er nur das getan, was ihm befohlen worden war. Daraus konnte trotz seiner langjährigen Zugehörigkeit zur SS und seiner langjährigen Tätigkeit in Konzentrationslagern mit Sicherheit nur der Schluss gezogen werden, dass er die Vernichtungsaktionen als fremde Taten, nämlich als Taten des Führers und seiner Komplizen, fördern und unterstützen wollte. Seine Tatbeiträge können daher nur als Beihilfe im Sinne des §49 StGB bewertet werden.
Irgendwelche Rechtfertigungsgründe für die Beteiligung des Angeklagten Höcker an den Massentötungen sind nicht ersichtlich.
Der Angeklagte Höcker hat auch vorsätzlich gehandelt. Er wusste - wie unter II. festgestellt - dass er durch seine oben geschilderte Mitwirkung jeweils einen kausalen Tatbeitrag für die Massentötungen leistete und er kannte die gesamten Tatumstände, die die Beweggründe der Haupttäter als niedrig und die Art und Weise der Tötungen als heimtückisch und grausam kennzeichnen.
Der Angeklagte Höcker wusste auch - ebenso wie der Angeklagte Mulka -, dass die Massentötungen der Juden rechtswidrig waren. Oben ist bereits ausgeführt worden, dass er erkannt hat, dass die Massentötungen der unschuldigen jüdischen Menschen trotz des Befehls Hitlers verbrecherisch waren. Er hat auch nicht irrig angenommen, dass die Tötungsbefehle für ihn trotz ihres verbrecherischen Charakters verbindlich seien. Er beruft sich selbst nicht darauf. Im übrigen kann hierzu auf die unter A.V.2. gemachten Ausführungen Bezug genommen werden.
Der Angeklagte Höcker hat auch nicht im Nötigungsnotstand (§52 StGB) gehandelt. Er selbst behauptet nicht, er sei zur Befolgung irgendwelcher Befehle gezwungen worden. Es liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sein Wille gebeugt worden ist. Er hat vielmehr als williger Befehlsempfänger die ihm gegebenen Befehle ausgeführt. Der Gedanke, sich der Mitwirkung an den Vernichtungsaktionen zu entziehen, ist ihm gar nicht gekommen. Dagegen spricht, dass er seit 1939 in KZ-Lagern Dienst getan hat und immer wieder befördert worden ist. Vor seiner Versetzung nach Auschwitz war er zuletzt Adjutant im KL Majdanek/Lublin. Die Tatsache, dass er vor Beginn der Ungarn-Transporte als Adjutant nach Auschwitz versetzt worden ist, zeigt, dass er sich dort bewährt hat und man ihn für geeignet hielt, an den mit Beginn der RSHA-Transporte aus Ungarn noch stärker einsetzenden Massenvernichtungen der Juden in Auschwitz mitzuwirken. Daraus folgt weiter, dass er seinen KZ-Dienst stets zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten erfüllt und stets die Befehle seiner Vorgesetzten willig ausgeführt haben muss.
Höcker hat auch nichts unternommen, um von Auschwitz wegzukommen oder sich irgendwie der Mitwirkung an der Massenvernichtung der Juden zu entziehen. Auch das spricht dafür, dass er ein williger Befehlsempfänger gewesen ist. Der Angeklagte Höcker hat sich auch nicht in einem allgemeinen Notstand (§54 StGB) befunden. Hier gilt das zu §52 StGB Gesagte. Es liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Angeklagte Höcker irrig die tatsächlichen Voraussetzungen eines Nötigungsnotstandes im Sinne des §52 StGB oder im Sinne des §54 StGB angenommen hätte. Er selbst beruft sich nicht darauf. Bei seinem bereits erörterten Gesamtverhalten ist das auch nicht möglich. Er hat als williger Befehlsempfänger die empfangenen Befehle getreu seinem SS-Eid ausgeführt, ohne überhaupt eine Verweigerung der Mitwirkung in Erwägung zu ziehen.
Der Angeklagte Höcker hat Beihilfe zu mindestens drei selbständigen Mordtaten, bei denen jeweils mindestens 1000 Menschen durch ein und dieselbe Handlung getötet worden sind, geleistet. Er hat die Taten der Haupttäter zusammen mit anderen SS-Angehörigen bewusst gefördert. Daher war er wegen gemeinschaftlicher Beihilfe (§§47, 49 StGB) zu gemeinschaftlichem Mord (§§47, 211 StGB) in mindestens drei Fällen (§74 StGB), wobei jeweils 1000 Menschen durch ein und dieselbe Handlung (§73 StGB) getötet worden sind, zu bestrafen.
VI. Hilfsbeweisanträge
Der Hilfsbeweisantrag des Verteidigers des Angeklagten Höcker, das staatsanwaltschaftliche Protokoll über die Vernehmung des Zeugen Wal. nach seiner Verhaftung durch die Staatsanwaltschaft vollständig zu verlesen, war gemäss §244 StPO abzulehnen, da diese Verlesung unzulässig ist. Da der Zeuge Wal. noch lebt und jederzeit vernommen werden kann, darf seine Vernehmung nicht durch Verlesung des über eine frühere Vernehmung aufgenommenen Protokolls ersetzt werden (§250 Satz 2 StPO). Die Voraussetzungen für die Verlesung des Protokolls nach §251 StPO liegen nicht vor. Im übrigen ist der Zeuge Wal. nach seiner vorläufigen Festnahme und Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft noch zweimal in der Hauptverhandlung vernommen worden. Der Verteidiger des Angeklagten Höcker und der Angeklagte Höcker selbst hätten somit ausreichend Gelegenheit gehabt, dem Zeugen Wal. Vorhalte aus diesem Protokoll zu machen.
Hiervon abgesehen, ist in dem Hilfsbeweisantrag nicht angegeben worden, zu
welchem Beweisthema die Verlesung des Protokolls erfolgen soll. Daher war der Hilfsbeweisantrag auch aus diesem Grunde abzulehnen.
VII. Strafzumessung
Wenn auch der Angeklagte Höcker in der gleichen Funktion wie der Angeklagte Mulka, nämlich als Adjutant des Lagerkommandanten und des Standortältesten, an der Massenvernichtung der jüdischen Menschen mitgewirkt hat, so kann nach Auffassung des Schwurgerichts bei der Strafzumessung das Mass seiner Schuld nicht die gleiche Beurteilung erfahren, wie beim Angeklagten Mulka. Als der Angeklagte Höcker nach Auschwitz kam, war bereits eine eingespielte Organisation vorhanden, durch die die jüdischen Menschen zu Tode gebracht wurden. Die "Todesmaschinerie" lief bereits auf vollen Touren, die Vernichtung der RSHA-Transporte erfolgte durch die damit befassten SS-Angehörigen, von denen jeder wusste, was er zu tun hatte, fast automatisch. In diese bereits bestehende Organisation wurde der Angeklagte Höcker hineingestellt. Es bedurfte keiner besonderen Tätigkeit des Angeklagten Höcker mehr, um die Vernichtung der pausenlos eintreffenden RSHA-Transporte in Gang zu halten.
Der Angeklagte Höcker war - anders als der Angeklagte Mulka - nicht mit auf der Rampe, jedenfalls konnte ihm das nicht nachgewiesen werden. Es konnte - anders als beim Angeklagten Mulka - ferner nicht festgestellt werden, dass er jemals bei der Abwicklung der RSHA-Transporte auf der Rampe die Oberaufsicht geführt oder sich in anderer Weise persönlich um die Vernichtung der jüdischen Menschen gekümmert hat. Er stand somit dem Geschehen nicht so nahe, wie der Angeklagte Mulka. Auch konnte nicht festgestellt werden, dass er sich sonst gegenüber Häftlingen des Lagers brutal verhalten oder in irgendeiner anderen Weise gegen irgendeinen Häftling persönlich tätig geworden wäre. Seine nachgewiesene Mithilfe an der Massenvernichtung jüdischer Menschen erschöpfte sich in der befohlenen Schreibtischtätigkeit. Allerdings kann das Mass seiner Schuld deswegen nicht so gering bewertet werden, dass als Sühne für die einzelnen Tatbeiträge zu den mindestens drei Mordtaten Zuchthausstrafen in Frage kommen können, die an der unteren Grenze des Strafrahmens liegen.
Es konnte nicht unberücksichtigt bleiben, dass auch der Angeklagte Höcker in seiner Funktion als Adjutant eine gewisse Schlüsselstellung innehatte und dass er durch die Benachrichtigung der einzelnen Abteilungen und das Geben der Einsatzbefehle nach der Ankündigung der RSHA-Transporte jeweils den gesamten Vernichtungsapparat erst in Gang gesetzt hat. Als Obersturmführer und Adjutant trifft ihn auch eine höhere Verantwortlichkeit als die ihm untergebenen SS-Unterführer und Mannschaften, deren Vorbild er hätte sein müssen.
Die grosse Anzahl der Opfer, die durch die mindestens 3 Mordtaten, an denen der Angeklagte Höcker mitgewirkt hat, getötet worden sind, erhöht den Unrechtsgehalt seiner Beihilfehandlungen. Nach der gesamten damaligen Sachlage kann es nicht zweifelhaft sein, dass der Angeklagte Höcker gewusst hat, wieviel Menschen jeweils mit den RSHA-Transporten ankamen und wieviele von ihnen den Tod in den Gaskammern erleiden mussten. Die Zahl der Opfer, die unter seiner Mitwirkung getötet worden sind, muss daher strafschärfend ins Gewicht fallen.
Strafmildernd hat das Schwurgericht berücksichtigt, dass sich der Angeklagte im übrigen stets straffrei geführt hat. Er hat in seinem Leben stets gearbeitet und ein unauffälliges Leben geführt. Nach dem Kriege hat er sehr schnell wieder in ein geordnetes bürgerliches Leben zurückgefunden und seinen Lebensunterhalt durch Arbeit verdient. 1952 hat er Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft in Bielefeld gegen sich selbst erstattet, um ein Spruchkammerverfahren gegen sich durchführen zu lassen.
Bei Abwägung all dieser Gesichtspunkte hielt das Schwurgericht für jede gemeinschaftliche Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord eine Zuchthausstrafe von je 6 Jahren für eine angemessene Sühne.
Aus diesen Einzelstrafen war gemäss §74 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden, die in Höhe von 7 Jahren Zuchthaus als eine angemessene Sühne erschien.
C. Die Straftaten des Angeklagten Boger
I. Lebenslauf des Angeklagten Boger
Der Angeklagte Boger ist als ältester Sohn eines Kaufmanns am 19.12.1906 in Stuttgart-Zuffenhausen geboren. Er hat noch zwei Geschwister. Von 1913 bis 1922 besuchte er die Fangelsbach-Bürgerschule, eine Mittelschule, an der er die Mittlere Reife erlangte. Seine Lehrer waren, wie er angibt, deutschnational eingestellt. Unter ihrem Einfluss trat er bereits im Jahre 1922 der NS-Jugend bei (später Hitlerjugend).
Nach Verlassen der Schule im Jahre 1922 begann der Angeklagte eine kaufmännische Lehre bei der Firma Rheinstahl, die er nach dreijähriger Lehrzeit mit der Kaufmannsgehilfenprüfung beendigte. Im Sommer 1925 wurde der Angeklagte als Angestellter beim Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband, Gaugeschäftsstelle Stuttgart, eingestellt. Er trat ferner dem Artamanen-Bund, einem freiwilligen Arbeitsdienstverband, bei. Ziel dieses Bundes war es - wie der Angeklagte Boger angibt - die Landarbeiterfrage zu lösen. Es war ein freiwilliger Arbeitsdienst auf dem Lande, der die nicht bestehende allgemeine Wehrpflicht ersetzen sollte. Im Anschluss an seine Tätigkeit bei dem Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband arbeitete der Angeklagte bei verschiedenen Firmen in Stuttgart, Dresden und Friedrichshafen als kaufmännischer Angestellter. Im Frühjahr 1932 wurde er arbeitslos.
Bereits im Jahre 1930 war der Angeklagte, als er beruflich in Dresden weilte, in die allgemeine SS eingetreten. Er gibt an, er sei in die SS "übernommen" worden, zuletzt hatte er bei der allgemeinen SS den Rang eines SS-Hauptsturmführers. Am 5.3.1933 wurde der Angeklagte als SS-Angehöriger zur Hilfspolizei nach Friedrichshafen einberufen. Am 1.7.1933 wurde er zur politischen Bereitschaftspolizei nach Stuttgart versetzt und dort bei einer Sonderaktion "Bewachung von beschlagnahmten Bauten" als Hilfspolizeibeamter eingesetzt. Nach einem etwa 6wöchigen Dienst bei dieser Dienststelle kam er zur württembergischen politischen Polizei, wo er alsbald in das Kriminalangestelltenverhältnis überführt wurde. Im weiteren Verlauf des Jahres 1933 wurden in Württemberg Aussenstellen der politischen Polizei errichtet, unter anderem auch in Friedrichshafen. Der Angeklagte Boger kam im Oktober 1933 zu der Aussenstelle der württembergischen politischen Polizei in Friedrichshafen, wo er als Angestellter Dienst tat. Dann machte er mehrere Lehrgänge mit und wurde im Jahre 1937 nach der Verreichlichung der Polizei zum Kriminalsekretär (in Württemberg hiess es "Kriminalkommissar") ernannt. Er verblieb weiterhin bei der Aussenstelle in Friedrichshafen. Im Jahre 1934 machte der Angeklagte nach seinen Angaben eine Übung bei der Reichswehr und zwar bei dem Infanterieregiment 14 mit. Nach 6 Wochen wurde er zum Unteroffizier und am 10.5.1937 zum Feldwebel befördert. Den Einmarsch in Österreich im Jahre 1938 will der Angeklagte als Soldat (Feldwebel der Reserve) mitgemacht haben. Anschliessend habe er sich - so behauptet er - bei der Gestapo melden müssen. Er sei aber trotz der Aufforderung, Dienst bei der Gestapo zu tun, weiter bei der Truppe geblieben.
Nach Ausbruch des Krieges wurde der Angeklagte als Kriminalsekretär zur Stapo-Leitstelle nach Zichenau abgeordnet. Etwa drei Wochen später wurde er mit dem Aufbau und der Leitung des Grenzpolizeikommissariats Ostrelenka beauftragt. In Ostrelenka habe er - so behauptet der Angeklagte - auf Anordnung seiner Vorgesetzten, den Verbindungsoffizier der Wehrmacht im Mai 1940 auf unauffällige Weise umbringen sollen. Das habe er abgelehnt. Aus diesem Grunde sei er in Haft genommen und nach Berlin geschickt worden. Danach wurde der Angeklagte zur Staatspolizeistelle Hohensalza und von dort nach Kutnow versetzt, wo er mit der Leitung des Grenzpolizeikommissariats beauftragt wurde. Nach vier Wochen kam er wieder nach Hohensalza zurück. Von da musste er sich in Berlin beim RSHA SD II melden. Er wurde - wie er angibt - für 4 Monate in "Ehrenhaft" genommen und am 18.12.1940 wieder entlassen. Ihm wurde zur Last gelegt, eine Abtreibungshandlung versucht zu haben. Vom Dienst wurde er suspendiert.
Am 11.11.1941 wurde der Angeklagte zum SS-Polizeipionierbataillon nach Dresden einberufen. Mit dieser Einheit kam er an der Wolchow-Front zum Einsatz. Er befand sich im Bewährungszug des Polizeipionierbataillons als Mannschaftsdienstgrad. Mitte März 1942 wurde er verwundet und kam ins Lazarett. Im Juli 1942 wurde er aus dem Reservelazarett entlassen und kam als Pionier zum SS- und Polizeipionierersatzbataillon I nach Dresden zurück. Von Dresden wurde der Angeklagte am 1.12.1942 zum KL Auschwitz versetzt. Im Oktober 1942 war dem Angeklagten Boger der militärische Dienstgrad (Oberfeldwebel) rückwirkend wieder verliehen worden. Er kam daher als Oberscharführer der Waffen-SS nach Auschwitz.
Dort wurde er zunächst als Zugführer der 2. Wachkompanie eingesetzt. Bei der Wachtruppe war er jedoch nur ganz kurze Zeit. Sein Kompaniechef empfahl ihm - so gibt es der Angeklagte an - sich zur Politischen Abteilung des KL zu melden. Dies tat er auch. Er wurde daraufhin zur Politischen Abteilung versetzt. Der Leiter der Politischen Abteilung war der Untersturmführer Grabner. Dieser war bei der Polizei nur Kriminalassistent gewesen. Boger dagegen war bei der Polizei im Range eines Kriminalsekretärs. Er fühlte sich daher Grabner überlegen. Die Zusammenarbeit zwischen beiden war nach den Angaben des Angeklagten Boger nicht gut. Aus diesen - rein persönlichen - Gründen will sich der Angeklagte Boger von Anfang an, allerdings ohne Erfolg, von der Politischen Abteilung weggemeldet haben. Er verblieb in Auschwitz bis zur Auflösung des Lagers im Januar 1945. In diesen letzten Tagen des Monats Januar 1945 transportierte der Angeklagte Boger mit dem damaligen Leiter der Politischen Abteilung, dem SS-Untersturmführer Schurz, seinem Stellvertreter Westphal, dem SS-Oberscharführer Kirschner und dem Angeklagten Pery Broad eine LKW-Ladung Akten nach Buchenwald.
Am nächsten Tag begab er sich mit Kirschner, Schurz und Broad zum Konzentrationslager Mittelbau Dora, Nordhausen, wo er seine Tätigkeit bei der Politischen Abteilung wieder aufnahm. Nach einer Dienstreise nach Chemnitz kam er erst wieder zum Konzentrationslager Mittelbau Dora zurück, als dieses bereits geräumt war. Bei Ellrich erreichte er den letzten Transportzug mit Häftlingen und fuhr mit diesem bis Osterode. Dann begleitete er zusammen mit einem SS-Untersturmführer und einem SS-Unterführer etwa 5000 Häftlinge auf einem Tag- und Nachtmarsch durch den Harz. In Vienenburg erreichte er mit den Häftlingen noch den letzten Güterzug nach Ravensbrück. Von dort sollte er in den letzten Apriltagen 1945 noch zum Fronteinsatz kommen. Die Kampftruppe, der der Angeklagte angehörte, löste sich jedoch auf, und der Angeklagte konnte sich nach Ludwigsburg zu seinen Eltern absetzen.
Am 19.Juni 1945 wurde er von der amerikanischen Militärpolizei verhaftet, in das Landesgefängnis Ludwigsburg eingeliefert und von dort über die Lager Osweil und Zuffenhausen nach Dachau gebracht. Am 22.November 1946 sollte er mit einem Transport an Polen ausgeliefert werden. Es gelang ihm jedoch, bei Furth im Walde zu entfliehen. Anschliessend hielt er sich etwa 3 Jahre ohne polizeiliche Anmeldung in der Gegend von Crailsheim auf, wo er bei Bauern arbeitete. Am 26.Juli 1949 wurde er auf Grund einer Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Ravensburg verhaftet. Bis zum 31.August 1949 befand er sich im Gerichtsgefängnis Langenburg in Untersuchungshaft. Ihm wurde zur Last gelegt, im Jahre 1936 den Landwirt Franz Riedinger bei einer Vernehmung misshandelt zu haben. Das Verfahren wurde eingestellt. Nach seiner Entlassung begab sich der Angeklagte zunächst nach Schmalfelden bei Crailsheim, um sich Papiere zu beschaffen, und anschliessend zu seiner nach Niederwetz (Kreis Wetzlar) ausgesiedelten Familie. Er war zunächst arbeitslos. Am 8.September 1950 wurde er von der Firma Heinkel in Zuffenhausen als Arbeiter eingestellt und dort anfangs als Hilfsarbeiter, dann als Maschinenarbeiter und zuletzt als kaufmännischer Angestellter beschäftigt.
Der Angeklagte heiratete am 28.2.1931 in Radeberg bei Dresden die Johanna Herr. Aus dieser Ehe sind drei Kinder hervorgegangen, von denen 2 kurz nach der Geburt gestorben sind.
Diese Ehe wurde am 27.Februar 1941 durch das Landgericht Ravensburg aus dem alleinigen Verschulden des Angeklagten geschieden. Am 24.4.1941 heiratete der Angeklagte seine jetzige Ehefrau.
An Auszeichnungen besitzt der Angeklagte Boger das KVK II. Klasse und ausserdem die Sudetengau- und Ostmedaille. Der Angeklagte Boger befindet sich seit dem 8.10.1958 in dieser Sache in Untersuchungshaft.
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Mitwirkung des Angeklagten Boger an der Massentötung jüdischer Menschen in Auschwitz (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
Der Angeklagte Boger wurde als Angehöriger der Politischen Abteilung (Ermittlungsabteilung) zum sog. "Rampendienst" eingeteilt. Er war in einer unbestimmten Anzahl von Fällen bei der Abwicklung von sog. RSHA-Transporten auf der Rampe anwesend. Seine Aufgabe hierbei war es insbesondere - wie es oben unter A.II. bereits geschildert worden ist -, die Angehörigen des Häftlingskommandos und die SS-Angehörigen beim Rampendienst zu überwachen. Der Angeklagte Boger hat diese Aufgaben auch erfüllt. Er hat aufgepasst, dass die Häftlinge des Häftlingskommandos nicht mit den Zugängen sprachen. Er hat ferner beim Aufstellen und bei der Einteilung der angekommenen Menschen geholfen. Dabei hat er verhindert, dass die bereits als arbeitsunfähig beurteilten Menschen sich wieder zu der Gruppe der Arbeitsfähigen stellten. Schliesslich hat er auch die SS-Führer, die SS-Unterführer und SS-Männer daraufhin beobachtet, ob sie ihren Rampendienst entsprechend den gegebenen Befehlen richtig versähen, insbesondere nicht in unzulässiger Weise mit den Zugängen sprächen und sich nicht am Häftlingsgut vergriffen.
In mindestens einem Fall, bei dem der Angeklagte Boger die geschilderten Tätigkeiten ausgeübt hat, wurden von einem RSHA-Transport mindestens 1000 Menschen durch Gas getötet. Im übrigen konnte nicht festgestellt werden, wie oft der Angeklagte Boger Rampendienst verrichtet hat.
Der Angeklagte Boger wusste, dass die mit den RSHA-Transporten angekommenen Juden nur wegen ihrer Abstammung als Angehörige einer sog. "minderwertigen Rasse" unschuldig getötet wurden. Ihm war auch bekannt, dass die gesamten Vernichtungsaktionen unter strengster Geheimhaltung ausgeführt und die Opfer in der bereits geschilderten Weise über ihr bevorstehendes Schicksal getäuscht wurden. Schliesslich kannte er auch die näheren Umstände, unter denen die jüdischen Menschen in den Gaskammern getötet wurden.
Ihm war klar, dass er als notwendiges Glied in den Vernichtungsapparat eingespannt war und durch den von ihm geleisteten Rampendienst die Vernichtungsaktionen förderte.
2. Die Mitwirkung des Angeklagten Boger bei einer sog. Lagerselektion (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
Wie oben im 2. Abschnitt unter VII.4. bereits ausgeführt worden ist, fanden von Zeit zu Zeit im Stammlager und im Lager Birkenau sog. Lagerselektionen statt, bei denen arbeitsunfähige Häftlinge ausgemustert und anschliessend durch Gas getötet worden sind.
Der Angeklagte Boger hat sich als Angehöriger der Politischen Abteilung an mindestens einer Lagerselektion im Lager Birkenau beteiligt. Die Ausmusterung der Arbeitsunfähigen wurde in diesem Fall durch einen Arzt vorgenommen. Zuvor liessen der Angeklagte Boger und die Blockführer die Häftlinge des betreffenden Lagerabschnittes nackt antreten. Dann kam ein SS-Arzt, der bestimmte, wer von den angetretenen Häftlingen als arbeitsunfähig auszusondern sei. Der Angeklagte Boger und die Blockführer machten den Arzt bei dieser Ausmusterung auf verschiedene schwache Häftlinge, die nach ihrer Meinung nicht mehr lebenswert erschienen, aufmerksam, wobei sie mit den Fingern auf sie zeigten.
Die vom Arzt als arbeitsunfähig bezeichneten Häftlinge wurden dann von dem Angeklagten Boger und den Blockführern zur Seite geschickt und dort gesondert aufgestellt. Während der gesamten Musterung achteten sie darauf, dass keiner der als arbeitsunfähig ausgesonderten Häftlinge wieder zu der anderen Gruppe zurückschlich und so dem Tode entging. Bei dieser Selektion wurde eine unbestimmte Anzahl von Häftlingen, mindestens jedoch 10, als arbeitsunfähig ausgesondert und kurz danach durch Gas in einer der vorhandenen Gaskammern getötet. Der Angeklagte Boger wusste, dass die ausgemusterten Häftlinge unschuldig getötet werden sollten. Ihm war auch bekannt, dass ihre Tötung nur deswegen erfolgte, weil sie nicht mehr arbeitsfähig erschienen und damit - nach Auffassung der SS - nur eine unnötige Belastung für das Lager und insbesondere die damalige Verpflegungslage bedeuteten.
Dem Angeklagten Boger war auch klar, dass er durch seine geschilderte Mitwirkung zum Tode der ausgemusterten Häftlinge einen Beitrag leistete.
3. Die Mitwirkung des Angeklagten Boger bei den sog. Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen von Häftlingen an der Schwarzen Wand auf dem Hof zwischen Block 10 und 11 (Eröffnungsbeschluss Ziffer 2 und 3)
Die Arrestzellen im Keller des Blockes 11 waren fast ständig überbelegt. Oft befanden sich 8-10 Personen, manchmal auch noch mehr, in einer Zelle. Die Arrestanten hatten dann nicht einmal Platz zum Sitzen. Da fast ständig Häftlinge im Lager durch Angehörige der Politischen Abteilung, insbesondere durch den Angeklagten Boger, festgenommen wurden, reichten die 28 Arrestzellen trotz ihrer engen Belegung häufig nicht zur Unterbringung der Arrestanten aus. Um immer wieder Platz für Neuzugänge zu schaffen, "räumte" man daher den Bunker von Zeit zu Zeit "aus", indem man einen Teil der in den Zellen einsitzenden Häftlinge an der Schwarzen Wand erschoss. Diese sog. Bunkerentleerungen, die der Leiter der Politischen Abteilung, SS-Untersturmführer Grabner, in seinem österreichischen Dialekt "Bunker-Ausstauben" nannte, fanden in bestimmten Zeitabständen statt. An ihnen nahmen der Leiter und Angehörige der Politischen Abteilung, der erste oder einer der beiden anderen Schutzhaftlagerführer (manchmal auch mehrere), einer der Arrestaufseher des Blockes 11 und manchmal auch der Rapportführer teil.
Im einzelnen spielten sich solche Bunkerentleerungen in der Regel wie folgt ab: Der erste Schutzhaftlagerführer Aumeier und der Leiter der Politischen Abteilung, Grabner, begaben sich mit weiteren Angehörigen der Politischen Abteilung und den anderen bereits genannten Personen in den Bunker. Der diensthabende Arrestaufseher von dem Block 11 ging mit in den Keller und schloss in Gegenwart dieser Gruppe die einzelnen Zellen nacheinander auf. Der Kalfaktor des Blockes 11 - ein Funktionshäftling - ging ebenfalls mit in den Keller. Der Blockschreiber des Blockes 11 hielt sich am Eingang des Bunkers am Fuss der Treppe auf. Wenn der Arrestaufseher eine Zelle aufgeschlossen hatte, meldete der älteste Häftling die Belegstärke der Zelle. Dann wurden die einzelnen Häftlinge, die sich in den betreffenden Zellen befanden, mit ihrer Nummer aufgerufen. Dies geschah entweder durch den Lagerführer, der eine Liste dabei hatte oder den Blockschreiber. In der Regel referierte dann der Sachbearbeiter der Politischen Abteilung, der den Fall des aufgerufenen Häftlings bearbeitet hatte, kurz über den Fall. Er erklärte kurz, was gegen den Häftling vorlag und welches Ergebnis seine Ermittlungen - von seinem Standpunkt aus - gehabt hatten. Unmittelbar danach wurde dann über das Schicksal des betreffenden Häftlings entschieden. Es gab für jeden Häftling drei Möglichkeiten. Entweder wurde er in den Waschraum befohlen, das bedeutete, dass er unmittelbar danach an der Schwarzen Wand auf dem Hof zwischen Block 10 und 11 erschossen werden sollte oder er wurde angewiesen, in der Zelle zu bleiben. Das bedeutete, dass noch weitere Untersuchungen gegen ihn geführt werden sollten. Eine weitere Möglichkeit war, dass die Häftlinge zur Schreibstube befohlen wurden. Von dort wurden sie dann entweder in das Lager entlassen oder in die Strafkompanie für längere Zeit eingewiesen. Möglich war auch, dass die Angehörigen der dritten Gruppe mit einer sonstigen Lagerstrafe belegt wurden.
Am stärksten war meist die Gruppe, die zum Erschiessen bestimmt wurde. Die Entscheidung über das Schicksal eines Häftlings traf in der Regel der Lagerführer Aumeier, wenn es sich um einen Häftling handelte, der von der Lagerführung in den Arrest eingewiesen worden war. Bei Häftlingen, die von der Politischen Abteilung in den Arrest gebracht worden waren, entschied der Leiter der Politischen Abteilung in Zusammenarbeit mit den Sachbearbeitern. Als Ranghöchster hatte der Leiter der Politischen Abteilung zwar die letzte Entscheidungsbefugnis, manche Sachbearbeiter hatten aber auf seine Entscheidung einen massgebenden Einfluss. Da Grabner die einzelnen Fälle nicht kannte, hatten es die Sachbearbeiter in der Hand, einen Fall und ein Ermittlungsergebnis so vorzutragen, dass nach der damaligen Übung bei Bunkerentleerungen nur eine Erschiessung zu erwarten war. Die Entscheidung erfolgte stets in ganz kurzer Zeit. Häufig wurden nur wenige Worte zwischen den SS-Männern gewechselt oder über das Schicksal eines Häftlings wurde nur durch Zeichen, oder ein Anschauen oder ein Kopfnicken entschieden. Der Sachbearbeiter teilte dann dem Häftling die Entscheidung mit, indem er nur kurz rief: "Waschraum." Das bedeutete, dass der Häftling sich gesondert aufzustellen und später mit nach oben in den Waschraum zu gehen hatte. Es bedeutete für ihn den Tod. Rief der Sachbearbeiter zu dem Häftling: "Sie gehen in die Schreibstube!", so musste sich der Häftling zu einer anderen Gruppe stellen und später mit dem Blockschreiber zur Schreibstube gehen. Sein Leben war vorerst gerettet.
Die Häftlinge, die zum Erschiessen bestimmt worden waren, wurden nach Beendigung der sog. Bunkerentleerung von den SS-Männern in den Waschraum geführt. Vorher hatten diese schon darauf geachtet, dass sie sich nicht zu der Gruppe, die in das Lager entlassen werden sollte, stellten. Die Anwesenheit mehrerer SS-Angehöriger von der Politischen Abteilung in dem Arrestbunker sollte auch einen möglichen verzweifelten Aufstand der dem Tode geweihten Häftlinge von vornherein verhindern. Im Waschraum mussten sich die Häftlinge völlig entkleiden. Dann wurden ihnen von dem Blockschreiber die Häftlingsnummern auf die nackte Brust geschrieben. Währenddessen begaben sich die meisten SS-Angehörigen in die Blockführerstube, um dort die Vorbereitungen für die Erschiessungen abzuwarten und dort das Kleinkalibergewehr mit Schalldämpfer zu holen. Sie waren stets guter Dinge, sie lachten und scherzten. Wenn die Vorbereitungen für die Erschiessungen beendet waren, kamen sie laut schwatzend aus der Blockführerstube heraus und gingen lachend an den im Flur vor dem Waschraum stehenden nackten Häftlingen vorbei zum Hof. Dann begannen die Erschiessungen an der Schwarzen Wand. Es wurden jeweils zwei nackte Männer von einem Funktionshäftling, beziehungsweise dem Kalfaktor, zum Erschiessen an die Schwarze Wand im Laufschritt geführt. Vor diese Wand stellte der Kalfaktor die beiden Delinquenten mit dem Gesicht zur Wand auf. Dann näherte sich von hinten ein SS-Mann mit dem Kleinkalibergewehr, drückte dessen Mündung in den Nacken des einen Häftlings und erschoss ihn durch einen Schuss in den Hinterkopf. Der Häftling fiel daraufhin nach hinten um. Danach erschoss der SS-Mann den zweiten Häftling auf die gleiche Weise. Leichenträger - Häftlinge -, die im Hintergrund auf dem Hof warteten, liefen nun mit einer Tragbahre zu den Erschossenen hin, legten die Leichen auf die Bahre und trugen sie dann an die Wand des Blockes 10 gegenüber dem Eingang zu Block 11, aus dem die zu erschiessenden Häftlinge herausgeführt wurden. An der Wand des Blockes 10 entlang befand sich eine Blutrinne, durch die das Blut der Erschossenen abfloss. Unmittelbar nach der Erschiessung der beiden ersten Häftlinge führte dann der Kalfaktor zwei weitere nackte Häftlinge zum Erschiessen an die Schwarze Wand, die von einem SS-Mann auf die gleiche Weise getötet wurden. So ging es weiter, bis alle zum Tod bestimmten Häftlinge getötet waren.
Während der Erschiessungen standen die anderen SS-Angehörigen, die an der Bunkerentleerung teilgenommen hatten, rechts von der Schwarzen Wand an der Wand des Blockes 11 und schauten zu. Wenn sehr viele Häftlinge zu erschiessen waren, kam es vor, dass gleichzeitig vier Häftlinge zur Schwarzen Wand geführt und dort von je zwei SS-Männern erschossen wurden. Die Schützen wechselten sich auch häufig ab. Als der SS-Oberscharführer Palitzsch Rapportführer war, führte er in den meisten Fällen die Erschiessungen durch. Aber auch Angehörige der Politischen Abteilung und andere SS-Männer beteiligten sich aktiv an solchen Erschiessungen, indem sie eigenhändig mit dem Kleinkalibergewehr die Opfer töteten. Wenn alle Häftlinge nach einer solchen Bunkerentleerung erschossen waren, wurden die Leichen mit einem Leichenrollwagen, der von Häftlingen gezogen wurde, zum Krematorium gefahren.
Ein Angehöriger der Politischen Abteilung ging dann mit einer Liste der Erschossenen zum Häftlingskrankenbau. Dort befahl er auf der Schreibstube des HKB dem Häftlingsschreiber, die auf der Liste befindlichen Häftlinge "von der Stärke des HKB abzusetzen". Das bedeutete für den Häftlingsschreiber, dass er die in der Stärke des Blockes 11 geführten Häftlinge zunächst, obwohl sie bereits tot waren, in die Stärke des HKB aufzunehmen hatte, um sie dann sofort wieder als normal verstorben von der Stärke des HKB abzusetzen. Für alle nach Bunkerentleerungen erschossenen Häftlinge wurden Todesmeldungen und Todesbescheinigungen für das Standesamt ausgeschrieben, in denen nur natürliche (fingierte) Todesursachen angegeben wurden (z.B. Herzschwäche).
Die sog. Bunkerentleerungen und die nachfolgenden Erschiessungen erfolgten ohne Urteil eines Gerichts, auch nicht auf Grund eines Standgerichtsurteils oder eines Exekutionsbefehls einer höheren Dienststelle (z.B. des RSHA). Sie wurden eigenmächtig von den an den Bunkerentleerungen teilnehmenden SS-Angehörigen durchgeführt.
Im Jahre 1943 wurde gegen Grabner ein Ermittlungsverfahren wegen dieser eigenmächtigen Erschiessungen eingeleitet, das zur Anklageerhebung gegen Grabner wegen Mordes in mindestens 2000 Fällen bei dem SS- und Polizeigericht in Weimar führte. Die Hauptverhandlung vor diesem Gericht, das unter Vorsitz des Zeugen Dr. Ha. tagte, wurde jedoch nicht bis zu Ende durchgeführt, sondern zur weiteren Aufklärung vertagt, nachdem der Anklagevertreter für Grabner eine hohe Zuchthausstrafe beantragt hatte.
Bei den Bunkerentleerungen war Boger einer der eifrigsten SS-Männer. Er hasste die Polen, die das Hauptkontingent der Arrestanten stellten. Mit fanatischem Eifer suchte er im Lager nach geheimen Widerstands- und Untergrundorganisationen der Polen. Hierbei schreckte er vor keinem Mittel zurück. Er verbreitete unter den Häftlingen des Lagers Furcht und Schrecken. Er war deshalb einer der gefürchtetsten SS-Männer. Bei den Häftlingen war er unter dem Namen "Bestie von Auschwitz", "Schwarzer Tod", "Schrecken von Auschwitz", "Schreitender Tod", "Teufel von Auschwitz" bekannt. Wenn Häftlinge ihn von weitem in das Lager kommen sahen, gingen sie ihm angstvoll aus dem Wege. Boger war stolz auf die genannten Beinamen. Es erfüllte ihn auch mit tiefer Befriedigung, dass er den Häftlingen Furcht und Schrecken einflösste. Gegenüber Häftlingen bekannte er wiederholt voll Stolz: "Ich bin der "Teifi"."
Hatte Boger ihm verdächtig erscheinende Polen erwischt, so nahm er sie fest und lieferte sie in den Arrestbunker ein. Durch sogenannte verschärfte Vernehmungen, bei denen er die Häftlinge bis zur Bewusstlosigkeit schlug oder schlagen liess, suchte er Geständnisse aus den Verdächtigen zu erpressen. Nicht selten wurden Häftlingen bei diesen Vernehmungen totgeschlagen, was noch beim nächsten Anklagepunkt unter II/4 zu erörtern sein wird.
Wenn Grabner und Aumeier über das Schicksal der Häftlinge im Arrestkeller entschieden, übte er einen massgebenden Einfluss auf ihre Entscheidungen aus. In einer Reihe von Fällen schlug er die Tötung von Häftlingen vor und einigte sich in kürzester Zeit mit Grabner und Aumeier darüber, dass die Häftlinge zu erschiessen seien. Mit den Erschiessungen war er völlig einverstanden und bejahte sie.
Im einzelnen konnte das Gericht folgende konkrete Fälle feststellen, in denen Boger die Erschiessungen von Häftlingen entscheidend mitbestimmt und an den anschliessenden Erschiessungen teilgenommen hat:
Unter anderem fand am 3.3.1943 eine Bunkerentleerung unter Beteiligung des SS-Untersturmführers Grabner, des SS-Hauptsturmführers Aumeier, des Angeklagten Boger und anderer SS-Angehöriger statt. In einer der Zellen sassen unter anderen die von dem Angeklagten Boger eingelieferten Häftlinge Bor. und Maximilian Gestwinski ein. Als die Zellentür der Zelle, in der diese beiden Häftlinge einsassen, geöffnet worden war und der älteste Häftling Meldung erstattet hatte, wurden die einzelnen Häftlinge mit ihren Nummern aufgerufen. Als die Reihe an den Häftling Gestwinski kam, wurde dieser von Grabner gefragt, warum er im Bunker einsitze. Gestwinski antwortete, er wisse es nicht, er stehe zur Disposition des Oberscharführers Boger. Boger neigte sich daraufhin zu Grabner und flüsterte ihm etwas zu. Dann befahl er dem Gestwinski aus der Zelle herauszukommen. Zu Grabner sagte er noch laut: "Dieser Bandit kommt aus Bromberg." Dann schickte er den Gestwinski zu der Gruppe, die zum Erschiessen geführt werden sollte. Auch Bor. musste bei dieser Gruppe Aufstellung nehmen. Nach Beendigung der Bunkerentleerungen wurden die zum Erschiessen bestimmten Häftlinge, deren Anzahl nicht mehr genau festzustellen war - wie üblich - in den Waschraum geführt, wo sie sich völlig zu entkleiden hatten. Der Häftlingsschreiber schrieb ihnen die Häftlingsnummer auf die nackte Brust. Alle waren, da sie wussten, dass sie erschossen werden sollten, in Todesangst. Sie konnten ihre Notdurft nicht mehr halten und verschmutzten den Waschraum. Die SS-Männer waren in der Zwischenzeit in die Blockführerstube gegangen. Als allen Häftlingen die Häftlingsnummern auf die Brust geschrieben worden waren, kamen die SS-Männer gut gelaunt und schwatzend aus der Blockführerstube heraus und gingen laut scherzend an den verängstigten Häftlingen vorbei auf den Hof. Unter ihnen war auch der Angeklagte Boger. Anschliessend wurden die bei der Bunkerentleerung ausgesonderten Häftlinge nacheinander zu je zwei von dem Bunkerkalfaktor Ja. an die Schwarze Wand geführt und dort in der bereits oben geschilderten Weise erschossen. Nur dem Zeugen Bor. gelang es, mit Hilfe des Blockschreibers Pi. dem Tode zu entkommen. Er musste, nachdem er sich mit einem von Pi. zugeworfenem Kleidungsstück bekleidet hatte, auf Befehl eines SS-Mannes mit einem anderen Häftling die Leichen der Erschossenen von der Schwarzen Wand zur Seite tragen. Der Angeklagte Boger erschoss bei dieser Gelegenheit mindestens sechs Häftlinge eigenhändig. Dabei rief er, wenn ein Häftling seinen Kopf zu tief neigte: "Kopf hoch!" Unter den sechs Häftlingen befand sich der bereits genannte Häftling Gestwinski.
Der Zeuge Bor. kam nach den Exekutionen wieder in seine Zelle zurück.
Bei einer anderen Bunkerentleerung - etwa um die gleiche Zeit - spielte sich folgendes ab: Boger ging zur Zelle Nr.19, in der sich ausser anderen Häftlingen ein Junge im Alter zwischen 16 und 19 Jahren befand. Er war eingesperrt worden, weil aus der Zehner-Gruppe, in der der Junge gearbeitet hatte, ein Häftling entflohen war. Man hatte für die Flucht die anderen neun Häftlinge, darunter auch den Jungen, verantwortlich gemacht. Boger holte den Jungen aus seiner Zelle heraus und sagte zu ihm sinngemäss: "Damit Du es das nächste Mal lernst, dass keiner zu entfliehen hat, wirst Du heute erschossen." Er führte dann den Jungen von der Zelle durch den Korridor weg. Ob der Junge erschossen worden ist, konnte nicht festgestellt werden.
Am 21.9.1943 war ebenfalls eine Bunkerentleerung, an der unter anderem Grabner, Boger, die Lagerführer Schwarz und Hofmann und andere SS-Angehörige teilnahmen. In einer Zelle des Bunkers sassen unter anderen der Zeuge G., ferner ein Jude namens Solarz und ein polnischer Häftling namens Gniardoroski ein. G. war einige Tage vorher von Boger festgenommen und in den Arrest eingeliefert worden. Ebenso die beiden Häftlinge Solarz und Gniardoroski. Ihrer Verhaftung durch Boger lag folgender Sachverhalt zugrunde: G. hatte einige Zeit vorher Verbindung mit einer Häftlingsfrau namens Lilly Tofler, die in den Gärten in Reisko arbeitete, aufgenommen. Als eines Tages die Häftlinge Solarz und Gniardoroski einen Totenkranz von Reisko in das Kommandanturgebäude bringen mussten, gab ihnen die Lilly Tofler einen Brief an G. mit. Solarz und Gniardoroski versteckten den Brief in den Totenkranz. Als sie den Kranz dann in der Kommandantur abliefern wollten, fiel der Brief zu Boden und wurde von einem SS-Mann entdeckt. Dieser übergab den Brief der Politischen Abteilung. Boger, der eine Geheimverbindung vermutete, lieferte zunächst die Totenkranz-Träger Solarz und Gniardoroski in den Arrest ein. Als nach weiteren Ermittlungen festgestellt worden war, dass Lilly Tofler den Brief geschrieben hatte, führte er auch sie - möglicherweise auf Befehl Grabners - in den Arrest. Schliesslich erfuhr Boger, dass der Brief für den Zeugen G. bestimmt gewesen war. Daher sperrte er auch ihn in den Arrest ein.
Als nun am 21.9.1943, nachdem bereits andere Zellen geöffnet und eine Reihe von Häftlingen zum Erschiessen ausgesucht worden waren, die Zelle, in der der Zeuge G. einsass, geöffnet wurde und ein Häftling Meldung erstattete, kam Boger sofort auf den Zeugen G. zu und rief: "Du bist mein, komm heraus!" Der Zeuge wurde daraufhin zu den für den Tod bestimmten Häftlingen gestellt. Der Angeklagte Hofmann, der eine Liste mit den Nummern der Arrestanten bei sich führte, machte neben der Nummer des Zeugen ein rotes Kreuz. Danach wurden noch weitere Zellen geöffnet und weitere Häftlinge zum Erschiessen bestimmt, unter anderen auch die Häftlinge Solarz und Gniardoroski. Die Delinquenten wurden dann wie üblich zum Waschraum geführt. Dem Zeugen G. gelang es, sich unbemerkt zu zwei Häftlingen zu stellen, die in das Lager entlassen werden sollten. Dadurch entging er dem Tode. Während der Erschiessungen, die etwa eine Stunde dauerten, blieb der Zeuge bei diesen Häftlingen im Gang des Arrestblockes stehen. Boger nahm an den Erschiessungen ebenfalls teil. Er hat mindestens zwei Häftlinge, nämlich Solarz und Gniardoroski, eigenhändig erschossen.
Der Zeuge G. wurde, nachdem die Erschiessungen beendet waren, von dem mit Blut besudelten Bunkerkalfaktor Ja., der die Delinquenten zu der Schwarzen Wand geführt hatte, auf den Hof zu den dort liegenden Leichen geführt. G. sah unter anderen auch die Leichen der Häftlinge Solarz und Gniardoroski. Auf seine Frage, wer sie erschossen habe, antwortete Ja.: "Boger." Dem Zeugen G. gelang es dann, wieder in das Lager zurückzukommen. Sein Verschwinden wurde aber nach drei Tagen von Boger entdeckt. Boger liess den Zeugen zur Politischen Abteilung kommen. Dort beschimpfte er ihn als "polnisches Schwein" und lieferte ihn erneut in den Arrest ein. Nach einigen Tagen - am 28.9.1943 - war erneut eine Bunkerentleerung. Auch an dieser nahm der Angeklagte Boger teil. Als die Zelle des Zeugen G. geöffnet wurde, trat Boger vor und rief zu dem Zeugen zugewandt: "Endlich habe ich Dich, Du bist mein." Der Zeuge wurde daraufhin wieder zu den zum Erschiessen ausgesonderten Häftlingen gestellt. Als sie zum Waschraum geführt wurden, gelang es dem Zeugen G., sich in dem Absperrgitter zwischen Bunker und Korridor zu verstecken. Hier wurde er kurz danach von dem SS-Unterscharführer Lachmann entdeckt. Nach kurzer Unterhaltung ging Lachmann, der dem Zeugen offensichtlich wohl gesinnt war, nach oben, wo er sich für das Leben des Zeugen G. einsetzte. Nach zehn Minuten kam er zurück und führte den Zeugen G. zur Schreibstube. Boger kam nach Beendigung der Erschiessungen zur Schreibstube und schrie den Zeugen G. an: "Du verfluchter Schweinehund, Du hast nur mir zu verdanken, dass Du noch eine Weile leben kannst." Ob Boger an diesem Tag eigenhändig Häftlinge getötet hat, konnte nicht festgestellt werden. Auch die Anzahl der Erschiessungen konnte nicht festgestellt werden. Mindestens ist jedoch ein Häftling erschossen worden.
In den geschilderten Fällen wurden die Erschossenen - wie üblich - von der Stärke des Blockes 11 abgesetzt und zunächst in die Stärke des HKB aufgenommen und dann als normal verstorben mit fingierten Todesursachen von der Stärke
des HKB abgesetzt.
Bei einer anderen Bunkerentleerung, die Ende September oder Anfang Oktober 1943 stattfand, war ausser dem Lagerführer Schwarz und dem Rapportführer auch der Angeklagte Boger anwesend. In einer der Zellen sass der Zeuge Woy. mit anderen Häftlingen ein, die von dem Angeklagten Boger in dem Arrest eingeliefert worden waren. Als die Zelle geöffnet wurde, fragte der Lagerführer Schwarz den Angeklagten Boger, was das für Menschen seien. Boger antwortete, das seien Angehörige einer militärischen Untergrundorganisation. Schwarz fragte Boger weiter, ob schon Vernehmungen stattgefunden hätten. Boger antwortete darauf, dass der Fall klar liege und Vernehmungen nicht nötig seien. Schwarz bestand jedoch darauf, dass zunächst Vernehmungen durchzuführen seien. Die Häftlinge wurden daraufhin nicht erschossen. Sie wurden vielmehr in den nächsten Tagen vernommen.
Vom 24.9.1943 bis zum 11.10.1943 sass der Zeuge F., der als Häftlingsarzt im HKB tätig war, nach Festnahme durch den Angeklagten Boger im Arrest ein. Er erlebte drei Bunkerentleerungen, an denen jedesmal der Angeklagte Boger teilnahm. Am 11.10.1943 wurden zwanzig Häftlinge, darunter auch der Zeuge F., aus den Zellen herausgerufen und im Korridor aufgestellt. Sie sollten in das Lager entlassen werden. Unter den zwanzig Häftlingen befand sich auch ein österreichischer Oberst namens Wosniakowski, der im Zivilberuf Rechtsanwalt war. Obwohl Wosniakowski für die Entlassung vorgesehen war, wurde er von Boger wieder in die Zelle zurückgeschickt. Boger zeigte auf ihn und sagte: "Der Alte geht zurück!" Noch am gleichen Tage wurde Wosniakowski mit anderen Häftlingen an der Schwarzen Wand erschossen.
Vom 16.9. bis 28.9.1943 sass auch der Zeuge Be. im Arrest ein. Boger hatte ihn festgenommen und in den Arrest eingeliefert, weil der Zeuge, der als Installateur in Birkenau arbeitete, gynäkologische Geräte in einem Wägelchen mit doppeltem Boden in das Stammlager hatte zurückbringen wollen, die er zuvor für eine Häftlingsärztin in das Lager Birkenau geschmuggelt hatte. Der Zeuge wurde während einer Bunkerentleerung, die in dieser Zeit stattfand, von Boger zu der zum Erschiessen ausgesonderten Gruppe von Häftlingen geschickt. Da Be. ein guter Freund des Häftlingsschreibers war, riet dieser ihm, sich als letzter in die Reihe der Todeskandidaten zu stellen. Dann sprach der Häftlingsschreiber wegen Be. mit dem SS-Unterscharführer Lachmann. Als Be. bereits im Waschraum war, wurde er plötzlich von Lachmann herausgerufen und zu Boger geführt. Lachmann hielt Boger vor, dass er den Zeugen Be. überhaupt noch nicht verhört habe. Boger antwortete daraufhin: "Scheissegal, ab!" Lachmann liess jedoch nicht locker und sagte erneut zu Boger, er müsse ihn noch vernehmen. Nun liess Boger sich erweichen und schickte Be. wieder in den Bunker zurück. Später gelang es dem Zeugen Be., durch Vermittlung des Häftlingsschreibers und des Kapos des Installateurkommandos Boger eine emaillierte Badewanne zu besorgen. Das Installateurkommando beschaffte Boger ausserdem auch noch andere Dinge. Dafür wurde der Zeuge Be. am 28.9.1943 aus dem Arrest in das Lager entlassen.
Der Angeklagte Boger wusste, dass die "Bunkerentleerungen" ohne Befehl höherer Dienststellen deswegen durchgeführt wurden, um Platz für weitere Arrestanten zu schaffen. Ihm war auch bekannt, dass die Erschiessungen ohne Gerichtsurteile und ohne Befehle höherer Dienststellen erfolgten. Ihm war auch klar, dass die an den "Bunkerentleerungen" und nachfolgenden Erschiessungen beteiligten SS-Angehörigen, insbesondere er selbst, nicht befugt waren, über Leben und Tod eines Häftlings zu entscheiden.
4. Die Tötung von Häftlingen bei verschärften Vernehmungen (Eröffnungsbeschluss Ziffer 4)
Der Angeklagte Boger führte als Angehöriger der Ermittlungsabteilung der Politischen Abteilung laufend Vernehmungen von Häftlingen durch. Er begann die Vernehmungen in der Regel in seinem Dienstzimmer in Gegenwart einer Protokollführerin. Dabei ging er äusserst brutal gegen die zu vernehmenden Personen vor. Wenn sie ihm nicht die erwarteten Antworten gaben oder - nach Bogers Meinung - nicht die Wahrheit sagten, gab er ihnen Ohrfeigen, schlug sie mit den Fäusten ins Gesicht oder trat sie mit den Stiefeln in den Leib. Häufig stellte er sich auch unmittelbar vor die Häftlinge und "durchbohrte sie mit seinen Blicken", um sie einzuschüchtern. Wenn er mit diesen Methoden sein Ziel nicht erreichen konnte, führte er die Häftlinge in die sog. Vernehmungsbaracke, wo eine sog. Sprechmaschine, die in der Lagersprache auch "Bogerschaukel" genannt wurde, aufgebaut war. Sie bestand aus zwei aufrecht stehenden Holmen, in die eine Eisenstange quer hineingelegt wurde. Boger liess die Opfer in die Kniebeuge gehen, zog die Eisenstange durch die Kniekehlen hindurch und fesselte dann die Hände der Opfer daran. Dann befestigte er die Eisenstangen in den Holmen, so dass die Opfer mit dem Kopf nach unten und mit dem Gesäss nach oben zu hängen kamen. Hierauf schlug er die Opfer mit einem Ochsenziemer oder einem Stock selbst oder liess sie durch andere SS-Männer mit diesen Schlaginstrumenten schlagen. Zwischendurch stellte er immer wieder Fragen an die Opfer. Gaben sie keine befriedigenden Antworten, so schlug er sie weiter oder liess sie weiter schlagen, bis sie blutüberströmt und unter unsäglichen Schmerzen bewusstlos wurden. Die Schläge, die nicht nur auf das Gesäss, sondern auch auf andere Körperteile, insbesondere die Geschlechtsteile, den Rücken und die Nieren, geführt wurden, versetzten die hängenden Opfer in eine schwingende Bewegung, was die Wirkung der Schläge noch erhöhte. Nach dieser Behandlung waren die Opfer oft bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet und machten häufig auf die Schreiberinnen der Politischen Abteilung, die Zeuginnen Ro. und Maj., den Eindruck, dass sie fast tot seien und nicht mehr lange leben könnten. Die misshandelten Opfer wurden dann in den HKB oder den Bunker des Blockes 11 eingeliefert. Meist mussten sie weggetragen werden. Von einer Vielzahl der Opfer gingen nach wenigen Tagen die Todesmeldungen bei den Schreiberinnen der Politischen Abteilung Scha. und Maj. ein.
Bei den Vernehmungen in der Vernehmungsbaracke waren keine Protokollführerinnen dabei. Boger zog aber wiederholt die Zeugin Wa. als Dolmetscherin zu den Vernehmungen hinzu, die die von Boger während der Misshandlungen an die Opfer gestellten Fragen übersetzen musste, wenn die Opfer kein Deutsch verstanden.
a. In Gegenwart der Zeugin hat der Angeklagte Boger mindestens einen Häftling während einer Vernehmung längere Zeit geschlagen, bis er tot war. Während der Misshandlung stellte Boger immer wieder Fragen an den Häftling. Der Zeitpunkt dieser Tötungshandlung konnte nicht mehr genau festgestellt werden; er war jedenfalls nach dem 1.12.1942.
In mindestens drei weiteren Fällen hat der Angeklagte Boger Häftlinge durch Schläge bei verschärften Vernehmungen in der Vernehmungsbaracke getötet.
b. An einem Tag im Sommer 1943, der Zeitpunkt liess sich nicht mehr genau feststellen, vernahm Boger allein einen Mann in der Vernehmungsbaracke. Er spannte ihn auf die Schaukel und schlug ihn, bis der Häftling blutüberströmt war und sein Gesäss nur noch aus Fetzen bestand. Dann unterbrach Boger die "Vernehmung", weil ein Vorarbeiter namens Marian mit dem Zeugen Bur. in die Baracke hereinkam. Marian hatte Boger einen Teppich besorgt und wollte diesen nun zusammen mit dem Zeugen Bur. in die Wohnung Bogers bringen. Boger liess den misshandelten Häftling auf der Schaukel hängen und ging mit den beiden in seine Wohnung. Nach kurzer Zeit kehrte er wieder mit ihnen zurück. Er ging als erster wieder in die Vernehmungsbaracke hinein. Dann betrat der Zeuge Bur. die Vernehmungsbaracke. Der Mann, der an der Schaukel hing, war inzwischen gestorben. Es floss kein Blut mehr. Blutspuren zeigten, dass dem Opfer Blut aus der Nase geflossen war. Auf Befehl Bogers trugen später Leichenträger die Leiche weg.
c. Einige Zeit später führte Boger allein einen Häftling in die Vernehmungsbaracke. Er spannte ihn auf die Schaukel und schlug allein zwei Stunden mit Unterbrechungen auf ihn ein, bis er tot war. Andere Personen waren während dieser Zeit nicht in der Vernehmungsbaracke. Nach etwa zwei Stunden verliess Boger die Baracke wieder. Die Leiche des Opfers lag neben der Schaukel. Der Zeuge Bur., der die Baracke betrat, nachdem Boger sie verlassen hatte, um sie zu reinigen, sah die Leiche neben der Schaukel liegen. Später holten Leichenträger den Toten ab.
d. Etwa zehn Tage nach diesem Vorfall führte Boger erneut einen Häftling in die Vernehmungsbaracke. Auch in diesem Fall spannte er ihn auf die Schaukel und schlug allein etwa zwei Stunden mit Unterbrechungen auf ihn ein, bis er tot war. Auch in diesem Falle waren keine anderen Personen in der Vernehmungsbaracke während dieser Zeit. Der Zeuge Bur. sah auch in diesem Fall die Leiche neben der Schaukel liegen, nachdem er die Baracke wie in dem vorigen Fall betreten hatte, um sie zu reinigen. Boger hatte zuvor die Baracke verlassen. Leichenträger holten einige Zeit später die Leiche ab.
e. Im Jahre 1943, der genaue Zeitpunkt liess sich nicht mehr feststellen, führte der Angeklagte Boger in der Vernehmungsbaracke einmal eine verschärfte Vernehmung bei einem polnischen Staatsangehörigen, der noch in Zivil war und dessen Haare nicht geschoren waren, durch. Er schlug auf ihn ein und warf ihn dann durch das Fenster zur Baracke hinaus. Der Pole fiel auf die Erde. Er war völlig zerschlagen und konnte nicht mehr aufstehen. Kurz zuvor war der Zeuge Lee. vom Arrestbunker zu der Vernehmungsbaracke geführt worden, wo er vernommen werden sollte. Er hatte während der Vernehmung des Polen vor der Baracke gewartet und dabei das Geschrei des Polen und die Schläge gehört. Nachdem Boger den Polen zum Fenster hinausgeworfen hatte und der Pole auf der Erde liegend nach Wasser verlangte, holte der Zeuge Lee. in seiner Mütze etwas Wasser, um es dem am Boden liegenden Menschen zum Trinken zu geben. Der Pole machte den Eindruck eines sterbenden Menschen. Als sich der Zeuge Lee. gerade bückte, um das Wasser dem zerschlagenen Menschen zu reichen, wurde er von Boger in die Vernehmungsbaracke hineingerufen. Er schüttete schnell noch dem Polen das Wasser in das Gesicht und ging dann in die Baracke hinein. Dort schlug ihn Boger sofort mit den Fäusten zusammen und trat ihn mit seinen Stiefeln. Zu einer Vernehmung des Zeugen Lee. kam es nicht mehr. Boger gab dem Zeugen den Befehl, den Häftling - Boger sagte: "Das polnische Schwein" - wieder in das Lager zu bringen. Als Lee. den zerschlagenen Menschen in das Lager zurückschleppte, starb dieser unterwegs infolge der von Boger erhaltenen Schläge. Der Zeuge legte die Leiche am Lagertor ab.
Während Boger in den geschilderten fünf Fällen auf die Häftlinge einschlug, um sie zum Reden zu bringen, rechnete er damit, dass die Häftlinge infolge der Schläge sterben könnten. Das nahm er aber bewusst in Kauf und billigte es. Dem Angeklagten Boger war bekannt, dass Misshandlungen und eigenmächtige Tötungen von Häftlingen verboten waren. Er hatte - wie alle anderen SS-Angehörigen in Auschwitz - eine Verpflichtung unterschrieben, in der es hiess: "Über Leben und Tod eines Staatsfeindes entscheidet der Führer allein. Kein Nationalsozialist ist daher berechtigt, Hand an einen Staatsfeind zu legen oder ihn körperlich zu misshandeln." Nach einer Anordnung des Chefs der Sipo und des SD von 12.2.1942, die von dem SS-Gruppenführer Müller in Vertretung unterzeichnet worden ist, waren zwar verschärfte Vernehmungen unter bestimmten Voraussetzungen vorgesehen, unter anderem durch Verabreichung von Stockhieben, sie durften aber nicht, was auch dem Angeklagten Boger bekannt war, zur Herbeiführung von Geständnissen über eigene Straftaten angewendet werden. Ferner sollte bei mehr als 20 Stockhieben ein Arzt hinzugezogen werden. Auf keinen Fall war durch diese Anordnung die Tötung von zu vernehmenden Personen erlaubt worden.
5. Die Tötung von mindestens 100 Häftlingen nach einem Aufstand des jüdischen Sonderkommandos
Im Jahre 1944 bereitete das bereits erwähnte jüdische Sonderkommando, das bei den Krematorien die Leichen aus den Gaskammern zu schleppen und in den Öfen zu verbrennen hatte, einen Aufstand vor. Die Angehörigen des Sonderkommandos waren zu dieser Zeit bereits in den Krematorien untergebracht. Sie hatten sich durch Häftlingsfrauen, die in dem Kommando "Union" beschäftigt waren, Pulver und Sprengstoffe besorgen lassen und sich damit primitive Handgranaten gefertigt. Ihr Plan war es, dass die in dem Krematorium III untergebrachten Häftlinge an einem bestimmten Nachmittag, wenn die Häftlinge von ihren Arbeitskommandos in die Lager einrückten, ebenfalls nach Überwältigung ihres SS-Kommandoführers und von zwei SS-Posten in das Lager einrücken sollten. Drei Häftlinge sollten die SS-Uniformen des SS-Kommandoführers und der überwältigten SS-Posten anziehen und das Kommando in das Lager führen. Dann sollten die Blockführerstuben vor den einzelnen Lagerabschnitten (B II f-a) nacheinander aufgesucht und die darin befindlichen SS-Männer überwältigt werden. Dabei sollten auch die Telefonleitungen zerschnitten werden. Die Häftlinge des Sonderkommandos, die in den Krematorien I und II untergebracht waren, sollten zu gleicher Zeit auf ein bestimmtes Zeichen nach Überwältigung ihres SS-Kommandoführers und der SS-Posten auf die gleiche Weise zu dem Frauenlager (B I) marschieren, dort die Blockführerstuben aufsuchen und ebenfalls die darin befindlichen SS-Männer überwältigen. Einige Häftlinge sollten in den Krematorien zurückbleiben und diese in Brand stecken.
Der Aufstand kam jedoch nicht so, wie er geplant war, zur Ausführung. Er wurde vielmehr durch ein besonderes Ereignis überraschend ausgelöst und lief dementsprechend nicht organisiert und planlos ab. An einem Nachmittag im Herbst 1944 führte der SS-Kommandoführer der Krematorien III und IV, Buch, im Hof des Krematoriums III unter den 300 zu seinem Kommando gehörenden Häftlingen eine Selektion durch. Er wählte 270 von den 300 Häftlingen aus. Wie er ihnen sagte, sollten sie zu einer anderen guten Arbeit kommen. Die Häftlinge glaubten es ihm jedoch nicht. Sie nahmen an, dass sie - wie schon vorher andere Mitglieder des Sonderkommandos - durch Gas getötet werden sollten. Tatsächlich waren die 270 Häftlinge auch für den Tod bestimmt. Man wollte sie vom Krematorium III mit LKWs um das gesamte Lager in Birkenau herumfahren, um den Häftlingen im Lager eine Abfahrt vorzutäuschen, und dann in einer Gaskammer eines anderen Krematoriums durch Gas töten. Die Aufgerufenen weigerten sich daher, beim Aufruf ihrer Nummern hervorzutreten. Einige liefen zum Krematorium, stiegen auf dessen Boden und legten dort Feuer. Andere gingen auf den SS-Kommandoführer und die SS-Posten los, um sie zu überwältigen. Diesen gelang es aber zu entkommen und Alarm zu schlagen. Irgendjemand betätigte die Alarmsirene. Dann kamen SS-Männer angelaufen und schossen. Viele Häftlinge, die nicht sofort durch die SS-Männer erschossen wurden, flohen. Einige versteckten sich. Auch aus den Krematorien I und II flohen viele Häftlinge. Einigen gelang es, bis zu den sog. Zerlegerbetrieben zu kommen und sich dort mit Waffen zu versorgen. Sie versteckten sich in der Umgebung des Lagers innerhalb des Bereiches der grossen Postenkette. Bewaffnete SS-Männer, die inzwischen alarmiert worden waren, durchsuchten die Gegend und fingen viele der geflüchteten Häftlinge ein. Die Gefangenen wurden in das Krematorium eingesperrt. Kurz danach wurden sie auf den Hof geführt. Dort mussten sie sich mit dem Gesicht auf den Boden legen. Der Angeklagte Boger, der auf Grund des Alarms ebenfalls zum Krematorium III gekommen war, erschoss zusammen mit dem SS-Mann Erber, der damals in Auschwitz den Namen Houstek führte, mindestens 100 der am Boden liegenden Häftlinge durch Genickschuss. Boger und Erber erschossen die wehrlos am Boden liegenden Menschen aus Rache, weil diese es gewagt hatten, sich gegen ihre beschlossene Tötung zu wehren und sich gegen die SS zu erheben.
Ein Befehl einer höheren Dienststelle für diese Erschiessungen lag nicht vor.
III. Die Einlassung des Angeklagten Boger
Der Angeklagte Boger hat zunächst jede Einlassung zur Sache verweigert. Im Verlaufe der Hauptverhandlung hat er zu den gegen ihn erhobenen Beschuldigungen und zu den schweren Belastungen der Zeugen Stellung genommen.
1. Zu II.1.
Im Anschluss an die Vernehmung der Zeugin Pal. hat der Angeklagte Boger eingeräumt, dass er zum Rampendienst eingeteilt worden sei und auch Rampendienst versehen habe. Er hat zugegeben, dass er bei der Abwicklung von RSHA-Transporten die Häftlinge des Häftlingskommandos und die an der Abwicklung der RSHA-Transporte beteiligten SS-Angehörigen überwacht habe.
2. Zu II.2.
Hierzu hat der Angeklagte Boger nicht Stellung genommen.
3. Zu II.3.
Der Angeklagte Boger hat eingeräumt, dass er an den sog. Bunkerentleerungen teilgenommen habe. Er hat jedoch behauptet, dass die Erschiessungen in der Regel durch das RSHA oder das WVHA angeordnet worden seien. Er habe keine Zweifel gehabt, dass das RSHA oder WVHA berechtigt gewesen sei, die Erschiessung von Häftlingen anzuordnen. Es sei zwar vorgekommen, dass Häftlinge ohne einen solchen Befehl erschossen worden seien. Dabei habe es sich jedoch nur um einen "Vorgriff" auf einen noch zu erwartenden Erschiessungsbefehl oder ein zu erwartendes Todesurteil gehandelt. In diesen Fällen habe er selbst nie über das Leben oder den Tod eines Häftlings entschieden. Das hätten nur Grabner und Aumeier gemacht. Er habe geglaubt, dass diese nur dann die Erschiessung von Häftlingen angeordnet hätten, wenn sicher gewesen sei, dass ein Todesurteil noch nachkommen werde. Die Entscheidung Grabners und Aumeiers habe er für rechtmässig gehalten. Der Angeklagte Boger hat ferner wiederholt mit aller Bestimmtheit behauptet, er habe nie Häftlinge eigenhändig erschossen. Im KL Auschwitz habe er nie ein Gewehr getragen und nie einen Schuss aus einer Waffe auf einen Häftling abgegeben. Erst in der Sitzung vom 25.3.1965 hat er eingeräumt, dass er einmal nach einer Bunkerentleerung zwei Häftlinge eigenhändig erschossen habe. Das habe er aber nur auf Befehl Grabners getan. Am nächsten Tag sei er bei Grabner deswegen vorstellig geworden. Er habe ihm erklärt, er sei entweder nur im Ermittlungsdienst tätig oder er werde für andere Zwecke verwendet. Beides zusammen könne er nicht verkraften. Grabner habe sich daraufhin gleichsam bei ihm entschuldigt und habe ihn dann nicht mehr zum Erschiessen eingeteilt.
4. Zu II.4.
Der Angeklagte Boger hat auch zugegeben, dass er verschärfte Vernehmungen - auch gegen Beschuldigte - durchgeführt hat. Er hat jedoch entschieden in Abrede gestellt, dass er Häftlinge totgeschlagen habe. Er hat behauptet, dass er jede verschärfte Vernehmung protokollarisch festgehalten und die Protokolle hierüber der Gestapo in Kattowitz vorgelegt habe. Es sei nie vorgekommen, dass Häftlinge bzw. Beschuldigte die verschärften Vernehmungen nicht überlebt hätten. Niemand sei infolge einer verschärften Vernehmung gestorben.
5. Zu II.5.
Schliesslich hat der Angeklagte Boger auch in Abrede gestellt, nach dem Krematoriumsaufstand Häftlinge erschossen zu haben.
IV. Beweisgrundlagen für die Feststellungen unter I. und II., Beweiswürdigung
1.
Die Feststellungen zum Lebenslauf des Angeklagten Boger beruhen auf seiner eigenen Einlassung.
2. Zu II.1.
Die unter II.1 getroffenen Feststellungen beruhen zunächst auf dem Geständnis des Angeklagten Boger, der zugegeben hat, Rampendienst versehen und Überwachungsfunktionen bei der Abwicklung von RSHA-Transporten ausgeübt zu haben. Darüber hinaus haben die Zeugen Bor. und Erich K. sowie die Zeugin Pal. den Angeklagten Boger beim Rampendienst beobachtet. Diese Zeugen haben glaubhaft bekundet, dass Boger auch bei der Einteilung der ausgestiegenen Menschen (sog. Vorselektion) mitgewirkt habe. Das Gericht sieht daher auch als erwiesen an, dass Boger über seine eigentlichen Überwachungsfunktionen hinaus beim Aufstellen und der Einteilung der angekommenen Menschen mitgeholfen hat. Wie oft der Angeklagte Boger den Rampendienst versehen hat, konnte nicht festgestellt werden. Das Gericht hat sich daher, da es das Urteil nicht auf Schätzungen stützen konnte, darauf beschränkt, eine Mitwirkung Bogers in der geschilderten Weise bei mindestens einem RSHA-Transport festzustellen. Die Zeugin Pal. hat den Angeklagten Boger im Jahre 1944 beim Rampendienst gesehen. Zu dieser Zeit wurden mit den RSHA-Transporten durchschnittlich dreitausend Menschen nach Auschwitz deportiert. Davon wurden mindestens 75% - wie oben schon ausgeführt - getötet, da nie mehr als 25%, meist aber weniger, in das Lager aufgenommen worden sind. Mit Sicherheit konnte daher das Gericht davon ausgehen, dass von diesem Transport mindestens 1000 Menschen durch Gas getötet worden sind.
Das Gericht ist auch davon überzeugt, dass Boger - ebenso wie alle anderen SS-Angehörigen - wusste, dass die Juden nur wegen ihrer Abstammung als Angehörige einer "minderwertigen Rasse" getötet wurden. Das war allen in Auschwitz befindlichen SS-Angehörigen klar. Dies ergab sich allein schon aus der Tatsache, dass nur Juden in der geschilderten Weise massenweise in den Gaskammern getötet wurden. Darüber hinaus wurde es allen durch die gegebenen Befehle und durch weltanschauliche Schulung klar gemacht. Boger bestreitet es auch nicht.
Dass Boger über die befohlenen Geheimhaltungsvorschriften und die Tarnbezeichnung Bescheid wusste, kann ebenfalls nicht zweifelhaft sein, da er als Angehöriger der Politischen Abteilung zwangsläufig davon erfahren musste und selbst zur strengsten Verschwiegenheit - wie alle anderen SS-Angehörigen - verpflichtet wurde. Durch seine Anwesenheit auf der Rampe musste er auch zwangsläufig miterleben, wie die Opfer getäuscht und zu den Gaskammern geführt wurden. Es kann daher auch nicht zweifelhaft sein, dass er die näheren Umstände, wie die Opfer getötet wurden, kannte. Er bestreitet dies auch nicht.
3. Zu II.2.
Die unter II.2. getroffenen Feststellungen beruhen auf der glaubhaften Aussage des Zeugen Erich K. Der Zeuge war vom November 1942 bis zum 18.1.1945 im Lager Birkenau. Er war als Schlosser tätig und kam in dieser Funktion in sämtliche Lagerabschnitte. Daher kannte er auch die SS-Angehörigen. Auch der Angeklagte Boger war ihm gut bekannt. Der Zeuge K. hat alle Vorgänge im Lager mit aufmerksamen Augen beobachtet. In seiner Eigenschaft als Schlosser konnte er auch wiederholt sog. Lagerselektionen sehen.
Der Zeuge K. hinterliess einen glaubwürdigen Eindruck. Das Gericht ist überzeugt, dass seine Angaben über den Angeklagten Boger der Wahrheit entsprechen.
Bei der Lagerselektion, an der der Angeklagte Boger teilgenommen hat, ist eine Vielzahl von Menschen für den Tod bestimmt worden. Da es jedoch nicht möglich war, die genaue Anzahl festzustellen, hat sich das Gericht darauf beschränkt, eine Mindestzahl festzustellen. Mit Sicherheit kann davon ausgegangen werden, dass bei dieser Selektion mindestens 10 Menschen für den Tod bestimmt worden sind, weil Tötungen durch Gas nur bei einer grösseren Anzahl von Menschen durchgeführt worden sind.
4. Zu II.3.
Die Feststellungen über die sog. Bunkerentleerungen und die anschliessenden Erschiessungen beruhen auf den Einlassungen der Angeklagten Boger, Dylewski, Broad, soweit ihnen gefolgt werden konnte, den glaubhaften Aussagen der Zeugen Wl. und Pi., die als Schreiber im Block 11 nacheinander tätig waren und ständig die Bunkerentleerungen beobachten konnten, und den glaubhaften Aussagen der Zeugen Se., La., Bor., Be., Woy., F., P., sowie dem bereits mehrfach erwähnten Broad-Bericht. Die Feststellungen über die Bunkerentleerung und die anschliessenden Erschiessungen am 3.3.1943 hat das Gericht auf Grund der glaubhaften Aussage des Zeugen Bor. getroffen. Dieser Zeuge war glaubwürdig. An Hand des Bunkerbuches konnte in der Hauptverhandlung festgestellt werden, dass er tatsächlich am 3.3.1943 im Arrest eingesessen hat. Der Zeuge hat seine Aussage ruhig und leidenschaftslos und mit erkennbarem ernstlichen Bemühen gemacht, nur die Wahrheit zu sagen. Seine Darstellung war in sich geschlossen und widerspruchsfrei. Das Gericht ist überzeugt, dass der Zeuge auch noch nach 20 Jahren die damaligen Geschehnisse in guter Erinnerung hat. Denn für ihn handelte es sich, da er selbst erschossen werden sollte, um ein Erlebnis, das sich erfahrungsgemäss tief im Gedächtnis einprägt.
Auf der glaubhaften Aussage des Zeugen Bor. beruht auch die Feststellung, dass Boger einem Jungen mitleidlos erklärt hat, er werde erschossen.
Die Feststellungen über die Bunkerentleerungen und die anschliessenden Erschiessungen am 21.9.1943 und 28.9.1943 beruhen auf den glaubhaften Bekundungen des Zeugen G. Auch dieser Zeuge hat einen glaubwürdigen Eindruck gemacht. Er hat seine Aussage sachlich, klar und präzise gemacht. Seine Darstellung ist frei von Widersprüchen. Die Eintragungen im Bunkerbuch, die in der Hauptverhandlung durch Verlesung zum Gegenstand der Verhandlung gemacht worden sind, bestätigten, dass der Zeuge vom 12.9.1943 bis zum 21.9.1943 tatsächlich im Arrest gewesen ist. Am 21.9.1943 ist ein Entlassungsvermerk eingetragen. Das bestätigt seine Aussage, dass er an diesem Tage wieder in das Schutzhaftlager gelangen konnte. Im Bunkerbuch ist ferner eingetragen, dass der Zeuge erneut vom 25.9. bis 28.9.1943 im Bunker eingesessen hat. Das bestätigt seine Bekundung, dass Boger ihn erneut festgenommen und in den Arrest eingeliefert hat. Weiter ergibt sich daraus, dass er am 28.9.1943 die Bunkerentleerung beobachten konnte und dass an diesem Tage eine Bunkerentleerung stattgefunden hat. Denn seine Entlassung aus dem Arrest ist an diesem Tag vermerkt.
Die Schilderung des Zeugen über die Ereignisse, die zur Verhaftung der Häftlinge Solarz und Gniardoroski und der Lilly Tofler sowie zu seiner eigenen Verhaftung geführt haben, wird zunächst indirekt bestätigt durch die Aussage der Zeugen Kag., Stei. und Paj., die zwar aus eigenem Wissen zu dem Fall Tofler keine Bekundungen machen konnten, die aber bereits damals in Auschwitz von dem Fall der Lilly Tofler gehört haben, insbesondere davon, dass ein Brief, den die Tofler einem Häftling durch einen Totenkranz hatte übermitteln wollen, durch die SS entdeckt worden sei und dass deswegen die Kranzträger, die Lilly Tofler und der Adressat des Briefes in den Arrest eingeliefert worden seien.
Wenn auch der Zeuge G. - anders als der Zeuge Bor. am 3.3.1943 - nicht selbst gesehen hat, dass Boger am 21.9.1943 eigenhändig geschossen hat, so ist das Gericht doch überzeugt, dass Boger mindestens die Häftlinge Solarz und Gniardoroski erschossen hat. Der Zeuge G. wurde unmittelbar nach der Erschiessung von dem Bunkerkalfaktor Ja. zu den im Hof liegenden Leichen geführt. Dort erklärte ihm Ja., dass Boger die beiden genannten Häftlinge erschossen habe. Es ist nicht ersichtlich, warum Ja., der die Erschiessung mit ansehen und daher die Todesschützen kennen musste, damals wahrheitswidrig den Boger hätte belasten sollen. Im übrigen hat Boger selbst schliesslich - nach anfänglichem hartnäckigem Leugnen - zumindest eingeräumt, dass er selbst auch zweimal - wenn auch in einem anderen Falle - geschossen habe. Daraus ist zumindest zu entnehmen, dass es nicht ungewöhnlich gewesen ist, dass auch die Angehörigen der Politischen Abteilung Häftlinge an der Schwarzen Wand eigenhändig erschossen haben. Die Feststellungen über eine Bunkerentleerung Ende September oder Anfang Oktober 1943, bei der Boger ohne Vernehmungen Häftlinge erschiessen lassen wollte, und dies nur infolge der Intervention des Lagerführers Schwarz unterblieb, beruhen auf der glaubhaften Bekundung des Zeugen Woy. Das Gericht hat auch bei diesem Zeugen, der einen glaubwürdigen Eindruck gemacht hat, keine Veranlassung, an der Richtigkeit seiner durch den Eid bekräftigten Angaben zu zweifeln. Dass der Zeuge sich im Arrest befunden hat, ist durch die zum Gegenstand der Verhandlung gemachte Eintragung im Bunkerbuch bestätigt worden, wonach der Zeuge vom 25.9.1943 bis zum 11.10.1943 im Bunker eingesessen hat.
Den Fall Wosniakowski hat der Zeuge F. geschildert. Auch ihm schenkte das Gericht vollen Glauben. Der Zeuge kannte den Angeklagten Boger gut, da er im HKB als Häftlingsarzt eine gewisse Bewegungsfreiheit gehabt und die SS-Angehörigen, die im Lager zu tun hatten, gekannt hat. Der Zeuge F. hat auf das Gericht einen ausgezeichneten Eindruck gemacht. Seine Aussage war klar, sachlich und leidenschaftslos.
Schliesslich beruhen die Feststellungen über eine Bunkerentleerung zwischen dem 16. und 28.9.1943, bei der zunächst der Zeuge Be. erschossen werden sollte, dann jedoch durch eine Intervention des SS-Unterführers Lachmann gerettet wurde, auf den glaubhaften Bekundungen dieses Zeugen. Auch bei diesem Zeugen hat das Gericht keine Zweifel, dass seine Darstellung der Wahrheit entspricht. Auch für diesen Zeugen, der ruhig und sachlich ausgesagt hat, waren die damaligen Erlebnisse von einschneidender Bedeutung, so dass sie sich tief in sein Gedächtnis eingeprägt haben.
Die Einlassung des Angeklagten Boger, die Erschiessungen nach den sog. Bunkerentleerungen seien in der Regel vom RSHA oder WVHA angeordnet gewesen oder sie seien im Vorgriff auf zu erwartende Erschiessungsbefehle erfolgt, ist durch die gesamten Umstände widerlegt. Dagegen spricht zunächst, dass Grabner damals die geschilderten Bunkerentleerungen mit den anschliessenden Erschiessungen als "Bunker-Ausstauben" bezeichnet hat. Dieser Ausdruck deutet darauf hin, dass man jeweils im Arrestbunker, wenn er überfüllt war, Platz für weitere Arrestanten schaffen wollte.
Dass Grabner ständig diesen Ausdruck gebraucht hat, geht aus dem Broad-Bericht hervor, der insoweit vollen Glauben verdient. Denn es ist kein Grund ersichtlich, warum Broad diesen Ausdruck kurz nach dem Krieg erfunden haben sollte. Ferner spricht aber die ganze Prozedur des "Bunker-Ausstaubens" gegen das Vorliegen von Erschiessungsbefehlen. Hätten tatsächlich solche Befehle vorgelegen, hätte es genügt, die zu erschiessenden Häftlinge durch einen SS-Mann, etwa den Arrestaufseher, aus den Zellen herauszuholen und zum Erschiessen führen zu lassen. Die Tatsachen, dass sich der Leiter der Politischen Abteilung, der Lagerführer und die Mitglieder der Politischen Abteilung jeweils im Arrestkeller eingefunden haben, dass dort jeweils erst die einzelnen Fälle, wenn auch oft nur sehr kurz, erörtert worden sind, und dass schliesslich erst an Ort und Stelle darüber entschieden worden ist, ob ein Häftling zu erschiessen oder in das Lager zu entlassen sei oder ob er im Bunker zu bleiben habe, beweisen eindeutig, dass die Erschiessungen ohne höheren Befehl eigenmächtig von den im Arrestkeller versammelten SS-Führern und Unterführern angeordnet worden sind. Für Entscheidungen wie in den Fällen Gestwinski, Be. und G. wäre andernfalls auch kein Raum gewesen. Gerade diese Fälle zeigen, dass es im Belieben der im Bunker versammelten SS-Führer und Unterführer lag, einen Häftling zu töten oder ihn wieder vor dem Tode zu erretten, auch wenn er vorher schon zum Tode bestimmt worden war.
Ferner spricht die Tatsache, dass die erschossenen Häftlinge nicht als "exekutiert" an das RSHA gemeldet worden sind, sondern zunächst, obwohl sie schon tot waren, in die Stärke des HKB aufgenommen und dann als normal an irgendeiner Krankheit verstorben von der Stärke des HKB abgesetzt worden sind, eindeutig dafür, dass man auf diese Weise eigenmächtige Tötungen verschleiern wollte. All diese Umstände waren dem Angeklagten Boger bekannt. Ihm musste sich daher die Erkenntnis aufdrängen, dass kein Befehl vom RSHA oder einer anderen höheren Dienststelle vorliegen konnte. Das Gericht ist daher überzeugt, dass ihm dies auch völlig klar war. Schliesslich ist auch noch die Tatsache zu erwähnen, dass bereits im Jahre 1943 gegen Grabner wegen dieser Bunkerentleerungen und Erschiessungen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und er schliesslich vor dem SS- und Polizeigericht wegen Mordes in mindestens 2000 Fällen angeklagt worden ist. Auch das spricht dafür, dass die Erschiessungen damals eigenmächtig ohne höheren Befehl erfolgt sind, Grabner berief sich zwar - wie der Zeuge Dr. Ha. glaubhaft bekundet hat - in der damaligen Hauptverhandlung auf angeblichen Befehl des RSHA, nachdem er in die Enge getrieben worden war. Vorher, während des Ermittlungsverfahrens, hatte er sich aber nicht darauf berufen. Seine Einlassung stand auch - so hat der Zeuge Dr. Ha. weiter ausgesagt - in Widerspruch zu den Aussagen einer Reihe von Zeugen.
Das Gericht ist auch überzeugt, dass der Angeklagte Boger nicht nur widerstrebend bei den Bunkerentleerungen und anschliessenden Erschiessungen mitgewirkt hat, sondern dass er
selbst einen massgebenden Einfluss auf die Entscheidung über Leben und Tod der Arrestanten ausgeübt und die Erschiessungen zu seiner eigenen Sache gemacht und innerlich bejaht hat. Dies zeigt sich zunächst im Falle Gestwinski, bei dem - wie die geschilderten Umstände zeigen - Boger letztlich den Ausschlag für seine Erschiessung gegeben hat. Es wird ferner deutlich im Fall des Zeugen Be., den er zunächst trotz der Gegenvorstellung des SS-Unterführers Lachmann ohne Vernehmung erschiessen lassen wollte und letztlich nur deswegen vor dem Tode bewahrt hat, weil ihm sein Leben durch eine Badewanne und andere Dinge abgekauft worden ist.
Auch im Falle G. hat Boger entscheidend dazu beigetragen, dass dieser Zeuge zunächst zum Erschiessen ausgesucht worden ist. Das zeigt sich darin, dass er den Zeugen mit dem Ruf "Du bist mein" aus der Zelle herausgeholt und zur Gruppe der zu Erschiessenden gestellt hat. Dass er den Tod des Zeugen wollte, beweist die Tatsache, dass er ihn, nachdem er zunächst dem Tod entronnen war, erneut unter Beschimpfungen festnahm, ihn wieder in den Arrest einlieferte und bei der nächsten Bunkerentleerung wieder dafür sorgte, dass er zu der Gruppe der zu Erschiessenden gestellt wurde. Wenn der Zeuge dann doch nicht erschossen wurde, so geschah das nur auf Intervention des SS-Unterführers Lachmann hin.
Die festgestellte innere Einstellung des Angeklagten Boger zu den Bunkerentleerungen und Erschiessungen lässt sich weiter aus dem Fall des 16-19jährigen Jungen ersehen. Mitleidlos hat der Angeklagte Boger diesem Jungen erklärt, er werde erschossen. Ferner zeigt sich diese innere Einstellung Bogers in dem von dem Zeugen Woy. geschilderten Fall, in dem Boger ohne Vernehmung eine Gruppe von angeblichen Widerstandskämpfern erschiessen lassen wollte, was sogar dem Lagerführer Schwarz bedenklich erschien. Auch die Tatsache, dass er den österreichischen Oberst Wosniakowski, der bereits bei der Gruppe der in das Lager zu entlassenen Häftlinge stand, wieder in die Zelle zurückgeschickt hat, zeigt seinen Eifer bei den Bunkerentleerungen und seine vom Gericht festgestellte innere Einstellung zu den Erschiessungen. Ferner ist auch der Umstand, dass er mit Eifer im Lager nach Geheim- und Untergrundorganisationen suchte und eine Vielzahl "verdächtiger" Häftlinge in den Arrestbunker einlieferte, obwohl er damit rechnen musste und nach Überzeugung des Gerichts auch damit gerechnet hat, dass sie bei einer Bunkerentleerung erschossen werden könnten, und dass er bewusst Terror, Angst und Schrecken im Lager verbreitet hat, wofür die oben angeführten Namen, die ihm von den Häftlingen beigelegt wurden, zeugen, ein sicheres Beweisanzeichen dafür, dass er mit Eifer an den Bunkerentleerungen und Erschiessungen teilgenommen und die Tötungen der Häftlinge innerlich gewollt und bejaht hat. Dass Boger unter den Häftlingen unter den oben angeführten Namen bekannt war, haben unter anderen die Zeugen Wey., van V., Kl., die Zeuginnen Kag., Ro., Maj. und der Zeuge Philipp Mü. glaubhaft bekundet.
Schliesslich zeugt für Bogers innere Einstellung auch noch, der Eifer und die Brutalität, mit denen er - wie sich aus den Feststellungen unter II.4. ergibt - Aussagen und Geständnisse aus Häftlingen herauspressen wollte und nicht davor zurückgeschreckt ist, Häftlinge bei diesen Vernehmungen totzuschlagen oder zumindest bis zur Unkenntlichkeit zu misshandeln.
All diese angeführten Tatsachen haben zu der Überzeugung des Gerichts beigetragen, dass Boger im Zusammenwirken mit dem SS-Untersturmführer Grabner, dem SS-Hauptsturmführer Aumeier und anderen SS-Angehörigen die Erschiessungen der Häftlinge in den konkret geschilderten Einzelfällen, aber auch bei sonstigen Bunkerentleerungen und Erschiessungen, an denen er teilnahm, zu seiner eigenen Sache gemacht und sie innerlich bejaht hat.
Da nicht mehr festzustellen war, wie oft Boger an den Bunkerentleerungen und anschliessenden Erschiessungen teilgenommen hat, ferner, wie oft er eigenhändig geschossen hat, hat sich das Gericht darauf beschränkt, dem Urteil nur die Fälle zugrunde zu legen, die mit jeden Zweifel ausschliessender Sicherheit festzustellen waren. Danach ergibt sich, dass Boger
a. am 3.3.1943 an einer Bunkerentleerung teilgenommen hat und anschliessend daran eigenhändig mindestens sechs Häftlinge erschossen hat (Aussage Bor.)
b. am 21.9.1943 an einer Bunkerentleerung teilgenommen hat und anschliessend eigenhändig mindestens die Häftlinge Solarz und Gniardoroski erschossen hat (Aussage G.)
c. am 28.9.1943 an einer Bunkerentleerung teilgenommen hat und bei den anschliessenden Erschiessungen anwesend war (Aussage G.).
Da nicht mehr festzustellen war, wieviel Häftlinge in diesem Falle erschossen worden sind, hat sich das Gericht darauf beschränkt, mindestens einen Fall als sicher festzustellen. In diesem Fall konnte allerdings nicht festgestellt werden, dass Boger eigenhändig geschossen hat.
Somit sind insgesamt mindestens neun Fälle von Erschiessungen festzustellen, an denen Boger mitgewirkt und die er innerlich bejaht hat.
5. Zu II.4.
Die Feststellungen über die allgemeinen Vernehmungsmethoden Bogers beruhen auf den glaubhaften Aussagen der Zeuginnen Ro., Scha., Maj., Stei. und Wa.
Die Zeuginnen Ro., Scha., Maj. und Stei. haben zwar den verschärften Vernehmungen in der sog. Vernehmungsbaracke nicht beigewohnt. Sie haben aber die Opfer gesehen, wenn sie aus der Vernehmungsbaracke bis zur Unkenntlichkeit entstellt herausgetragen oder herausgeworfen wurden. Auch haben sie die Schreie der Opfer gehört. Da die Zeuginnen in der Politischen Abteilung als Schreiberinnen, zum Teil sogar für den Angeklagten Boger, gearbeitet haben, besteht kein Zweifel, dass sie die Person des Angeklagten Boger genau kannten und ihn nicht mit einem anderen SS-Angehörigen verwechselt haben. Das Gericht hat keinen Anlass, den Aussagen dieser Zeuginnen, die sie zu verschiedenen Zeiten gemacht und die in allen wesentlichen Punkten übereingestimmt haben, zu misstrauen. Ihre Angaben, die sie mit dem Eid bekräftigt haben, sind voll glaubhaft.
Die Zeugin Wa. hat - wie sie bekundet hat - bei den verschärften Vernehmungen auf der sog. Bogerschaukel wiederholt als Dolmetscherin dabei sein müssen. Sie konnte als Augenzeugin miterleben, wenn Häftlinge bei diesen Vernehmungen gestorben sind. Allerdings konnte die Zeugin keine sicheren Angaben mehr darüber machen, wieviel Häftlinge bei solchen Vernehmungen des Boger auf der Stelle gestorben sind. Die Zeugin hat bei ihrer Vernehmung zunächst erklärt, dass es für sie schwer sei, eine Zahl zu nennen. Sie habe nicht gerechnet. Dann meinte sie, es seien mindestens zwanzig gewesen. Da das Gericht der Auffassung ist, dass diese Zahlenangabe auf einer Schätzung der Zeugin beruht, für die keine sicheren, jeden Zweifel ausschliessenden Anhaltspunkte gegeben sind, hat sich das Gericht darauf beschränkt, nur festzustellen, dass von Boger bei verschärften Vernehmungen im Beisein der Zeugin Wa. eine unbestimmte Anzahl von Häftlingen, jedoch mindestens einer, auf der Stelle getötet worden ist, und hat nur diesen einen Fall dem Urteil zugrunde gelegt.
Der Angeklagte Boger hat in Abrede gestellt, dass die Zeugin jemals als Dolmetscherin bei Vernehmungen auf der Bogerschaukel anwesend gewesen sei. Er behauptet, dass Frauen zu solchen verschärften Vernehmungen nie hinzugezogen worden seien. Wenn er Dolmetscher gebraucht habe, so habe er SS-Angehörige bestellt. Damit hat der Angeklagte Boger die Zeugin Wa. bezichtigt, bewusst die Unwahrheit gesagt zu haben. Denn es erscheint kaum möglich, dass die Zeugin irrtümlich annehmen konnte, sie sei bei solchen schrecklichen Vernehmungen dabeigewesen. Das Gericht ist aber von der Wahrheitsliebe der Zeugin überzeugt. Boger ist dagegen unglaubwürdig. Er hat auch in vielen anderen Punkten nicht die Wahrheit gesagt. So hat er - wie schon ausgeführt - längere Zeit immer wieder mit aller Bestimmtheit beteuert und hartnäckig wiederholt, er habe nie in Auschwitz geschossen, bis er schliesslich doch eingeräumt hat, zwei Häftlinge selbst erschossen zu haben.
Die Zeugin Wa., die als Privatlehrerin in Mexico tätig ist, hat nicht den Eindruck gemacht, dass sie sich - entgegen der Wirklichkeit - nur eingebildet haben könnte, an den verschärften Vernehmungen Bogers teilgenommen zu haben. Das Gericht hat die Glaubwürdigkeit und die Angaben der Zeugin besonders sorgfältig geprüft, weil sie einen Vorfall erzählt hat, der so ungeheuerlich war, dass er zunächst kaum glaubhaft erschien. Die Zeugin hat berichtet, dass im November 1944 eines Tages ein LKW mit Kindern vorgefahren sei und in der Nähe der Baracke der Politischen Abteilung gehalten habe. Ein Kind sei aus dem Wagen gesprungen. Es habe einen Apfel in der Hand gehabt. Boger, der zu dieser Zeit in der Tür der Baracke zusammen mit dem SS-Unterführer Draser gestanden habe, sei zu dem Kind hingegangen, habe es an den Füssen gepackt und mit dem Kopf an die Barackenwand geschlagen. Den Apfel habe er eingesteckt. Draser habe ihr dann befohlen, das Blut usw. von der Wand abzuwischen. Das habe sie auch getan. Eine Stunde später habe Boger sie zum Dolmetschen gerufen. Als sie hineingekommen sei, habe er den Apfel gerade gegessen. Die Zeugin blieb trotz wiederholter Vorhalte und Ermahnungen bei dieser Aussage, die sie mit sichtlicher Bewegung aber ruhig und leidenschaftslos gemacht hatte. Gleichwohl hat das Gericht die Zeugin am nächsten Tag noch einmal vernommen, um sich noch einmal ein Bild von ihrer Glaubwürdigkeit zu machen. Ihr wurde vorgehalten, dass sie bei ihrer früheren Vernehmung vor der deutschen Botschaft in Paris nichts von diesem schwerwiegenden Vorfall, den sie nicht vergessen haben könne, wenn er sich tatsächlich ereignet hätte, erwähnt habe. Die Zeugin hat hierfür jedoch eine plausible Erklärung gegeben: Sie erklärte, dass sie nach der Befreiung immer habe weinen müssen, wenn sie Kinder gesehen habe, weil sie dann an diesen Vorfall hätte denken müssen. Als sie schwanger gewesen sei, habe sie sich durch einen Arzt in Paris die Frucht beseitigen lassen, weil sie Angst gehabt habe, dass sie in Erinnerung an dieses schreckliche Erlebnis immer weinen müsse, wenn sie ihr eigenes Kind sehe. Zu der deutschen Botschaft habe sie über diesen Fall noch nicht sprechen können, weil es nach ihrer Meinung ihr Privatleben betroffen habe. Auch sonst habe sie nach der Befreiung mit Aussenstehenden nicht darüber sprechen können. Erst vor etwa drei Jahren habe sie den Fall einem Schriftsteller erzählt.
Das Gericht ist trotz anfänglicher Bedenken überzeugt, dass der von der Zeugin geschilderte Vorfall der Wahrheit entspricht. Auch bei ihrer zweiten Vernehmung am nächsten Tag, ist die Zeugin trotz ernsthafter Ermahnung und Vorhalte bei ihrer ursprünglichen Aussage geblieben. Dafür, dass sie den Vorfall bei ihrer Vernehmung vor der deutschen Botschaft nicht erwähnt hat, hat sie eine einleuchtende Erklärung gegeben. Die Zeugin hat nicht den Eindruck gemacht, dass sie zu Übertreibungen oder phantasievollen Erzählungen neigt. Sie hat ihre Aussage ohne Umschweife, ruhig, klar und sachlich gemacht. Es bestand auch nicht der Eindruck, dass sie die Geschichte aus Geltungssucht oder Wichtigtuerei erfunden haben könnte. Wenn sie jetzt den Vorfall vor Gericht in aller Öffentlichkeit erzählen konnte, so hat sie offensichtlich die inneren psychischen Hemmungen, die durch den Schock des damaligen Erlebnisses hervorgerufen worden sein mögen, nach zwanzig Jahren überwunden.
Die Zeugin hat ihre Aussage mit dem Eid bekräftigt. Schliesslich erhält die Aussage der Zeugin eine gewisse Bestätigung durch die Zeugin Cou. Diese Zeugin hat glaubhaft bekundet, dass ihr die Zeugin Wa. bereits damals im Lager erzählt habe, dass jemand ein Kind umgebracht habe. Nähere Einzelheiten habe sie jedoch nicht geschildert.
Die Zeugin Kag. schliesslich hat eidlich bekundet, dass ihr die Zeugin Wa. bereits im Jahre 1947 diesen Vorfall erzählt habe. Der scheinbare Widerspruch zwischen dieser Aussage und der Aussage der Zeugin Wa., dass sie mit Aussenstehenden über dieses furchtbare Erlebnis nicht habe sprechen können, löst sich auf, wenn man bedenkt, dass es sich bei der Zeugin Cou. und bei der Zeugin Kag. um Leidensgefährten und Frauen handelt, die ähnliche schreckliche Erlebnisse wie die Zeugin Wa. gehabt haben. Es erscheint daher verständlich, dass die Zeugin Wa. zu diesen beiden Zeuginnen von dem schrecklichen Erlebnis sowohl im Lager als auch später nach der Befreiung sprechen konnte.
Sonstige Anhaltspunkte, dass die Zeugin den Angeklagten Boger zu Unrecht hat belasten wollen, liegen nicht vor. Das Gericht hat daher auch keine Zweifel, dass die Angaben der Zeugin über die Vernehmungsmethoden Bogers und ihre Anwesenheit bei solchen Vernehmungen und über die Tötung von mindestens einem Häftling durch Boger der Wahrheit entsprechen. Da der Angeklagte Boger erst im Dezember 1942 nach Auschwitz gekommen ist, muss die Tötungshandlung nach dem 1.12.1942 geschehen sein.
Die Feststellungen über die Tötung von drei weiteren Häftlingen (Ziff.II.4.b.-d.) beruhen auf der Aussage des Zeugen Bur. Dieser Zeuge hat einen glaubwürdigen Eindruck hinterlassen. Er hat die Vorfälle leidenschaftslos und ruhig, klar und widerspruchsfrei geschildert. Eine Verwechslungsmöglichkeit scheidet aus. Denn der Zeuge war als Reiniger in der Politischen Abteilung beschäftigt. Er kannte daher die der Politischen Abteilung angehörenden SS-Männer genau. Tagsüber hielt er sich oft im Klosettraum auf, von dessen Fenster er die Vernehmungsbaracke genau beobachten konnte. Die von ihm geschilderten Fälle sind glaubhaft. Die von Bur. gegebene Darstellung wird durch die von den Zeuginnen Ro., Maj., Stei. und Wa. geschilderten Vernehmungsmethoden Bogers und die Tatsache, dass Boger in vielen anderen Fällen Häftlinge bis zur Unkenntlichkeit misshandelt hat oder misshandeln liess, gestützt.
Der Zeuge Bur. ist zwar bei den Vernehmungen selbst nicht dabeigewesen. Das Gericht hat jedoch keinen Zweifel, dass Boger die drei Häftlinge allein geschlagen und getötet hat. Denn der Zeuge hat - wie er glaubhaft bekundet hat - beobachtet, dass Boger jeweils allein mit diesen Häftlingen in die Vernehmungsbaracke gegangen sei. Der Zeuge hat ferner, wenn er selbst die Baracke betreten hat, festgestellt, dass sonst niemand in der Baracke bzw. dem Vernehmungszimmer gewesen ist. Er hat auch niemanden hineingehen und herauskommen sehen. Einen anderen Eingang bzw. Ausgang zu dem Vernehmungszimmer gab es nicht. Die drei Häftlinge können daher nur von Boger vernommen, geschlagen und getötet worden sein. Dass die Häftlinge tatsächlich tot waren, davon hat sich der Zeuge selbst überzeugt. Er ist zwar kein Arzt, das Gericht ist aber der Auffassung, dass auch ein Laie in der Regel den Tod eines Menschen feststellen kann.
Schliesslich spricht die Tatsache, dass Leichenträger die Körper der drei Menschen weggeschafft haben, dafür, dass sie tatsächlich - auch nach der Meinung Bogers - tot waren. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Zeuge Bur. den Angeklagten Boger bewusst wahrheitswidrig zu Unrecht hätte belasten wollen. Dagegen spricht vielmehr, dass er z.B. über den Angeklagten Broad sehr günstig ausgesagt hat. Das spricht für seine Wahrheitsliebe. Warum er ausgerechnet Boger zu Unrecht hätte belasten sollen, wenn nichts gegen ihn vorgelegen hätte oder wenn er nichts Nachteiliges von ihm gewusst hätte, ist nicht ersichtlich.
Die Feststellungen unter II.4.c. schliesslich beruhen auf der Aussage des Zeugen Lee. Auch dieser Zeuge hat einen glaubwürdigen Eindruck gemacht. Er hat zwar nicht selbst gesehen, dass Boger den Polen geschlagen hat. Er hat aber vor der Baracke wartend das Geschrei des Häftlings und die Schläge gehört. Danach hat er gesehen, wie Boger den völlig zerschlagenen Häftling aus dem Fenster hinausgeworfen hat. Von Boger wurde er dann in die Baracke hineingerufen. Dort wurde er selbst von Boger geschlagen und getreten. Aus all diesen Umständen hat das Gericht die Überzeugung gewonnen, dass Boger den Häftling - wie er in vielen anderen Fällen auch getan hat - vorher auch zusammengeschlagen hat. Das Gericht hat auch keine Zweifel, dass der Tod des Häftlings infolge der Misshandlungen durch Boger eingetreten ist.
Das Gericht ist ferner überzeugt, dass Boger in den unter II.4.a.-e. geschilderten Fällen damit gerechnet hat, dass die Häftlinge infolge der Schläge und Misshandlungen sterben könnten und das billigend in Kauf genommen hat. Diese Überzeugung des Gerichts stützt sich zunächst darauf, dass die Schläge mit dem Ochsenziemer oder mit den Stöcken nicht nur auf das Gesäss, sondern auch auf andere Körperteile, insbesondere die Geschlechtsteile und die Nieren geführt worden sind. Boger selbst hat auf Befragen eingeräumt, dass ihm bekannt gewesen sei, dass bei einem Menschen der Tod eintreten kann, wenn er auf Hoden und Nieren geschlagen wird. Das Gericht hat seine Überzeugung ferner aus der Tatsache gewonnen, dass Boger nicht nur einen Menschen bei solchen verschärften Vernehmungen getötet hat, sondern dass die Misshandlungen in mehreren Fällen zum Tode von Häftlingen geführt haben, was Boger hätte davon abhalten müssen, in Zukunft die Häftlinge einer solchen lebensgefährlichen Behandlung zu unterziehen. Wenn er trotz dieser erkennbaren Folgen seine Methoden in der gleichen Weise fortgesetzt hat, ist der Schluss gerechtfertigt, dass er den Tod der Häftlinge in Kauf nahm.
Auch die Tatsache, dass Boger viele Häftlinge so zugerichtet hat, dass sie auf andere Personen den Eindruck erweckten, als seien sie fast tot oder könnten nicht mehr lange leben, spricht für die festgestellte innere Einstellung Bogers, auch wenn in diesen Fällen Beweismittel dafür fehlen, dass die Häftlinge einige Tage später an den Folgen der Misshandlungen gestorben sind.
6. Zu II.5.
Die Feststellungen über den Krematoriumsaufstand beruhen auf den glaubhaften Bekundungen der Zeugen Be., Philipp Mü., der Einlassung des Angeklagten Baretzki, soweit ihr gefolgt werden konnte, und dem sog. Broad-Bericht.
Der Zeuge Philipp Mü. war selbst in dem Sonderkommando und zwar im Krematorium III untergebracht. Er hat die Umstände, die zu dem Aufstand geführt haben, selbst miterlebt. Von dem Angeklagten Baretzki ist bestätigt worden, dass tatsächlich ein Aufstand stattgefunden hat. Das gleiche ergibt sich auch aus dem Broad-Bericht. Mü. hat allerdings die Erschiessungen der mindestens einhundert Häftlinge nicht miterlebt, da er sich zuvor in einem Kanalloch versteckt hatte und keine Beobachtung mehr machen konnte. Er hat aber die Schüsse hören können.
Der Zeuge Be. hat nach seiner glaubhaften Bekundung mit eigenen Augen gesehen, wie Boger und Houstek (Erber) die am Boden liegenden Häftlinge erschossen haben. Be. schätzte die Zahl der Erschossenen auf einhundertfünfzig bis zweihundert. Das Gericht hat, um jeden Unsicherheitsfaktor auszuschliessen, nur eine Mindestzahl von einhundert Häftlingen festgestellt. Be. konnte die Erschiessungen aus nächster Nähe beobachten, weil er ein Hydrantenrohr, das ein Feuerwehrauto auf der Fahrt zum Krematorium III bei einer scharfen Biegung des Weges verloren hatte, aufgehoben und zu dem Krematorium III hineingebracht hat. Damit ist eine einleuchtende Erklärung dafür gegeben, dass Be. als Häftling die Erschiessungen mit ansehen konnte.
Dass Be. glaubwürdig ist, ist oben bereits ausgeführt worden. Das Gericht ist überzeugt, dass für diese Erschiessungen kein Befehl einer höheren Dienststelle vorgelegen hat. Denn die Erschiessungen erfolgten unmittelbar nach dem Aufstand. Es war somit für eine Meldung an eine höhere Dienststelle und entsprechende Weisungen und Befehle keine Zeit. Aus dem Umstand, dass Boger die Häftlinge, die inzwischen völlig wehrlos geworden waren und von denen kein Angriff mehr zu befürchten war, ohne ein Gerichtsurteil und ohne einen Befehl einer höheren Dienststelle erschossen hat, hat das Gericht gefolgert, dass ihn Rachsucht gegen diese Häftlinge, die es gewagt hatten, sich gegen die SS zu erheben, zu dieser Tat bestimmt hat.
V. Rechtliche Würdigung
1. Zu II.1.
Der Angeklagte Boger hat durch die geschilderten Tätigkeiten im Rahmen des geleisteten "Rampendienstes" die Vernichtung mindestens eines RSHA-Transportes im Zusammenwirken mit anderen SS-Angehörigen gefördert, somit einen kausalen Beitrag zu dem Mord der Haupttäter an tausend Menschen geleistet. Dass seine Handlungen mitursächlich für den Tod dieser Menschen gewesen sind, bedarf kaum einer näheren Begründung. Durch die Überwachung der SS-Angehörigen hat er diese - die ihn als Angehörigen der Politischen Abteilung kannten - dazu angehalten, ihren Dienst, d.h. die ihnen bei den Vernichtungsaktionen zugewiesenen Aufgaben, befehlsgemäss zu erfüllen. Durch die Mitwirkung beim Aufstellen und Einteilen der angekommenen Menschen hat er die Voraussetzungen für die weitere Abwicklung des RSHA-Transportes, d.h. die Tötung des grössten Teils dieser Menschen, mitgeschaffen. Schliesslich hat er durch die Überwachung der Häftlinge und das Achtgeben auf die Einhaltung des Sprechverbotes verhindert, dass die jüdischen Menschen vorzeitig etwas über ihr Schicksal erfuhren. Damit hat er zu den Täuschungsmanövern beigetragen.
Der Angeklagte hat den Rampendienst auf Befehl seiner Vorgesetzten ausgeübt. Da er Angehöriger der Waffen-SS war, ist seine strafrechtliche Verantwortlichkeit ebenfalls im Rahmen des §47 MStGB zu beurteilen. Ihm war klar, dass die Tötungen der unschuldigen jüdischen Menschen ein allgemeines Verbrechen waren. Er beruft sich selbst auch nicht darauf, dass er die Tötungen für rechtmässig gehalten hätte. Im übrigen kann hierzu auf die Ausführungen unter A. (Mulka) V.2. verwiesen werden. Der Angeklagte Boger ist daher für seine Mitwirkung strafrechtlich verantwortlich.
Bei ihm besteht ein erheblicher Verdacht, dass er die Massenvernichtung jüdischer Menschen aus innerer Überzeugung bejaht und die Ausrottung der Juden als notwendig angesehen und zu seiner eigenen Sache gemacht hat.
Hierfür spricht nicht nur, dass er bereits 1930 in die allgemeine SS eingetreten ist, bei der er bis zum SS-Hauptsturmführer aufgestiegen ist, dass er jahrelang in der Gestapo tätig war und nach Ausbruch des Krieges zur Stapoleitstelle nach Zichenau abgeordnet worden ist, sondern vor allem sein Verhalten im KL Auschwitz, wie es sich aus den Feststellungen unter II. ergibt. Gleichwohl blieben letzte Zweifel, ob er die Massenvernichtung der Juden tatsächlich als eigene Taten gewollt, somit mit Täterwillen gehandelt hat. Nach der glaubhaften Aussage der Zeugin Ro. äusserte Boger ihr gegenüber wiederholt: "Ich habe nichts gegen die Juden, ich hasse nur die Polacken, die verfluchten Polacken." Auch die Zeugin Wa. hat bekundet, dass Boger die Polen mehr als die Juden gehasst habe. Sein Verhalten bei den Bunkerentleerungen, bei den verschärften Vernehmungen, sein eifriges Suchen nach Widerstands- und Untergrundorganisationen im Lager und sein sonstiges Verhalten gegenüber den Häftlingen im Lager, das diesen Angst und Schrecken einflösste, war weitgehend durch diesen Hass gegen die Polen, die einen grossen Teil der Lagerinsassen stellten, bestimmt. Da auch nicht erkennbar geworden ist, dass sich Boger bei dem Rampendienst besonders eifrig oder brutal und rücksichtslos gegen die jüdischen Menschen gezeigt hat, konnte das Gericht seinen Täterwillen nicht mit letzter Sicherheit feststellen. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass er die Taten der Haupttäter nur - wenn auch bereitwillig - unterstützen und fördern wollte. Sein Tatbeitrag zu der Tötung von mindestens 1000 Menschen aus einem RSHA-Transport kann daher nur als Beihilfe im Sinne des §49 StGB bewertet werden.
Irgendwelche Rechtfertigungsgründe für die Handlungsweise des Angeklagten Boger sind nicht ersichtlich.
Der Angeklagte Boger hat auch vorsätzlich gehandelt. Aus den Feststellungen unter II. ergibt sich, dass er nicht nur die Massenvernichtung der jüdischen Menschen bewusst fördern wollte, sondern auch die gesamten Tatumstände gekannt hat, die die Beweggründe der Haupttäter für diese Tötungen als niedrig und die Art ihrer Ausführung als heimtückisch und grausam kennzeichnen.
Der Angeklagte Boger hat auch das erforderliche Unrechtsbewusstsein gehabt, da er - wie oben schon ausgeführt - klar erkannt hat, dass die Tötung der unschuldigen jüdischen Menschen trotz des Befehles Hitlers verbrecherisch war. Boger hat auch nicht irrig angenommen, dass die Tötungsbefehle trotz ihres verbrecherischen Charakters für ihn bindend seien. Hierzu kann auch auf die Ausführungen unter A. (Mulka) V.2. verwiesen werden.
Dem Angeklagten Boger ist die Ausübung des Rampendienstes auch nicht abgenötigt worden. Er beruft sich selbst nicht darauf. Nach der Überzeugung des Gerichts hat er bereitwillig den Rampendienst versehen. Als alter SS-Angehöriger und Gestapobeamter hat er es für selbstverständlich gehalten, Befehle der Vorgesetzten - insbesondere des "Führers" - auszuführen, auch wenn sie verbrecherischer Natur waren. Er hat selbst immer wieder betont, dass er die gegebenen Befehle auszuführen gehabt hätte. Die Frage eines wirklichen oder vermeintlichen (irrig angenommenen) sog. Befehlsnotstandes (§52 StGB) oder eines allgemeinen Notstandes (§54 StGB) stellt sich bei ihm daher überhaupt nicht.
Der Angeklagte Boger war daher in diesem Falle wegen gemeinschaftlicher Beihilfe (§§47, 49 StGB) zum gemeinschaftlichen Mord (§§47, 211 StGB) begangen in gleichartiger Tateinheit (§73 StGB), an mindestens 1000 Menschen zu verurteilen.
2. Zu II.2.
Die Mitwirkung des Angeklagten Boger bei der Lagerselektion ist rechtlich genau so zu beurteilen wie seine Mitwirkung bei der Abwicklung des RSHA-Transportes. Die Tötung der unschuldigen Häftlinge war Mord. Sie erfolgte aus niedrigen Beweggründen. Denn ihre Tötung erfolgte nur, weil man sich der schwachen und für den Arbeitseinsatz nicht mehr verwendungsfähigen Häftlinge entledigen wollte. Sie sollten als überflüssige Esser beseitigt werden. Dass solche Motive auf tiefster sittlicher Stufe stehen und als verachtenswert anzusehen sind, kann nicht zweifelhaft sein. Da die ausgemusterten arbeitsunfähigen Häftlinge durch Gas in Gaskammern getötet wurden, war ihre Tötung grausam. Hierzu kann auf die Ausführungen unter A.V.1. verwiesen werden. Dass der Angeklagte Boger durch die - oben geschilderten - Handlungen bei dieser Lagerselektion die Tötungen gefördert, also einen kausalen Tatbeitrag zu dem Mord, dessen Haupttäter der SS-Lagerarzt und andere nicht näher festzustellende Personen gewesen sind, geleistet hat und leisten wollte und sich dessen auch bewusst war, bedarf keiner weiteren Begründung.
Das Gericht hat zu seinen Gunsten unterstellt, dass er auf Grund eines Befehls tätig geworden ist, weil eine nähere Aufklärung nicht möglich war. §47 MStGB kommt daher auch hier zur Anwendung.
Der Angeklagte Boger hat nach der Überzeugung des Gerichts auch hier klar erkannt, dass die Tötung dieser unschuldigen Menschen nur wegen ihres allgemeinen Schwächezustandes ein allgemeines Verbrechen darstellte. Die Tötung unschuldiger Menschen aus den festgestellten Beweggründen nach einem so oberflächlichen und ohne die geringsten rechtlichen Sicherungen durchgeführten Verfahren ist ein so krasser Verstoss gegen die auch den primitivsten Menschen bewussten Grundsätze über das Recht eines jeden Menschen auf sein Leben, dass der Angeklagte Boger keinen Zweifel an dem verbrecherischen Charakter dieser Tötungen haben konnte und nach der Überzeugung des Gerichts auch nicht gehabt hat. Im übrigen gilt hier das gleiche, was oben unter A.V. zu den Massentötungen jüdischer Menschen gesagt worden ist. Bei den Lagerselektionen wurden im übrigen in erster Linie jüdische Menschen ausgemustert. Aus den gleichen Gründen hat nach der Überzeugung des Gerichts der Angeklagte Boger auch nicht irrig angenommen, dass der Befehl, an dieser Lagerselektion teilzunehmen, verbindlich sei.
Das Gericht konnte auch hier - aus den gleichen Gründen wie unter 1. ausgeführt - nicht mit letzter Sicherheit einen Täterwillen bei dem Angeklagten Boger feststellen. Es sieht daher nur als erwiesen an, dass der Angeklagte Boger die Tötung der mindestens zehn Menschen als Gehilfe fördern wollte.
Die Auswahl der mindestens zehn Menschen erfolgte jeweils durch einen besonderen Willensentschluss des Lagerarztes. Dieser hatte es in der Hand, nach freiem eigenem Ermessen Häftlinge für den Tod auszumustern. Die Tötung der mindestens zehn Menschen erfolgte aber durch eine einzige Willensbetätigung der damit beauftragten SS-Männer des Vergasungskommandos, nämlich durch das Einwerfen des Zyklon B. Sie ist daher als eine einzige Handlung im Sinne einer gleichartigen Tateinheit anzusehen.
Der Angeklagte Boger hat seinen Tatbeitrag zu diesem Mord an zehn Menschen vorsätzlich geleistet. Das ergibt sich bereits aus dem Sachverhalt selbst. Er wusste, dass die Menschen nur deswegen selektiert und getötet werden sollten, weil sie als arbeitsunfähige, kranke Menschen und unnütze Esser als Belastung für das Lager angesehen wurden. Er wusste auch, dass sie durch Gas in den Gaskammern getötet wurden, kannte also die Umstände, die die Tötung als grausam kennzeichnen. Schliesslich wollte er auch selbst durch seine Handlungen die Beseitigung der als lebensunwert angesehenen Häftlinge fördern und war sich auch im klaren darüber, dass er einen kausalen Beitrag hierfür leistete.
Irgendwelche Rechtfertigungs- oder Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich. Auch hier liegen die Voraussetzungen für einen Nötigungsnotstand (§52 StGB) oder einen allgemeinen Notstand (§54 StGB) nicht vor. Boger ist die Mitwirkung an dieser Lagerselektion nicht abgenötigt worden. Er behauptet das auch selbst gar nicht. Er hat auch nicht irrig angenommen, dass die tatsächlichen Voraussetzungen einer solchen Notstandssituation vorlägen. Hierzu kann auf die Ausführung unter Ziffer 1 verwiesen werden.
Der Angeklagte Boger war daher wegen seiner Mitwirkung an mindestens dieser einen Lagerselektion wegen gemeinschaftlicher Beihilfe (§§47, 49 StGB) zu gemeinschaftlichem Mord (§§47, 211 StGB) begangen in gleichartiger Tateinheit (§73 StGB) an mindestens zehn Menschen zu verurteilen.
3. Zu II.3.
Die Erschiessungen nach den sog. Bunkerentleerungen erfüllen den Tatbestand des Mordes (§211 neuer Fassung StGB). Sie erfolgten aus niedrigen Beweggründen. Hauptmotiv für diese Tötung war, dass man im Bunker Platz für weitere Arrestanten schaffen wollte. Dagegen spricht nicht, dass man nicht einfach willkürlich bestimmte Zellen räumte, sondern bei den Bunkerentleerungen eine gewisse Auswahl traf und die - nach der Meinung der an den Bunkerentleerungen teilnehmenden SS-Angehörigen - gefährlichsten und todeswürdigsten Arrestanten aussuchte. Wenn man auch bei den Bunkerentleerungen ein gewisses Scheinverfahren durchführte und in Anmassung der Rechte eines Gerichtes die Auswahl der Delinquenten nach der Art ihrer angeblichen Verfehlungen oder nach sonstigen nicht näher zu erforschenden Gründen traf, also eine Art Urteil über sie fällte, so kam es überhaupt nur zu diesem Verfahren und "Urteil", weil man Platz im Bunker für neue Arrestanten brauchte und man diesen Platz schaffen wollte. Das kommt deutlich in dem von Grabner gebrauchten Ausdruck "Bunker ausstauben" zum Ausdruck. Der Raummangel in dem Arrestbunker war der Hauptgrund für die Erschiessungen. Man wollte keine neuen Arrestzellen in anderen Blocks einrichten, daher erschoss man einfach einen Teil der Arrestanten.
Tötungen aus diesen Motiven sind sittlich verachtenswert und stehen auf tiefster sittlicher Stufe. Solche Beweggründe müssen als niedrig bezeichnet werden.
Bei Boger kam noch der Hass auf die Polen hinzu. Wie oben schon ausgeführt, hat Boger wiederholt gegenüber der Zeugin Ro. geäussert, er hasse die Polacken, "die verfluchten Polacken". Soweit Boger an Erschiessungen von Polen mitgewirkt hat (Gestwinski, Gniardoroski), war nach der Überzeugung des Gerichts sein Handeln auch von Hass, also ebenfalls einem niedrigen Beweggrund, bestimmt.
Die Tötungen waren auch grausam. Zwar hat die Tötungsart selbst, nämlich das Erschiessen durch Genickschüsse, den Opfern keine besonderen körperlichen Schmerzen zugefügt. Die Schmerzen und Leiden, die der Täter seinem Opfer aus einer gefühllosen und unbarmherzigen Gesinnung zufügt, können aber auch seelischer Art sein (vgl. BGHSt. 3, 181). Auch eine Tötung durch Erschiessen kann grausam sein, auch wenn die Ausführungsart im engeren Sinne den Opfern keine besonderen Schmerzen zufügt (vgl. BGH NJW 1951, 666). Hier mussten die Arrestanten während der Bunkerentleerung schon in ihrer Zelle seelische Qualen ausstehen, bis ihre Zellen geöffnet und die Entscheidungen über ihr Schicksal getroffen wurden. Alle in den Zellen einsitzenden Häftlinge wussten, dass solche
Bunkerentleerungen den Tod einer Vielzahl von Arrestanten bedeuteten. Jeder musste damit rechnen, selbst zum Tode bestimmt zu werden. War die Entscheidung gefallen und waren die Opfer zu den Todeskandidaten gestellt worden, so wussten sie, dass sie dem Tode kaum noch entrinnen konnten. Den nahen Tod vor Augen, mussten sie warten, bis die Bunkerentleerung beendet war. Das hat jeweils längere Zeit gedauert. Nach der Überzeugung des Gerichts hat es den Opfern ferner besondere seelische Schmerzen bereitet, dass sie, was sie bereits von vorhergehenden Bunkerentleerungen und Erschiessungen und durch ihre Kameraden, insbesondere die im Block 11 tätigen Funktionshäftlinge, wussten, unschuldig auf eine so menschenunwürdige Art und Weise getötet werden sollten. Auch im Waschraum mussten die Opfer jeweils längere Zeit, den nahen Tod vor Augen, warten. Es dauerte stets längere Zeit, bis allen Opfern die Nummern auf die nackte Brust geschrieben worden waren. Welche Todesangst sie dabei ausgestanden haben, ergibt sich daraus, dass sie ihre Notdurft nicht mehr beherrschen konnten. Daneben mussten sie erleben, dass sich die SS-Angehörigen offensichtlich über ihr schweres Schicksal belustigten. Denn sie sahen und bemerkten, dass die SS-Angehörigen, wenn sie aus der Blockführerstube herauskamen und an ihnen vorbei zur Richtstätte gingen, lachten und scherzten und unberührt davon, dass sie ihrer schwersten Stunde entgegensahen, schwatzten. Dies mussten die Delinquenten als eine Verhöhnung und Missachtung empfinden. Das hat sie ohne Zweifel tief in ihrer Ehre verletzt. Nach der Überzeugung des Gerichts hat ihnen dieses Verhalten der SS-Angehörigen ebenfalls tiefe seelische Qualen bereitet. Ferner muss es für die Opfer auch ausserordentlich schmerzlich gewesen sein und war es nach der Überzeugung des Gerichts auch, dass sie auf Befehl der SS-Männer von dem Bunkerkalfaktor nackt im Laufschritt wie ein Stück Vieh zur Exekutionsstätte - der Schwarzen Wand - geschleppt wurden. Während sonst Exekutionen nach rechtmässigen Todesurteilen mit Würde, Ernst und einer gewissen Feierlichkeit vollzogen werden, geschahen hier die Exekutionen unter Missachtung jeglicher Menschenwürde. Besonders qualvoll war es schliesslich noch für alle zum Tode bestimmten Häftlinge - ausser den beiden, die als erste erschossen wurden -, dass sie beim Hinauslaufen aus dem Block 11 noch unmittelbar vor ihrem eigenen Tode die blutigen Leichen ihrer getöteten Kameraden sehen mussten, da man diese gegenüber dem Eingang von Block 11 an der Wand des Blockes 10 aufstapelte.
Daraus, sowie aus der ganzen Art und Weise der Erschiessungen selbst und dem von den SS-Angehörigen gezeigten Verhalten ist gleichzeitig zu ersehen, dass den Delinquenten aus einer gefühllosen und unbarmherzigen Gesinnung heraus diese seelischen Schmerzen und Qualen zugefügt worden sind.
Die Tötungen waren rechtswidrig. Sie erfolgten ohne Urteil eines Gerichts. Auch damals waren Tötungen (ausser im Falle der Notwehr und sonstiger, hier nicht in Betracht kommender Rechtfertigungsgründe) nur gerechtfertigt, wenn sie zur Vollziehung eines auf Todesstrafe lautenden Urteils erfolgten (vgl. BGHSt. 2, 333). Hier lagen solche Urteile nicht zugrunde. Die Tötungen erfolgten nicht einmal auf Befehl höherer SS- oder Polizeidienststellen, etwa des RSHA oder Himmlers.
Der Angeklagte Boger kann sich nicht darauf berufen, dass er auf Grund von Befehlen seiner Vorgesetzten an den Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen mitgewirkt habe. §47 MStGB findet daher hier keine Anwendung. Der Leiter der Politischen Abteilung, Grabner, setzte zwar die Termine für die Bunkerentleerungen fest und bestellte die einzelnen SS-Angehörigen - auch den Angeklagten Boger - zu diesen Terminen in den Arrestbunker. Bei der Auswahl der zu erschiessenden Häftlinge und bei den anschliessenden Erschiessungen selbst wirkte Boger aber auf Grund eigener freier Entschliessung in innerer Übereinstimmung mit dem SS-Untersturmführer Grabner mit. Er übte massgebenden Einfluss auf die Entscheidung Grabners oder Aumeiers in der Richtung aus, dass die von ihm eingelieferten Häftlinge in vielen Fällen erschossen wurden. Im Falle Gestwinski handelte er nicht im Rahmen eines gegebenen Befehls, sondern auf Grund freier eigener Entscheidung. Er war es, der den Tod dieses Häftlings wollte und vorschlug. Das gleiche gilt für die anderen festgestellten Fälle. Die eigenhändigen Erschiessungen führte er aus eigenem Antrieb, nicht auf Befehl aus. Boger hat somit in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken mit Grabner und Aumeier oder einem anderen an den Bunkerentleerungen teilnehmenden Schutzhaftlagerführer den Tod der Häftlinge gewollt.
Boger hat auch vorsätzlich gehandelt. Er hat den Tod von mindestens neun Häftlingen, nämlich von 6 Häftlingen am 3.3.1943, der Häftlinge Solarz und Gniardoroski am 21.9.1943 und eines weiteren Häftlings am 28.9.1943, deren Tötung das Gericht feststellen konnte, bewusst gewollt. Er kannte auch die Beweggründe für die Tötungen, dass nämlich der Bunker wegen Überfüllung "ausgestaubt", d.h. geleert werden sollte, und er war sich auch darüber im klaren, dass er selbst den Tod polnischer Häftlinge aus Hass auf die Polen wollte. Boger kannte ferner die gesamten Umstände, die die Tötungen als grausam kennzeichnen; denn er war von Anfang bis zum Ende dabei.
Dem Angeklagten Boger war auch klar, dass die Tötungen rechtswidrig waren. Er hatte ebenso wie die anderen SS-Angehörigen die Erklärung unterschrieben, dass über das Leben eines Häftlings nur der "Führer" zu entscheiden habe. Er wusste also auf Grund dieser quittierten Belehrung, dass Grabner, Aumeier und er selbst nicht einmal nach der Auffassung der höheren Führung, die sonst wenig nach Recht und Unrecht fragte, über Leben und Tod eines Häftlings entscheiden durften und nicht berechtigt waren, einen Häftling zu töten. Als Kriminalbeamter musste ihm zudem geläufig sein und war ihm nach der Überzeugung des Gerichts auch völlig klar, dass Tötungen von Menschen ohne Urteil rechtswidrig sind. Der Angeklagte Boger hat auch nicht irrig angenommen, dass Befehle aus Berlin die Tötungen angeordnet hätten. Das konnte er wegen der ihm bekannten Umstände gar nicht annehmen. Die einzelnen Fälle wurden jeweils erst im Bunker, wenn auch nur ganz kurz, besprochen. Die Entscheidung über Leben und Tod eines Häftlings fiel erst im Bunker. Es wurde nie auf irgendeinen Exekutionsbefehl Bezug genommen. Er selbst hat auch auf die Entscheidungen massgeblichen Einfluss ausgeübt (Fall Gestwinski). In einem Fall hat er einen für den Tod bestimmten Häftling schliesslich vor dem Tod bewahrt (Be.). Hier war er also selbst Herr über Leben und Tod. Für Exekutionsbefehle blieb somit kein Raum.
Schliesslich führte auch der Umstand, dass die getöteten Opfer aus der Stärke des Blockes 11 zunächst in die Stärke des HKB übernommen wurden und dann als normal verstorben abgesetzt wurden, dem Angeklagten Boger deutlich vor Augen, dass hier rechtswidrige Tötungen verschleiert werden sollten. Er hat selbst - wie der Zeuge P. glaubhaft bekundet hat - wiederholt nach Erschiessungen die Listen der Erschossenen in den HKB gebracht und dem Schreiber befohlen, die aufgeführten Häftlinge vom "HKB abzusetzen".
Da Boger mit besonderem Eifer an den Bunkerentleerungen teilgenommen und an den anschliessenden Erschiessungen mitgewirkt hat, entfällt auch das Vorliegen irgendeines Notstandes im Sinne der §§52 und 54 StGB, ebenso die irrige Annahme der Voraussetzungen eines solchen Notstandes. Wenn Boger in der Hauptverhandlung behauptet hat, er habe nur einmal zwei Häftlinge auf Befehl Grabners erschiessen müssen, so ist das nur eine Schutzbehauptung, die ihm das Gericht nicht geglaubt hat.
Auch wenn man entgegen der Auffassung des Schwurgerichts der Meinung wäre, dass die Mitwirkung Bogers an den Bunkerentleerungen und den nachfolgenden Erschiessungen im Rahmen des §47 MStGB zu beurteilen sei, käme man zu dem gleichen Ergebnis. Denn Boger hat klar erkannt, dass die Tötungen verbrecherisch waren. Befehle, die auf solche Tötungen hinzielten, waren somit ebenfalls verbrecherisch. Wenn er gleichwohl mit besonderem Eifer und in der geschilderten Art und Weise mitgewirkt hat, so wäre er im Rahmen des §47 MStGB als Mittäter des Befehlsgebers zu bestrafen. Die Erschiessung eines jeden Häftlings ist als selbständige Tat im Sinne des §74 StGB anzusehen. Denn jeder Häftling wurde durch eine besondere Willensentschliessung und Entscheidung zum Tode bestimmt. Die Tötung eines jeden Häftlings erforderte eine besondere Willensbetätigung der Schützen, die die Genickschüsse abgaben.
Der Angeklagte Boger war daher wegen gemeinschaftlichen Mordes in mindestens neun Fällen (§§47, 211, 74 StGB) zu neunmal lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen. Wegen des vom Zeugen F. geschilderten Falles Wosniakowski konnte eine Verurteilung des Angeklagten Boger nicht erfolgen, weil insoweit das Verfahren mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft eingestellt worden ist (Ziff.5 des EB).
4. Zu II.4.
Die festgestellten Tötungen bei verschärften Vernehmungen durch Boger erfüllen ebenfalls den Tatbestand des Mordes. Sie waren grausam. Schon das Hängen auf der Bogerschaukel war für die Häftlinge qualvoll. Durch die Schläge mit dem Ochsenziemer oder mit einem Stock hat Boger den Häftlingen jeweils ausserordentlich schwere körperliche Schmerzen zugefügt, zumal er nicht nur auf das Gesäss, sondern auch auf andere Körperteile einschlug. In dem einen von Bur. geschilderten Fall liess Boger den Häftling nach schweren Misshandlungen in qualvoller Stellung zurück. In den beiden anderen von Bur. geschilderten Fällen schlug Boger etwa zwei Stunden mit Unterbrechungen auf die Häftlinge ein. Auch in dem von der Zeugin Wa. geschilderten Fall trat der Tod erst nach längeren Misshandlungen ein. Schmerzen und Qualen mussten von den Gemarterten daher lange Zeit erduldet werden. Auch in dem vom Zeugen Lee. geschilderten Fall wurde der misshandelte Häftling von Boger wie ein toter Gegenstand aus dem Fenster geworfen und in hilfloser Stellung liegen gelassen. Der Häftling litt infolge der schmerzhaften Misshandlungen an qualvollem Durst, bis er schliesslich starb.
Aus der Art und Weise, wie der Angeklagte Boger die sog. verschärften Vernehmungen durchführte, ergibt sich klar, dass er nur aus einer gefühllosen und unbarmherzigen Gesinnung heraus den Opfern solche Qualen und Leiden zufügen konnte.
Die Tötungen waren auch rechtswidrig. Sie waren auch nach der Anschauung der damaligen Zeit nicht erlaubt. Irgendwelche Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. Der Angeklagte Boger hat auch vorsätzlich gehandelt. Er hat damit gerechnet, dass die Häftlinge durch die Art seiner Behandlung sterben könnten und hat dies bewusst billigend in Kauf genommen. Somit hat er mit bedingtem Vorsatz gehandelt. Das genügt. Boger kannte auch die gesamten Umstände, die die Tötungen als grausam kennzeichnen. Es ist nicht erforderlich, dass er selbst die Behandlung der Opfer als grausam wertete. Aus den getroffenen Feststellungen ergibt sich ferner, dass Boger auch das Bewusstsein gehabt hat, Unrecht zu tun. Irgendwelche Schuldausschliessungsgründe liegen nicht vor.
Boger war daher wegen der festgestellten Tötungen bei verschärften Vernehmungen wegen Mordes in mindestens fünf Fällen (§§211, 74 StGB) zu fünfmal lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen.
5. Zu II.5.
Die Erschiessungen der mindestens hundert jüdischen Häftlinge erfüllen ebenfalls den Tatbestand des Mordes (§211 StGB), denn sie geschahen aus niedrigen Beweggründen. Wie unter II.5. festgestellt worden ist, hat Boger zusammen mit Houstek (Erber) die mindestens hundert Häftlinge nicht aus irgendeinem Affekt heraus, sondern aus Rache, weil sie es gewagt hatten, sich gegen die SS zu erheben, erschossen. Rachsucht ist ein Beweggrund, der nach gesundem Empfinden als sittlich verachtenswert anzusehen ist (vgl. Schönke-Schröder Anm.11 zu §211 StGB; BGH in NJW 1958, 189).
Boger hat nicht auf Befehl gehandelt. Die Anwendung des §47 MStGB scheidet daher aus. Irgendwelche Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. Die Tötung der Häftlinge erfolgte ohne Gerichtsurteil. Auch eine Notwehrlage war nicht gegeben. Der Angriff der Häftlinge auf die SS-Angehörigen war bereits beendet. Die Häftlinge waren völlig wehrlos. Hiervon abgesehen, war der vorherige Angriff der Häftlinge auf die SS-Angehörigen durch eine eigene Notwehrlage gerechtfertigt (§53 StGB), da sie unschuldig getötet werden sollten. Aggressive Abwehrhandlungen der SS gegen diesen Angriff waren nicht durch Notwehr gerechtfertigt, da Notwehr gegen durch Notwehr gerechtfertigte Angriffe ausgeschlossen ist (vgl. Schönke-Schröder Anm.28 zu §53 StGB; RGSt. 67, 340).
Der Angeklagte Boger hat auch vorsätzlich gehandelt. Er hat die am Boden liegenden Häftlinge bewusst und gewollt erschossen.
Er kannte auch seine eigenen Beweggründe, die ihn hierzu bestimmten. Unerheblich ist, ob er seine eigenen Motive ebenfalls als niedrig im Sinne des §211 StGB empfand. Es genügt, dass er wusste, dass ihn Rachsucht zu seinem Handeln antrieb, also ein Motiv, das nach allgemeiner sittlicher Anschauung als niedrig anzusehen ist.
Der Angeklagte wusste auch, dass die Tötungen rechtswidrig waren. Das ergibt sich schon daraus, dass er sein eigenes Motiv für die Tötungen kannte (Rachsucht) und aus den gesamten Umständen nicht annehmen konnte und nach der Überzeugung des Gerichts auch nicht angenommen hat, dass irgendein Rechtfertigungsgrund gegeben war. Er wusste, dass Urteile eines Gerichts nicht vorlagen, dass er vielmehr die Häftlinge eigenmächtig zusammen mit Houstek (Erber) tötete. Er konnte auch nicht irrig irgendeine Notwehrlage annehmen, da die Häftlinge wehrlos am Boden lagen.
Die Tötungen der hundert Häftlinge sind als selbständige Taten im Sinne des §74 StGB anzusehen. Zwar muss davon ausgegangen werden, dass die Erschiessungen der am Boden liegenden Häftlinge auf einem einzigen Entschluss Bogers und Housteks beruhen. Die Tötung eines jeden Häftlings erforderte jedoch jeweils eine besondere Willensbetätigung Bogers oder Housteks, so dass die Erschiessung eines jeden Häftlings als eine selbständige Handlung im Sinne des §74 StGB angesehen werden muss.
Allerdings hat Boger nicht alle hundert Häftlinge eigenhändig erschossen. Eine nicht mehr festzustellende Anzahl der mindestens hundert Häftlinge hat Houstek getötet. Beide haben aber gleichzeitig und, nach der gesamten Sachlage und der Überzeugung des Gerichts, in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken gehandelt und haben jeweils die Tötungen durch den anderen ebenfalls in ihren Willen aufgenommen. Beide haben somit als Mittäter (§47 StGB) gehandelt und sind für sämtliche mindestens hundert Tötungen in vollem Umfang strafrechtlich verantwortlich.
Der Angeklagte Boger war daher wegen gemeinschaftlichen Mordes in mindestens hundert Fällen (§§47, 211, 74 StGB) zu hundertmal lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen.
VI. Hilfsbeweisanträge
Der Hilfsbeweisantrag des Rechtsanwalts Dr. A., des Verteidigers des Angeklagten Boger:
"Falls das Gericht seine Ausführungen in seinem Plädoyer nicht als wahr unterstelle, Dokumente vom Institut für Zeitgeschichte in München beizuziehen und den ehemaligen Schulungsleiter in Auschwitz Knittel als Zeugen zu vernehmen", war gemäss §244 StPO abzulehnen, da die Urkunden, die herbeigezogen und offensichtlich verlesen werden sollen, nicht konkret bezeichnet sind und im übrigen keine konkreten beweiserheblichen Tatsachen angeführt sind, zu deren Beweis die Urkunden verlesen und der Schulungsleiter Knittel vernommen werden soll.
VII. Strafzumessung
Bei der Bemessung der gegen den Angeklagten Boger wegen Beihilfe zum Mord in zwei Fällen auszuwerfenden Strafen sind folgende Umstände von Bedeutung gewesen: Zu Gunsten des Angeklagten konnte berücksichtigt werden, dass seine Mitwirkung sowohl bei dem "Rampendienst" wie bei der Lagerselektion auf Befehl beruhte, er also nicht von sich aus tätig geworden ist, dass er sich mit seinem sonst gezeigten Eifer und seiner Brutalität zurückhielt, und dass er insgesamt keinen besonders erheblichen Tatbeitrag leistete. Demgegenüber erhöhte, insbesondere bei der auf der Rampe geleisteten Beihilfe, die Zahl der unter seiner Mitwirkung gemordeten Menschen den Unrechtsgehalt der Straftaten, was sich strafschärfend auswirkte.
Danach konnten gemäss §§49 Abs.2, 44 StGB in Verbindung mit §4 der VO gegen Gewaltverbrecher vom 5.12.1939 die Strafen aus dem Strafrahmen von 3 Jahren bis zu 15 Jahren Zuchthaus entnommen werden.
Im Falle II.1. (Rampendienst) erschien eine Zuchthausstrafe von 4 Jahren und wegen der weiteren Beihilfe (II.2.) eine solche von 3 Jahren 6 Monaten Zuchthaus als ausreichende Strafe und Sühne.
Unter Berücksichtigung der angeführten Strafzumessungsgründe ist die Gesamtstrafe nach §74 StGB auf 5 Jahre Zuchthaus festgesetzt worden.
D. Die Straftaten des Angeklagten St.
I. Der Lebenslauf des Angeklagten St.
Der Angeklagte St. ist am 14.6.1921 als Sohn eines Polizeimeisters in Darmstadt geboren. Er hat noch einen jüngeren Bruder, der jetzt als Realschullehrer in Büdingen tätig ist. Der Angeklagte St. besuchte von 1927 bis 1931 die Volksschule in Darmstadt und anschliessend von 1931 bis März 1937 das Realgymnasium in Darmstadt, das er mit der Obersekundareife verliess. Die Leistungen des Angeklagten im Gymnasium waren zunächst durchschnittlich, in den letzten Jahren vor Schulabgang liessen sie jedoch nach. Deswegen kam es - wie der Angeklagte angibt - zu häufigen Auseinandersetzungen mit seinem Vater. Dieser soll damals die Auffassung vertreten haben, dass sein Sohn in ordentliche Zucht gehöre, wofür er den Arbeitsdienst und den Militärdienst als geeignete Erziehungseinrichtungen ansah. Eine Einstellung beim Arbeitsdienst oder bei der Wehrmacht, die von dem Angeklagten und seinem Vater in Erwägung gezogen wurde, war damals jedoch nicht möglich, da St. erst 16 Jahre alt war, das Einstellungsalter für Arbeits- und Wehrdienst jedoch 17 Jahre betrug. Dagegen war der Eintritt in die SS-Totenkopfverbände bereits mit 16 Jahren möglich. Der Vater des Angeklagten St., der von der Wehrmacht durch ein Merkblatt darauf hingewiesen worden war, dass das Eintrittsalter bei der SS 16 Jahre sei, gab nun seine schriftliche Einwilligung für den Eintritt in die SS. St. wurde am 1.12.1937 auf Grund freiwilliger Meldung als Staffelmann zur 2. SS-Totenkopfstandarte "Brandenburg" nach Oranienburg bei Berlin eingezogen. Die Ausbildung bestand zunächst in normaler infanteristischer Grundausbildung. Sie wurde ergänzt durch intensive Schulung in der nationalsozialistischen Anschauung. Wert wurde vor allem auf Rassenkunde gelegt. Im Mittelpunkt des Unterrichts standen unter anderem die Bücher des Rassenforschers Günther, Rosenbergs und anderer nationalsozialistischer Theoretiker. Die Grundausbildung dauerte 6 Monate. Schon im zweiten Monat der Ausbildungszeit, also im Januar 1938, wurde der Angeklagte bei der Bewachung des KZ Oranienburg als Aussenwache eingesetzt. Nach sechsmonatiger Ausbildungszeit in Oranienburg wurde der Angeklagte St. Ende Juni 1938 nach einem kurzen Urlaub zu dem KZ Buchenwald versetzt, wo er in einem Reiterzug Pferde zu betreuen hatte und später auch im Wachdienst eingesetzt wurde. Nach einem Jahr Dienstzeit wurde er am 1.12.1938 zum SS-Sturmmann und am 1.8.1939 zum SS-Rottenführer befördert.
Bei Ausbruch des Krieges am 1.9.1939 war er SS-Rottenführer und Gruppenführer. Er wurde als Rekrutenausbilder von September bis Dezember 1939 in Buchenwald eingesetzt. Dann wurde das Rekrutenregiment nach Dachau verlegt. Hier blieb St. bis April 1940. Anschliessend kam er zum Wach- und Ehrenbataillon nach Prag. Am 1.6.1940 wurde er zum SS-Unterscharführer befördert. Im August 1940 wurde er als Gruppenführer zum SS-Regiment "Westland" nach München versetzt. Hier zog er sich durch Sturz vom Pferd einen doppelten Unterschenkelbruch zu. Er lag 6 Wochen im Lazarett und wurde dann - bei weiterer Behandlungsbedürftigkeit - g.v.H. geschrieben und entlassen. Er kam deshalb für den Einsatz bei einem aktiven Frontregiment zunächst nicht in Frage und wurde zum Wachbataillon Dachau zurückversetzt. Hier war er von November bis Dezember 1940 als Aussenwache eingesetzt.
Am 15.12.1940 kamen etwa 20 bis 40 SS-Unterführer, zu denen auch der Angeklagte St. gehörte, von Dachau zum KZ Auschwitz. St. wurde in Auschwitz als Blockführer eingesetzt. Ihm war der Block 7 (der spätere Block 22), in dem sich vornehmlich polnische Schüler und Studenten im Alter bis zu 25 Jahren befanden, unterstellt. Im Mai 1941 kam er zur Politischen Abteilung, wo ihm bald die Leitung der Aufnahmeabteilung übertragen wurde.
Da St. seine Schulausbildung beenden wollte, liess er sich von Weihnachten 1941 bis zum März 1942 beurlauben. Er legte am 13.3.1942 als Externer an der Liebig-Oberschule in Darmstadt die Reifeprüfung ab. Anschliessend nahm er seine Tätigkeit in Auschwitz wieder auf. Er wurde am 1.9.1942 zum Oberscharführer befördert. Im Sommer 1942 beantragte er Studienurlaub, der ihm vom 1.12.1942 bis zum 31.3.1943 gewährt wurde. Er wurde am 8.12.1942 an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt am Main immatrikuliert. Am gleichen Tag erhielt er seinen Studentenausweis. Er studierte dann an der Universität in Frankfurt am Main ein Semester Rechtswissenschaft bis zum 31.3.1943. Während seines Studienurlaubs richtete der Angeklagte - wie er angibt - ein Versetzungsgesuch an den SS-Obergruppenführer Heismayer. Nach Beendigung des Studienurlaubs meldete er sich am 1.4.1943 bei dem Leiter der Politischen Abteilung SS-Untersturmführer Grabner in Auschwitz wieder zurück. Ihm wurde jedoch von Grabner mitgeteilt, dass er mit Wirkung vom 1.4.1943 zu einem Ausbildungslehrgang nach Dachau kommandiert sei. Der Angeklagte St. fuhr am 2.4.1943 wieder von Auschwitz weg, unterbrach seine Fahrt in Darmstadt, wo er zwei Tage zu Hause verbrachte, und begann am 5.4.1943 seinen Dienst in Dachau. Der Lehrgang dauerte bis zum 25.5.1943. Mit Wirkung vom 25.5.1943 wurde er dann zur SS-Panzergrenadierdivision "Das Reich" versetzt. Er kam an der Ostfront zum Einsatz und wurde am 9.7.1943 verwundet. Nach einem Lazarettaufenthalt und Genesungsurlaub wurde er im Januar 1944 zur SS-Genesungskompanie nach Prag versetzt. Von hier aus wurde er am 1.3.1944 zu einem Vorbereitungslehrgang für die SS-Junkerschule nach Arolsen kommandiert, der bis Ende April 1944 dauerte. Von Mai 1944 bis Oktober 1944 besuchte er die SS-Junkerschule in Klagenfurt. Nach einem weiteren Lehrgang auf einem Truppenübungsplatz bei Prag wurde er am 9.11.1944 zum SS-Untersturmführer befördert. Während des Lehrganges erkrankte er an Gelbsucht. Nach seiner Genesung kam er im Januar 1945 erneut zum Fronteinsatz bei der SS-Division "Nordland". Er wurde am 5.3.1945 zum zweiten Mal verwundet.
In Berlin geriet er am 2.5.1945 in russische Kriegsgefangenschaft. Nach zwei Tagen gelang es ihm, aus der Gefangenschaft zu entfliehen. Er schlug sich nach Sachsen-Anhalt durch, wo er bis zum Herbst 1946 in der Landwirtschaft arbeitete. Von Herbst 1946 bis Sommer 1948 studierte er an der Universität Giessen Landwirtschaft. Anschliessend arbeitete er, da er sein Studium wegen des schwebenden Spruchkammerverfahrens nicht fortsetzen konnte, von 1948 bis 1950 auf einem Bauernhof und machte dabei gleichzeitig sein landwirtschaftliches Praktikum in der Nähe von Nidda/Hessen. Im Jahre 1948 wurde er von der Spruchkammer in Darmstadt in die Gruppe der Minderbelasteten und auf seine Berufung hin am 20.8.1950 in die Gruppe IV (Mitläufer) eingestuft. Von 1950 bis 1951 studierte er weitere zwei Semester Landwirtschaft an der Universität in Giessen. Danach legte er die Diplomprüfung mit Erfolg ab. Im Anschluss daran leistete er einen zweijährigen Vorbereitungsdienst bei den landwirtschaftlichen Schulen in Weilburg und Darmstadt, die dem Hessischen Landwirtschaftsministerium unterstanden. Im Februar 1953 bestand er in Darmstadt sein Assessorexamen. Von November 1953 bis Herbst 1955 war er an der landwirtschaftlichen Schule in Gross-Gerau als Lehrer tätig. Danach arbeitete er als Sachbearbeiter für Wirtschaftsberatung bei der Landwirtschaftskammer in Frankfurt am Main bis zum 31.3.1957. Vom 1.4.1957 bis zu seiner Verhaftung am 23.4.1959 lehrte er an der Landwirtschaftsschule in Lövenich/Weiden bei Köln.
Der Angeklagte hat im Jahre 1953 geheiratet. Aus seiner Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen. Der Vater des Angeklagten hat am 31.3.1948 Selbstmord begangen.
Der Angeklagte ist durch Urteil des Bezirksschöffengerichts in Darmstadt vom 6.5.1956 - 6 Ns 4/56 wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Gefährdung des Strassenverkehrs zu einer Gefängnisstrafe von 6 Monaten verurteilt worden. Ausserdem wurde ihm die Fahrerlaubnis für 1 Jahr entzogen. Er hat die Strafe vom 20.8. - 20.12.1956 teilweise verbüsst, der Rest wurde zur Bewährung ausgesetzt.
Der Angeklagte befand sich vom 23.4.1959 bis zum 23.10.1963 in dieser Sache in Untersuchungshaft. Dann wurde er von dem Vollzug der Untersuchungshaft verschont. Seit dem 15.5.1964 befindet er sich erneut in Untersuchungshaft.
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Mitwirkung des Angeklagten St. an Erschiessungen im kleinen Krematorium (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
a. Etwa im Mai oder Juni 1942 wurde eine Gruppe jüdischer Männer, Frauen und Kinder von der Gestapoleitstelle Kattowitz nach Auschwitz in LKWs transportiert. Die Kinder waren im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren. Die ganze Gruppe bestand aus mindestens zwanzig Personen. Die jüdischen Menschen waren in Ostoberschlesien in Ausführung des Befehls Hitlers zur "Endlösung der Judenfrage" von der Gestapoleitstelle Kattowitz festgenommen worden und sollten in Auschwitz gemäss diesem Befehl getötet werden.
Vor Ankunft des Transportes erhielt der Angeklagte St. von dem Leiter der Politischen Abteilung im KL Auschwitz die Mitteilung, dass diese Personen unmittelbar nach ihrer Ankunft in das kleine Krematorium zu führen und dort zu erschiessen seien. Der Angeklagte St. benachrichtigte kurz vor der Ankunft des Transportes den Rapportführer Palitzsch, dass im kleinen Krematorium Erschiessungen durchzuführen seien. Palitzsch begab sich daraufhin mit einem Kleinkalibergewehr unmittelbar in den für die Erschiessungen vorgesehenen Raum in dem Krematorium. Der Angeklagte St. nahm die jüdischen Menschen nach ihrer Ankunft in Empfang und führte sie, ohne sie in die Lagerstärke aufzunehmen, zum kleinen Krematorium. Unterwegs erklärte er ihnen auf ihre Fragen, was mit ihnen geschehen solle, sie würden zunächst gebadet, dann würden sie im Lager eingekleidet. Das glaubten diese auch. Im kleinen Krematorium befand sich vor dem für die Erschiessungen vorgesehenen Raum ein Vorraum. In diesen führte der Angeklagte St. die jüdischen Menschen hinein. Dann liess er sie ihr Gepäck und ihre Kleider ablegen. Hierauf führte er den ersten Juden nackt in den Erschiessungsraum hinein. Dort wartete bereits der Rapportführer Palitzsch mit dem hinter dem Rücken versteckten Kleinkalibergewehr. St. befahl dem Juden, sich mit dem Rücken zu Palitzsch aufzustellen. Nachdem dies geschehen war, erschoss Palitzsch den ahnungslosen Mann von hinten aus kurzer Entfernung durch Genickschuss. Die Leiche wurde sofort von Häftlingen, die im kleinen Krematorium beschäftigt waren, hinausgeschafft und in dem Verbrennungsofen des Krematoriums verbrannt. Die im Vorraum wartenden Menschen konnten den Knall des Schusses nicht hören, da auf das Kleinkalibergewehr ein Schalldämpfer aufgesetzt worden war und der Eingang zum Erschiessungsraum mit einer doppelwandigen Tür versehen war.
Nach der Erschiessung des ersten jüdischen Menschen führte St. die anderen im Vorraum wartenden Juden, auch die Kinder, einzeln und nacheinander in den Erschiessungsraum hinein. Sie wurden alle auf die gleiche Weise wie der erste jüdische Mensch erschossen. Häufig lenkten St. oder Palitzsch die Opfer kurz vor der Erschiessung noch dadurch ab, dass sie ihnen befahlen, in eine bestimmte Richtung zu schauen.
Nach Beendigung der Erschiessungen meldete der Angeklagte St. dem RSHA schriftlich die Anzahl der erschossenen Juden, wobei er aus Tarnungsgründen nur angab, dass diese Personen "gesondert untergebracht" worden seien.
b. Etwa vier bis sechs Wochen später wurde erneut eine Gruppe von mindestens zwanzig jüdischen Männern, Frauen und Kindern aus Oberschlesien durch die Gestapoleitstelle in Kattowitz nach Auschwitz deportiert. Die Kinder waren ebenfalls im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren. Auch in diesem Fall erhielt der Angeklagte St. von Grabner die Mitteilung, dass die Juden im kleinen Krematorium zu erschiessen seien. St. führte die Gruppe nach ihrer Ankunft sofort zum kleinen Krematorium. Das Kleinkalibergewehr nahm er dieses Mal selbst mit, da er Palitzsch zuvor nicht hatte erreichen können. Unterwegs erzählte er den jüdischen Menschen, sie würden zunächst gebadet und kämen dann in das Lager. Das glaubten diese auch. Von ihrer bevorstehenden Tötung ahnten sie nichts. Dass der Angeklagte St. ein Gewehr bei sich trug, erregte ihren Argwohn nicht. Denn sie waren es gewohnt, von bewaffneten Posten begleitet zu werden. Als St. mit ihnen beim kleinen Krematorium ankam, war Palitzsch bereits dort. Denn St. hatte ihn durch einen SS-Mann suchen und zum kleinen Krematorium bestellen lassen. St. übergab ihm das Gewehr, und Palitzsch ging in den Erschiessungsraum hinein. Die jüdischen Menschen mussten sich wieder im Vorraum auskleiden. Dann führte sie der Angeklagte St. einzeln und nacheinander in den Erschiessungsraum hinein, wo sie von Palitzsch auf die gleiche Weise, wie in dem unter a. geschilderten Fall, getötet wurden. Auch in diesem Fall meldete St. dem RSHA die Anzahl der erschossenen Juden unter Verwendung der Tarnbezeichnung "gesondert untergebracht".
St. wusste in den geschilderten Fällen, dass die Menschen nur deswegen erschossen wurden, weil sie Juden waren, sich aber keiner unerlaubten Handlungen schuldig gemacht hatten. Ihm war auch bekannt, dass die Menschen nicht durch irgendein Gericht zum Tode verurteilt waren.
Der Angeklagte St. hat noch weitere Personengruppen zum Erschiessen in das kleine Krematorium und auf den Hof zwischen Block 10 und 11 geführt und dort an den Erschiessungen teilgenommen. Nähere Einzelheiten konnten jedoch nicht festgestellt werden, insbesondere war nicht zu klären, um welche Personengruppen es sich gehandelt hat und wieviel Menschen jeweils erschossen worden sind.
2. Die Mitwirkung des Angeklagten St. bei der Erschiessung von zwei Kindern (EB 1)
Zu einem nicht mehr näher festzustellenden Zeitpunkt - wahrscheinlich im Sommer 1942 - brachte der Angeklagte St. eine polnische Frau und zwei polnische Kinder zur Aufnahmeabteilung der Politischen Abteilung. Die Frau trug das eine Kind, das noch sehr klein war, auf dem Arm. Das andere Kind, das nicht ihr eigenes war, führte sie an der Hand. St. liess diese drei Personen warten und ging zur Rapportführerstube. Von dort holte er ein Kleinkalibergewehr. Dann führte er die drei Personen allein in das kleine Krematorium. Dort wurden die drei Personen mit dem Kleinkalibergewehr erschossen. Ob St. die beiden Kinder und die Frau eigenhändig erschossen hat, konnte nicht mit Sicherheit geklärt werden. Es spricht zwar sehr viel dafür, das Gericht ist jedoch zu seinen Gunsten davon ausgegangen, dass noch ein zweiter SS-Angehöriger im kleinen Krematorium anwesend gewesen ist und die Erschiessungen der drei Personen in Gegenwart des Angeklagten St. vollzogen hat, ähnlich wie bei der Erschiessung der jüdischen Menschen (vgl. oben 1.a. und b.).
Gegen die Kinder lag kein Todesurteil vor. Ob die Frau durch ein Polizeistandgericht zum Tode verurteilt worden war, konnte nicht geklärt werden. Zu Gunsten des Angeklagten St. ist das Schwurgericht davon ausgegangen, dass die Frau auf Grund eines solchen Todesurteils erschossen worden ist. Ferner wurde zu seinen Gunsten unterstellt, dass die Erschiessung der Kinder auf Befehl einer Gestapodienststelle angeordnet worden ist.
Nach der Erschiessung der drei Personen kam der Angeklagte St. allein aus dem kleinen Krematorium heraus. Er kehrte zu seinem Dienstzimmer zurück. Er war sehr aufgeregt. Er wusch sich die Hände, zog sich den Rock aus und liess sich von seinem Kalfaktor die Schuhe putzen. Dann setzte er sich an seinen Schreibtisch. Obwohl er sonst nicht rauchte, zündete er sich eine Zigarette an.
Der Angeklagte St. wusste, dass die kleinen Kinder ohne Todesurteil unschuldig nur deswegen getötet wurden, weil sie Angehörige des polnischen Volkes und damit eines - nach nationalsozialistischer Auffassung - minderwertigen Volkes waren.
3. Die Mitwirkung des Angeklagten St. bei der Tötung jüdischer Menschen durch Gas im kleinen Krematorium (Eröffnungsbeschluss Ziffer 3)
Der Angeklagte St. hat auch an mehreren Vergasungen von jüdischen Menschen im kleinen Krematorium teilgenommen. Das Schwurgericht hat hierzu im einzelnen folgendes festgestellt: Eines Abends, im Oktober 1941, erhielt der Angeklagte St. von dem Leiter der Politischen Abteilung, Grabner, den Befehl, sich am nächsten Abend vor dem kleinen Krematorium einzufinden. Grabner erklärte hierbei dem Angeklagten St., dass er über die Dinge und Ereignisse des nächsten Tages strengstes Stillschweigen zu wahren hätte. St. musste auf Verlangen Grabners eine entsprechende schriftliche Erklärung unterzeichnen.
Am nächsten Tag kam ein Transport jüdischer Menschen nach Einbruch der Dunkelheit mit LKWs an. Die Juden mussten vor dem kleinen Krematorium aussteigen und antreten. St. rief ihre Namen anhand der ihm von dem Transportführer übergebenen Liste auf, um ihre Stärke festzustellen. Danach wurden die Menschen in den Vergasungsraum hineingeführt und durch Einwerfen von Zyklon B getötet. Für St. war dies die erste Vergasung, die er miterlebte.
Einige Zeit später kamen abends gegen 22.00 Uhr mehrere LKWs mit mindestens zweihundert jüdischen Männern, Frauen und Kindern an. Die jüdischen Menschen mussten vor dem kleinen Krematorium aussteigen und antreten. Sie stammten aus Ostoberschlesien und waren zum Zwecke ihrer Tötung nach Auschwitz deportiert worden. St. nahm auf Befehl Grabners von dem Transportführer die Listen mit den Namen und der Anzahl der eingelieferten Personen entgegen. Dann liess er die Deportierten in den Hof des kleinen Krematoriums einrücken, wo er ihre Namen vorlas, um die Stärke festzustellen. Ausser St. waren inzwischen der Lagerkommandant, der Schutzhaftlagerführer, Grabner und andere SS-Angehörige im Hof des kleinen Krematoriums eingetroffen. Nach Feststellung der Stärke liess St. die Menschen, denen von den SS-Angehörigen gesagt wurde, sie würden gebadet, in den Vergasungsraum des kleinen Krematoriums einrücken. Die Juden ahnten nicht, was ihnen bevorstand. Als alle im Vergasungsraum waren, wurde die Tür von aussen verschlossen und verriegelt. Danach sollte durch die zwei hierfür eingeteilten Desinfektoren das Zyklon B von aussen durch die dafür vorgesehenen Öffnungen in den Vergasungsraum hineingeschüttet werden. Es war jedoch nur ein Desinfektor anwesend. Grabner gab daraufhin dem Angeklagten St. den Befehl, das Zyklon B einzuschütten. St. tat dies auch zusammen mit dem anderen Desinfektor. Durch das sich entwickelnde Gas wurden alle im Vergasungsraum befindlichen Männer, Frauen und Kinder getötet, wie es bereits bei Erörterung der Straftaten des Angeklagten Mulka näher beschrieben worden ist.
Nach der Aktion meldete St. die Anzahl der getöteten Menschen schriftlich dem RSHA, indem er angab, dass die Juden "gesondert untergebracht" worden seien.
Der Angeklagte St. wusste, dass die jüdischen Menschen ohne Gerichtsurteil unschuldig nur wegen ihrer Abstammung getötet wurden.
4. Die Mitwirkung des Angeklagten St. bei der Tötung jüdischer Menschen, die ab Sommer 1942 mit Eisenbahnzügen nach Auschwitz deportiert und auf der alten Rampe selektiert wurden (Eröffnungsbeschluss Ziffer 4)
Wie oben bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Mulka unter A.II. bereits ausgeführt worden ist, kamen im Sommer 1942 laufend RSHA-Transporte auf der alten Rampe an. Bei der Abwicklung dieser Transporte wirkte der Angeklagte St. ebenfalls mit. Als Leiter der Aufnahmeabteilung der Politischen Abteilung war es in erster Linie seine Aufgabe, die Stärke der angekommenen Transporte festzustellen. Zu diesem Zweck ging er häufig selbst auf die Rampe, wenn RSHA-Transporte angekommen waren, und nahm von dem Transportführer des Zuges die Listen mit den Namen und der Anzahl der deportierten Menschen entgegen. Dann überprüfte er die Stärke des Transportes, indem er die angetretenen Menschen selbst zählte oder durch andere SS-Angehörige zählen liess. Stimmte die festgestellte Zahl mit der Anzahl der auf der Transportliste aufgeführten Menschen überein, quittierte er dem Transportführer die Übernahme des Transportes.
Nach der oben bereits geschilderten Ausmusterung (Selektion) der angetretenen Menschen stellte St. die Anzahl der als arbeitsfähig ausgesonderten Personen fest. Anschliessend führte er diese entweder selbst in das Lager zum Baden und Einkleiden und der Erledigung der Aufnahmeformalitäten oder er liess sie durch andere SS-Männer in das Lager führen. Er hat auch - was das Gericht als wahr unterstellt hat - die Rampe öfters noch während des Selektionsvorganges mit den als arbeitsfähig ausgesuchten Menschen verlassen. In mindestens einem Fall hat der Angeklagte St. aber auch zusammen mit anderen SS-Angehörigen die aus einem solchen RSHA-Transport zum Tode bestimmten Menschen von der Alten Rampe zu den Auskleidebaracken in der Nähe der umgebauten Bauernhäuser geführt. Auch diese Menschen waren ahnungslos. Als sie sich in den Baracken ihrer Kleider entledigt hatten, führte sie der Angeklagte St. zusammen mit anderen SS-Männern zu der Gaskammer in einem der umgebauten Bauernhäuser. Er überwachte dort das Hineingehen der Menschen, die glaubten, sie würden gebadet. Anschliessend wurden die Menschen in der bereits geschilderten Art und Weise durch Zyklon B getötet. Es waren mindestens einhundert Personen.
In allen Fällen meldete der Angeklagte St. über den Leiter der Politischen Abteilung die Anzahl der getöteten Menschen und die Anzahl der in das Lager aufgenommenen Personen, wobei er die oben erwähnten Tarnbezeichnungen benutzte.
Auch in diesem Falle wusste der Angeklagte St. dass die jüdischen Menschen unschuldig ohne Gerichtsurteil nur wegen ihrer Zugehörigkeit zur "jüdischen Rasse" getötet wurden.
5. Die Mitwirkung des Angeklagten St. bei weiteren Vergasungen von jüdischen Menschen im kleinen Krematorium im Mai und Juni 1942, die nicht angeklagt sind und die in dem Eröffnungsbeschluss dem Angeklagten St. nicht zur Last gelegt werden
Der Angeklagte St. hat noch an weiteren Vergasungen jüdischer Menschen im Mai und Juni 1942 teilgenommen. Diese Vergasungen fanden ebenfalls im kleinen Krematorium statt. Ein jüdisches Sonderkommando, dessen Kapo Fischel hiess, und das deswegen Fischelkommando genannt wurde, hatte die Leichen der getöteten Personen aus dem Vergasungsraum im kleinen Krematorium zu den Verbrennungsöfen zu schleppen und dort zu verbrennen. Zu dem sog. Fischelkommando gehörte auch der Zeuge Philipp Mü. Das Fischelkommando unterstand dem Angeklagten St. Wenn die Angehörigen dieses Sonderkommandos die Leichen der Opfer aus dem Vergasungsraum herauszogen und zu den Verbrennungsöfen brachten, trieb sie der Angeklagte St. jeweils bei ihrer schweren und schrecklichen Arbeit an und schlug dabei auf sie ein. Als der Zeuge Philipp Mü. das erste Mal bei einer solchen Verbrennung mitwirkte, brach Feuer in einem Raum aus. Das Häftlingssonderkommando musste das Feuer löschen. Dabei brachen drei jüdische Häftlinge körperlich zusammen. St. erschoss sie daher mit seiner Pistole. Die Leichen der Vergasten wurden dann, da die Öfen defekt waren, nachts auf ein Feld gefahren und dort von dem Zeugen Philipp Mü. und drei anderen jüdischen Häftlingen des Fischelkommandos in eine grosse Grube, die voll Wasser stand, geworfen. In der nächsten Nacht fuhr der Angeklagte St. mit diesen vier Häftlingen und drei weiteren französischen Juden, die zu dem Fischelkommando hinzugenommen worden waren, auf einem Feuerwehrauto wieder hinaus zu der Grube. Nun mussten die sieben Häftlinge die Leichen wieder aus dem Wasser herausholen und auf einem Haufen aufschichten. St. trieb sie dabei an wie Tiere. Durch die schwere Arbeit erschöpft, liessen bei zwei französischen Juden die körperlichen Kräfte nach. Sie ruhten deswegen einen Augenblick aus und stützten sich dabei auf den Leichenhaufen. St. schrie sie an: "Was ist los, ihr Moritze?" Dann zog er seine Pistole und erschoss die beiden.
Bei weiteren Vergasungen jüdischer Menschen im Mai 1942 nahm St. häufig vor den Vergasungen einige jüdische Frauen beiseite. Wenn dann die anderen jüdischen Menschen in den Gaskammern waren, stellte er die Frauen im Hof des kleinen Krematoriums an die Wand. Dann schoss er einer oder zwei Frauen in die Brust und in die Füsse. Wenn dann die anderen Frauen zitterten, auf die Knie fielen und den Angeklagten anflehten, sie am Leben zu lassen, schrie er sie an: "Sarah, Sarah, los, steh!" Dann erschoss er sie alle nacheinander. Einmal entdeckte der Angeklagte St. einen alten Juden, der sich unter den von den anderen jüdischen Menschen abgelegten Kleidern versteckt hatte. St. rief: "Ah, Israel!" Dann stellte er den Juden an die Wand. Hierauf schoss er ihm in einen Fuss. Der Jude fiel um. St. richtete ihn auf und schoss ihn dann in den zweiten Fuss. Da der Jude wieder umfiel und nicht mehr stehen konnte, stellte St. einen Koffer an die Wand und setzte den Juden darauf. Dann erschoss er ihn.
An wieviel Vergasungen der Angeklagte St. im Mai 1942 teilgenommen hat und wieviel Menschen dabei getötet worden sind, konnte nicht festgestellt werden.
III. Einlassung des Angeklagten St., Beweismittel und Beweiswürdigung
1.
Die Feststellungen zum Lebenslauf des Angeklagten St. beruhen auf den Angaben des Angeklagten St.
2. Zu II.1. a. und b.
Der Angeklagte St. hat in der Hauptverhandlung zugegeben, dass er die beiden Personengruppen, die aus je 20 Personen bestanden hätten, zum Erschiessen in das kleine Krematorium geführt und ihnen dabei auf ihre Frage erklärt habe, dass sie gebadet würden. Er hat ferner eingeräumt, dass die Erschiessungen dann in der geschilderten Art und Weise im kleinen Krematorium durchgeführt worden seien. Allerdings hat er behauptet, dass die Erschiessungen auf Grund von Standgerichtsurteilen erfolgt seien. Grabner habe ihm gesagt, dass die Personen durch ein Standgericht zum Tode verurteilt worden seien.
Diese Behauptung hat das Gericht dem Angeklagten St. nicht geglaubt. Sie ist von ihm erstmalig in der Hauptverhandlung vorgebracht worden. Bei seiner polizeilichen Vernehmung durch Kriminalobermeister Ae. im Ermittlungsverfahren hat der Angeklagte St. angegeben, dass es sich bei den beiden Personengruppen um Juden aus der Nähe von Kattowitz gehandelt habe. Er hat ferner eindeutig ausgesagt, dass unter diesen Personen auch Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren gewesen seien. Davon, dass die Juden durch ein Standgericht zum Tode verurteilt gewesen seien, hat er nichts erwähnt.
Die Feststellung über diese frühere Aussage des Angeklagten St. hat das Schwurgericht auf Grund der Vernehmungen des Zeugen Ae. getroffen. Der Zeuge konnte sich noch gut an die Vernehmung des Angeklagten St. erinnern. Er gab glaubhaft an, dass der Angeklagte St. von sich aus die damaligen Geschehnisse geschildert habe. Grosse Teile des über die Vernehmung aufgesetzten Protokolls habe er sogar selbst formuliert. Der Zeuge konnte sich allerdings nicht mehr an alle Einzelheiten der Aussage des Angeklagten St. erinnern. Ihm wurden daher zur Stützung seines Gedächtnisses die Teile des Protokolls vorgelesen, die die oben erwähnten Angaben St's enthalten. Der Zeuge hat daraufhin bestätigt, dass das, was in dem Protokoll stehe, genau dem entspreche, was der Angeklagte St. damals von sich aus ihm gegenüber ausgesagt habe. Auch der Angeklagte St. hat nach der Vernehmung des Zeugen Ae. eingeräumt, dass damals alles richtig in das Protokoll aufgenommen worden sei, was er ausgesagt habe. Damit bestehen keine Zweifel, dass der Angeklagte St. bei seiner polizeilichen Vernehmung tatsächlich die oben wiedergegebenen Angaben gemacht hat.
Das Gericht ist überzeugt, dass die damaligen Angaben St's gegenüber dem Zeugen Ae. richtig waren und der Wahrheit entsprachen und dass seine jetzige Einlassung nur eine Schutzbehauptung ist. Für St. kam damals die Verhaftung und Vernehmung überraschend. Er hatte keine Zeit, sich Ausreden und Schutzbehauptungen zu überlegen. Er hat vielmehr aus sich heraus frei alles so geschildert, wie er es in seiner Erinnerung hatte.
Nach der Überzeugung des Gerichts hat der Angeklagte St. erst nachträglich in der Untersuchungshaft und in der langen Zeit bis zum Beginn der Hauptverhandlung Überlegungen angestellt, wie er seine Position verbessern könne. Dabei ist er auf die Idee gekommen, sich auf das Vorliegen von Standgerichtsurteilen zu berufen.
Dafür, dass die beiden Personengruppen ohne Standgerichtsurteil erschossen worden sind, spricht eindeutig - abgesehen davon, dass St. früher nichts von Standgerichtsurteilen erwähnt hat -, dass die Erschiessungen heimlich und unter Täuschung der Opfer durchgeführt worden sind. Wären die Opfer durch ein Gericht zum Tode verurteilt gewesen, hätte es dieser Täuschung nicht bedurft. Denn dann hätten sie auf Grund des ihnen verkündeten Urteils gewusst, dass ihnen der Tod bzw. die Erschiessung bevorstehe. Auch die Tatsache, dass zu den beiden Personengruppen kleine Kinder gehörten, spricht dagegen, dass sie durch ein Standgericht zum Tode verurteilt worden sind. Ferner weist der Umstand, dass St. den Vollzug der Erschiessung unter Verwendung der Tarnbezeichnung "gesondert untergebracht" an das RSHA gemeldet hat, darauf hin, dass es sich um die Erschiessung von Juden im Rahmen der "Endlösung der Judenfrage" gehandelt hat. Diese Tarnung wäre nicht erforderlich gewesen, wenn es sich um normale Exekutionen auf Grund von Standgerichtsurteilen gehandelt hätte. Gestützt wird diese Überzeugung schliesslich noch durch die Aufzeichnungen des früheren Lagerkommandanten Höss, wonach im Rahmen "der Endlösung der Judenfrage" zuerst Ostoberschlesien von Juden geräumt worden ist, die nach Auschwitz verbracht und dort ohne Selektionen getötet worden sind.
Dem Angeklagten St. war nach der Überzeugung des Gerichts all dies auch bekannt. Denn die Tatsachen, dass die Opfer nur Juden waren, dass zu ihnen auch kleine Kinder gehörten, dass die Opfer über ihr bevorstehendes Schicksal getäuscht wurden und dass schliesslich der Angeklagte St. den Vollzug der Erschiessungen unter Tarnbezeichnungen melden musste, konnten in ihm gar nicht den Gedanken aufkommen lassen, dass es sich um Exekutionen auf Grund von Standgerichtsurteilen wegen irgendwelcher Vergehen oder Verbrechen gehandelt hat. Im übrigen wurde ihm - ebenso wie allen anderen SS-Angehörigen - immer wieder eingehämmert, dass die Juden als Angehörige der "minderwertigen jüdischen Rasse" vernichtet werden müssten.
3. Zu II.2.
Der Angeklagte St. bestreitet, die Frau und die beiden Kinder im kleinen Krematorium eigenhändig erschossen zu haben. Im übrigen hat er zu diesem Fall nicht näher Stellung genommen. Das Gericht sieht den Angeklagten St. auf Grund der glaubhaften Aussage des Zeugen Sm. als überführt an, die Frau und die beiden Kinder zur Erschiessung in das kleine Krematorium geführt zu haben und dort zumindest bei ihrer Erschiessung durch einen anderen SS-Angehörigen, dem er das Kleinkalibergewehr übergeben hatte, dabeigewesen zu sein. Der Zeuge Sm., der Jurist und Direktor des Museums in Auschwitz ist und einen glaubwürdigen Eindruck hinterlassen hat, war bei der Aufnahmeabteilung der Politischen Abteilung als Schreiber beschäftigt. Er kannte den Angeklagten St. daher sehr gut. St. unterhielt sich öfters mit ihm, da beide etwa im gleichen Alter waren und die höhere Schule besucht hatten. Eine Verwechslung scheidet somit aus.
Der Zeuge Sm. hat glaubhaft geschildert, dass der Angeklagte St. die Frau und die beiden Kinder zur Aufnahmeabteilung der Politischen Abteilung gebracht und dann den Karabiner aus der Blockführerstube geholt habe. Der Zeuge hat dann weiter gesehen, dass St. mit den dreien allein in das kleine Krematorium gegangen ist. Von seinem Zimmer aus konnte der Zeuge den Weg bis zum kleinen Krematorium überblicken und auch den Eingang zu diesem überwachen. Der Zeuge hat dann weiter gesehen, dass St. wieder allein aus dem kleinen Krematorium herausgekommen ist. Die Frau und die beiden Kinder hat er nicht mehr aus dem Krematorium herauskommen sehen. Aus all diesen Umständen und dem danach gezeigten Verhalten des Angeklagten St. hat das Gericht die Überzeugung gewonnen, dass der Angeklagte St. die drei Personen in das kleine Krematorium zum Zwecke der Erschiessung geführt und, da nicht mit Sicherheit festzustellen war, dass er sie selbst erschossen hat, einem anderen SS-Angehörigen zur Erschiessung übergeben hat und bei der Erschiessung auch selbst dabeigewesen ist.
Allerdings konnten Einzelheiten über diese Erschiessung nicht festgestellt werden, da kein Augenzeuge der Erschiessung vorhanden ist.
4. Zu II.3.
Der Angeklagte St. hat eingeräumt, dass er bei der Vergasung von mindestens zweihundert Personen in der geschilderten Weise mitgewirkt hat. Allerdings hat er behauptet, dass unter diesen Personen keine Kinder gewesen seien. Es habe sich vielmehr nur um erwachsene Polen und Juden gehandelt. Ihre Tötung sei ebenfalls auf Grund von Standgerichtsurteilen erfolgt. Zu dem Einwerfen des Zyklon B sei er zunächst von Grabner befohlen worden. Er habe jedoch gezögert, den Befehl auszuführen. Daraufhin habe ihm der Schutzhaftlagerführer befohlen, er solle schnell machen. Als er dann immer noch gezögert habe, habe ihm der Kommandant Höss gedroht, wenn er nicht hinaufgehe und das Gas einwerfe, werde er selbst mit in den Vergasungsraum hineingesteckt. Erst auf Grund dieser Drohung, die er für ernstlich gehalten habe, sei er auf das Dach des kleinen Krematoriums gestiegen und habe das Zyklon B zusammen mit dem anderen SS-Mann in die Einfüllöcher geschüttet. Er habe nicht das Gefühl gehabt, dass Unrecht geschehe, da die Leute durch ein Standgerichtsurteil zum Tode verurteilt gewesen seien. Ihm sei nur die Art der Vollstreckung der Todesstrafe als feige und unmännlich erschienen. Auch diese Einlassung hat das Schwurgericht dem Angeklagten St. nicht abgenommen. Er hat sie erstmalig in der Hauptverhandlung vorgebracht. Bei seiner Vernehmung durch den Zeugen Ae. hat der Angeklagte St. diese Darstellung nicht gegeben. Er hat vielmehr ausgesagt, dass es sich bei diesem Transport um Juden gehandelt habe, unter denen auch Kinder gewesen seien. Davon, dass auch Polen unter den Opfern gewesen seien, und dass Standgerichtsurteile gegen sie vorgelegen hätten, hat er nichts erwähnt. Auch hat er sich nicht auf eine Drohung des Lagerkommandanten Höss berufen. St. hat ferner gegenüber dem Zeugen Ae. angegeben, dass bereits vor dieser Vergasung (bei der er das Zyklon B selbst eingeworfen hat) eine Vergasung von Juden in der unter II. geschilderten Weise stattgefunden habe, vor der er von Grabner zur besonderen Geheimhaltung und strengstem Stillschweigen verpflichtet worden sei. Der Zeuge Ae., der - wie schon ausgeführt - über diese polizeiliche Vernehmung des Angeklagten St. vernommen worden ist, konnte sich noch gut erinnern, dass St. nicht gesagt hat, er sei zu dem Einwerfen des Gases gezwungen worden. Vielmehr habe St. nur - so hat der Zeuge glaubhaft angegeben - erklärt, er habe das Zyklon B auf Befehl Grabners eingeworfen.
Dem Zeugen Ae. wurden - da er sich nicht mehr an alle Einzelheiten der Vernehmung des Angeklagten St. erinnern konnte - auch die Teile des polizeilichen Protokolls zur Stützung seines Gedächtnisses vorgelesen, in dem die Schilderung dieser Vergasung als Aussage des Angeklagten St. protokolliert ist. Der Zeuge hat bestätigt, dass St. genau so ausgesagt hat, wie es im Protokoll steht. Auch St. hat dies nach der Vernehmung des Zeugen Ae. bestätigt.
Somit steht nach der Überzeugung des Gerichts fest, dass St. gegenüber dem Zeugen Ae. tatsächlich nur von einem Judentransport, zu dem auch Kinder gehört haben, gesprochen hat und nichts von Standgerichtsurteilen oder einer Drohung durch den Lagerkommandanten Höss erwähnt hat. Auch in diesem Fall ist das Schwurgericht überzeugt, dass St's Angaben bei seiner polizeilichen Vernehmung der Wahrheit entsprachen und dass die von dieser Darstellung abweichenden Angaben St's in der Hauptverhandlung nur als Schutzbehauptung vorgebracht worden sind.
Wäre St. tatsächlich von Höss zum Einwerfen des Zyklon B gezwungen worden, so wäre kein Grund ersichtlich, warum er diese für seine Entlastung wichtige Tatsache verschwiegen haben sollte. Im übrigen hat St. als eifriger SS-Unterführer Befehle stets prompt ausgeführt. In anderen Fällen hat er nie gezögert, bei der Tötung von Menschen mitzuwirken. Das räumt er auch selbst ein. Auf die Frage, warum er ausgerechnet in diesem Fall gezögert habe, einen Befehl auszuführen, hat er geantwortet, er sei für das Einwerfen des Zyklon "nicht zuständig" gewesen. Diese Antwort konnte das Gericht nicht überzeugen. Sie ist offensichtlich die Ausrede eines in die Enge getriebenen und der Unwahrheit überführten Angeklagten.
Damit steht fest, dass die Opfer nur Juden waren, unter denen sich auch eine gewisse, nicht näher festzustellende Anzahl von Kindern befunden hat. Nach der Überzeugung des Gerichts waren es Juden, die im Rahmen "der Endlösung der Judenfrage" auf Befehl Hitlers und seiner Komplizen aus Ostoberschlesien nach Auschwitz deportiert worden sind, damit sie dort getötet würden. Diese Überzeugung stützt sich darauf, dass
1. der Transport nur aus jüdischen Menschen bestand, zu denen auch Kinder gehörten,
2. dass St. vorher durch Grabner - wie er früher bei seiner polizeilichen Vernehmung gegenüber dem Zeugen Ae. angegeben hat - zu strengster Geheimhaltung verpflichtet worden ist, sogar eine entsprechende schriftliche Erklärung unterschreiben musste,
3. dass der Lagerkommandant Höss, der im KL Auschwitz verantwortlich für die sog. Judenaktionen im Rahmen der Endlösung der Judenfrage war, persönlich bei der Vergasung anwesend war,
4. dass nach den Aufzeichnungen des Lagerkommandanten Höss zuerst aus Ostoberschlesien jüdische Transporte im Rahmen "der Endlösung der Judenfrage" nach Auschwitz gebracht worden sind und dort zunächst ohne Selektionen im kleinen Krematorium vergast worden sind,
5. dass der Angeklagte St. nach Durchführung der Aktionen an das RSHA melden musste, dass die betreffenden Personen "gesondert untergebracht" worden sind.
Daraus ergibt sich gleichzeitig, wovon das Gericht an sich schon auf Grund der Angaben des Angeklagten St. gegenüber dem Zeugen Ae. überzeugt war, dass gegen diese mindestens hundert Personen kein Standgerichtsurteil vorgelegen haben kann.
5. Zu II.4.
Der Angeklagte St. hat eingeräumt, dass er von Grabner über die Ankunft von RSHA-Transporten verständigt worden sei und dass er sich daraufhin zur Rampe begeben habe. Dort habe er jedoch nur - so hat er sich eingelassen - die als arbeitsfähig ausgesonderten Menschen gesondert aufgestellt, gezählt und dann in die Aufnahmebaracke der Politischen Abteilung geführt, um dort die Aufnahmeformalitäten zu erledigen. Zu den Gaskammern habe er die jüdischen Menschen nie begleitet. Es sei allerdings ab und zu vorgekommen, dass die Zahlen nicht gestimmt hätten. Dann hätte er sich an die SS-Männer an den Vergasungsräumen gewendet, die die Menschen dort vor ihrer Tötung gezählt hätten. Wenn er hin und wieder an den Vergasungsräumen gewesen sei, dann nur aus diesem Grunde.
Auch diese Einlassung des Angeklagten St. steht in Widerspruch zu den Angaben, die er bei seiner polizeilichen Vernehmung durch den Zeugen Ae. gemacht hat. Damals hat der Angeklagte St., was der Zeuge Ae. glaubhaft bestätigt hat, eindeutig und präzise angegeben, dass er auch die für den Tod bestimmten jüdischen Menschen zu den Gaskammern begleitet habe, wobei er seine Dienstpistole getragen habe. Der Angeklagte St. war auch dabei, wenn die Menschen in die Gaskammern hineingeführt wurden.
Denn er hat gegenüber dem Zeugen Ae. erklärt, dass dabei gelegentlich Stockungen entstanden seien, so dass die vorderen Menschen von den hinterhergehenden Personen hineingeschoben worden seien.
Das Gericht ist überzeugt, dass der Angeklagte St. auch in diesem Punkte damals die Wahrheit gesagt hat, und dass seine Einlassung in der Hauptverhandlung unglaubhaft ist. Es ist kein Grund ersichtlich, warum sich der Angeklagte St. damals zu Unrecht belastet und Dinge geschildert haben sollte, die dem Zeugen Ae. noch gar nicht bekannt waren.
Damit steht fest, dass der Angeklagte St. nicht nur die jüdischen Menschen zur Gaskammer begleitet, sondern dort auch das Einrücken der Menschen in die Gaskammer überwacht hat.
Über die von dem Angeklagten St. zugegebene Tätigkeit hinaus hat auch der Zeuge Ho., der als SS-Mann ebenfalls in der Aufnahmeabteilung der Politischen Abteilung tätig war und dessen Vorgesetzter der Angeklagte St. war, bekundet, dass St. die Gesamtstärke der Transporte häufig selbst festgestellt hat, indem er zusammen mit ihm alle angekommenen Menschen (also nicht nur die arbeitsfähigen) gezählt habe. Ho., der seine Aussage sehr zurückhaltend gemacht hat und den Angeklagten St. offensichtlich schonen wollte, hat diese Angaben allerdings erst gemacht, als ihm entsprechende Vorhalte aus seiner früheren Vernehmung gemacht worden sind. Seine Aussage erscheint daher insoweit glaubhaft, zumal die Übernahme der Transporte zu dem Aufgabengebiet des Angeklagten St. gehört hat.
Der Zeuge Sm. hat auch glaubhaft bestätigt, dass St. häufig Transportzettel von der Rampe in die Aufnahmeabteilung der Politischen Abteilung gebracht habe.
Wie oft der Angeklagte St. jüdische Menschen zu den Gaskammern begleitet hat, konnte nicht festgestellt werden. Es konnte daher nur von einer unbestimmten Anzahl von Fällen ausgegangen werden. Das Gericht hat sich darauf beschränkt, da sich unsichere Schätzungen verboten, dem Urteil mindestens einen Fall zugrunde zu legen. Die Anzahl der bei diesem Transport getöteten Menschen war ebenfalls nicht sicher festzustellen. Um jede mögliche Unsicherheit auszuschliessen, ist das Gericht von der geringen Mindestzahl von einhundert Menschen ausgegangen, die bei dem Transport auf jeden Fall getötet worden sind. Denn damals kamen mit Transporten durchschnittlich 1000 Personen an, von denen höchstens 25%, also 250 Menschen in das Lager aufgenommen worden sind.
6. Zu II.5.
Die Feststellungen unter II.5. beruhen auf der glaubhaften Aussage des Zeugen Philipp Mü. Der Angeklagte St. bestreitet, sich in der vom Zeugen Mü. geschilderten Art und Weise betätigt zu haben. Das Schwurgericht ist jedoch überzeugt, dass die vom Zeugen Philipp Mü. geschilderten Vorfälle glaubhaft sind und der Wahrheit entsprechen. Die Verteidigung des Angeklagten St. hat Bedenken gegen die Glaubwürdigkeit des Zeugen vorgebracht. Mü. habe sich - so wurde behauptet - in erhebliche Widersprüche zu seiner früheren Aussage verwickelt. Er habe offenbar diese konkreten Belastungen St's erfunden, weil bis dahin in der Hauptverhandlung noch keine gravierenden Belastungen St's erkennbar geworden seien. Schliesslich sei in der Darstellung des Zeugen eine Reihe von Unwahrscheinlichkeiten, die seine Schilderungen nicht als glaubhaft erscheinen lassen könnten.
Das Schwurgericht konnte jedoch keine ins Gewicht fallenden Widersprüche zwischen der Aussage des Zeugen in der Hauptverhandlung und seinen früheren Bekundungen feststellen. Kleine Abweichungen zwischen beiden Aussagen sind für die Glaubwürdigkeit des Zeugen unbedeutend. So hat er früher angegeben, er sei an einem Sonntag zum Fischelkommando gekommen, während er in der Hauptverhandlung erklärt hat, es sei an einem Samstag gewesen. Früher hat er angegeben, bei seiner ersten Tätigkeit im kleinen Krematorium, als das Feuer ausgebrochen sei, habe St. vier Häftlinge des Kommandos erschossen, während er in der Hauptverhandlung bekundet hat, es seien drei gewesen. Zwar ist es objektiv von erheblicher Bedeutung, ob jemand drei oder vier Menschen erschossen hat. Unter normalen Umständen wird ein Zeuge, der die Erschiessung mehrerer Menschen miterlebt, danach auch genau angeben können, wieviel es gewesen sind. Hier ist aber zu berücksichtigen, dass für den Zeugen Philipp Mü. die Erschiessungen durch den Angeklagten St. unter für ihn fürchterlichen Umständen geschehen sind, dass er damals selbst in ständiger Todesgefahr schwebte, dass er danach noch weitere schreckliche Erlebnisse gehabt hat und dass schon über zwanzig Jahre seit diesen Erlebnissen vergangen sind. Unter diesen Umständen erscheint es verständlich, dass der Zeuge nicht mehr so sicher ist, ob damals drei oder vier Häftlinge von St. erschossen worden sind. Diese Abweichungen zwischen der Aussage des Zeugen in der Hauptverhandlung und seiner früheren Aussage ist daher nicht so bedeutend, dass dadurch die Glaubwürdigkeit des Zeugen in Frage gestellt wäre. Früher hat der Zeuge angegeben, sie seien mit den Leichen der vergasten Menschen auf einem Auto nachts durch die Stadt Auschwitz bis zu einer Sumpfgrube gefahren, während er in der Hauptverhandlung bekundet hat, sie seien mit dem Feuerwehrauto auf ein Feld gefahren, wo sie die Leichen in eine Wassergrube geworfen hätten. Auch das sind nur unerhebliche Unterschiede.
Das Argument, Mü. habe den Angeklagten St. belasten müssen, weil bis dahin noch keine schweren Belastungen gegen den Angeklagten St. in der Hauptverhandlung vorgebracht gewesen seien, greift ebenfalls nicht durch. Als der Zeuge Mü. das erste Mal in der Tschechoslowakei vernommen worden ist, nämlich am 2.12.1963, hatte die Hauptverhandlung überhaupt noch nicht begonnen. Mü. konnte also damals noch gar nicht wissen, ob St. von anderen Zeugen belastet werden würde oder nicht. Gleichwohl hat er bereits bei dieser Vernehmung im wesentlichen die gleichen Dinge geschildert wie in der Hauptverhandlung.
Das Schwurgericht hat auch nicht den Eindruck gehabt, dass Mü. die Erlebnisse nur erfunden hat, um St. wahrheitswidrig zu belasten. Mü. stand bei seiner Vernehmung ersichtlich unter dem Eindruck schwerster persönlicher Erlebnisse. Die Art, wie er seine Aussage gemacht hat, lässt es als unwahrscheinlich erscheinen, dass seine Angaben nur das Produkt seiner Phantasie gewesen sein sollen. In eindrucksvoller Weise hat er sogar die Stimme und den Befehlston St's nachgemacht.
Die Bedenken gegen die Glaubwürdigkeit des Zeugen Philipp Mü. wurden auch darauf gestützt, dass Mü., als er das erste Mal von St. in das kleine Krematorium hineingeführt worden sei, siebenhundert angezogene Leichen und weitere hundert Leichen russischer Kriegsgefangener in Uniform in dem Vergasungsraum gesehen haben will und dass er zusammen mit den anderen Häftlingen diese Leichen habe ausziehen müssen. Ferner hätten nach seiner Schilderung zerstörte Koffer in dem Raum herumgelegen, was ebenfalls unwahrscheinlich sei. Dagegen hätten sich später nach der Aussage Mü's die jüdischen Menschen vor den Vergasungen jeweils im Hof des kleinen Krematoriums ausziehen und die Sachen in dem Hof liegen lassen müssen.
Es wurde auch für unwahrscheinlich gehalten, dass in etwa sechs Wochen - wie der Zeuge Mü. es angegeben hat - zehn- bis elftausend Menschen im kleinen Krematorium vergast worden sein könnten.
Diese Bedenken greifen jedoch nicht durch. Mü. konnte die Opfer nicht zählen. Dazu blieb ihm keine Zeit. Er hat sich auch keine Aufzeichnungen über die Anzahl der Vergasungen machen können. Für ihn ist es daher unmöglich, exakte Zahlen angeben zu können. Sein Gedächtnis kann nur festgehalten haben, dass eine grosse Anzahl von Menschen in der fraglichen Zeit getötet worden ist. Seine Zahlenangaben beruhen nur auf Schätzungen. Es mag sein, dass die schrecklichen Erlebnisse im kleinen Krematorium, die durch die weiteren Erlebnisse bei den Krematorien I bis IV, in denen Hunderttausende von Menschen getötet wurden, überlagert worden sind, Mü. verleitet haben, die Zahl der Opfer im kleinen Krematorium viel zu hoch zu schätzen. Der Kern seiner Aussage, dass eine Vielzahl von jüdischen Menschen durch Gas in dem kleinen Krematorium getötet worden ist, wird dadurch nicht in Frage gestellt.
Wenn es auch auf den ersten Blick unwahrscheinlich erscheint, dass Menschen in Kleidung vergast worden sind, weil nach der Schilderung Mü's später die Menschen sich stets im Hof ausziehen mussten, und die SS das grösste Interesse daran hatte, die Kleidung aus wirtschaftlichen Gründen zu behalten, ist es doch nicht unmöglich. Auch bei der ersten Vergasung im Block 11, auf die noch zurückzukommen sein wird, wurden die Menschen in Kleidung vergast. Es ist immerhin denkbar, dass aus besonderen Gründen in diesem Fall die Menschen sofort in ihrer Kleidung und mit ihren Koffern in die Gaskammer geführt worden sind.
Möglicherweise ist von der SS aus zeitlichen Gründen in diesem einen Fall von den sonstigen Gepflogenheiten abgewichen worden. Es spricht sogar für die Glaubwürdigkeit Mü's, dass er die auf den ersten Blick unwahrscheinlich erscheinenden Dinge so geschildert hat, wie er sie in seinem Gedächtnis bewahrt hat.
Da nach seiner Darstellung in allen späteren Fällen die Opfer sich stets im Hof des kleinen Krematoriums entkleiden mussten, hätte es für ihn naheliegen müssen anzugeben, dass auch in dem Fall, den er als erstes persönliches Erlebnis im kleinen Krematorium geschildert hat, die Opfer nackt getötet worden sind, wenn alles nur seiner Phantasie entsprungen wäre. Soweit die Zahl der Opfer, die er bei seinem ersten Eintreffen im kleinen Krematorium gesehen hat, zu hoch erscheint, gilt das oben bereits Gesagte. Mü. hat die Leichen nicht gezählt. Seine Zahlenangabe beruht nur auf einer Schätzung. Möglicherweise hat er auf Grund des furchtbaren Anblicks, der sich ihm beim ersten Mal bot, die Zahl der Opfer zu hoch geschätzt. Daraus kann jedoch nicht gefolgert werden, dass der Zeuge Mü. insgesamt unglaubwürdig sei.
Das Schwurgericht ist daher überzeugt, dass der Kern seiner Aussage, auf dem die obigen Feststellungen beruhen, der Wahrheit entspricht.
IV. Rechtliche Würdigung
1. Zu II.1., 3., 4.
Die unter Ziffer II.1.a. und b., 3. und 4. geschilderten Tötungen jüdischer Menschen erfüllen den Tatbestand des §211 StGB neuer Fassung. Die Juden wurden auf Grund des Ausrottungsbefehls Hitlers getötet. Ihre Tötung erfolgte daher - wie oben schon ausgeführt - aus niedrigen Beweggründen. Die jüdischen Menschen wurden auch in allen geschilderten Fällen heimtückisch getötet. Wie sich aus den tatsächlichen Feststellungen unter II.1., 3. und 4. ergibt, bestärkte man die Arglosigkeit der ahnungslosen und wehrlosen Menschen durch bewusste Täuschungsmanöver und nutzte dann diese Arg- und Wehrlosigkeit bei den Erschiessungsaktionen in den Fällen II.1. a. und b. und bei den Tötungen durch Gas in den Fällen II.3. und 4. aus. Schliesslich waren die Tötungen in den Gaskammern auch grausam, wie oben unter A.V.1. schon dargelegt worden ist. Auch wegen der Rechtswidrigkeit dieser Tötungen kann auf diese Ausführung Bezug genommen werden.
Haupttäter dieser Morde waren Hitler und seine Komplizen. Der Angeklagte St. hat die unter II.1., 3. und 4. geschilderten Tötungen jeweils durch eigene Handlungen gefördert, somit einen kausalen Tatbeitrag hierzu geleistet. Das ergibt sich klar aus dem Sachverhalt. Er hat bei den Tötungen auf Befehl mitgewirkt. Seine Beteiligung muss daher im Rahmen des §47 MStGB strafrechtlich beurteilt werden.
St. hat klar erkannt, dass die befohlenen Tötungen ein allgemeines Verbrechen waren und die ihm gegebenen Befehle, dabei mitzuhelfen, ein allgemeines Verbrechen bezweckten. Er will zwar - wie er in der Hauptverhandlung behauptet hat - geglaubt haben, die Tötungen seien rechtmässig. Dabei hat er sich aber nicht etwa darauf berufen, dass er sie deswegen für rechtmässig gehalten habe, weil sie von der höchsten Staatsführung befohlen worden seien. Vielmehr hat er seinen irrigen Glauben an die Rechtmässigkeit der Tötungen mit der Behauptung zu begründen versucht, dass sie auf Grund von Standgerichtsurteilen erfolgt seien. Diese Behauptung ist jedoch - wie oben ausgeführt - widerlegt. Damit entfällt St's einziges Argument für seinen angeblichen irrigen Glauben an die Rechtmässigkeit der Tötungen.
Seine Einlassung steht auch im Widerspruch zu seinen Angaben, die er gegenüber dem Zeugen Ae. bei seiner polizeilichen Vernehmung gemacht hat. Damals hat er - wie der Zeuge Ae. glaubhaft bestätigt hat - erklärt, "er habe wohl gefühlt, dass die Befehle, die jüdischen Menschen zu töten, ein Unrecht gewesen sei". Daraus ergibt sich bereits, dass er, da er nach der Überzeugung des Gerichts bei seiner polizeilichen Vernehmung seine damalige innere Einstellung richtig wiedergegeben hat, das Unrechtmässige der Tötungen erkannt hat. Darüber hinaus ist - wie bereits oben unter A.V. ausgeführt worden ist - die Tötung schuldloser Menschen, insbesondere von Kindern, ein so krasser Verstoss gegen die auch dem primitivsten Menschen bewussten Grundsätze vom Recht eines jeden Menschen auf sein Leben, dass auch der Angeklagte St., ebenso wie alle anderen SS-Angehörigen in Auschwitz, keine Zweifel an der Rechtswidrigkeit der befohlenen Tötungen haben konnte und nach der Überzeugung des Gerichts auch nicht gehabt hat. Auch die Begleitumstände, unter denen die Opfer getötet wurden (strengste Geheimhaltung, Täuschung der Opfer, Meldung der Tötungen durch Tarnbezeichnungen) und die dem Angeklagten St. alle bekannt waren, mussten ihm die Gewissheit aufdrängen, dass hier Unrecht geschah. Schliesslich war der Angeklagte St. etwa im gleichen Alter wie der Angeklagte Baretzki. Dieser hat freimütig eingeräumt, dass er erkannt hat, dass die Tötung der Juden Unrecht sei. Für St., der wesentlich intelligenter als der Angeklagte Baretzki ist und bis zu seinem 16. Lebensjahr die höhere Schule besucht hat und in geordneten Familienverhältnissen aufgewachsen ist, können daher ebenfalls keine Zweifel an der Unrechtmässigkeit der Tötungen bestanden haben.
Bei der Frage, ob der Angeklagte St. die Tötungen als eigene Taten gewollt, also als Mittäter gehandelt hat oder ob er nur als Gehilfe die Taten der Haupttäter unterstützen wollte, war folgendes in Betracht zu ziehen: Der Angeklagte St. ist bereits im Alter von 16 Jahren und 5 Monaten zur 2. SS-Totenkopfstandarte eingezogen worden. Während seiner Ausbildungszeit wurde er in der nationalsozialistischen Weltanschauung ständig intensiv geschult. Besonderer Wert wurde dabei auf Rassenkunde gelegt. Im Sinne Eickes, dem damaligen Inspektor der KL und Kommandeur der SS-Totenkopfverbände, wurde er zur Härte und zum Hass gegen die sog. Staatsfeinde und zu unbedingtem Gehorsam gegenüber seinen SS-Vorgesetzten erzogen. Bei St. fiel diese Schulung und Erziehung auf fruchtbaren Boden. Er wurde überzeugter Nationalsozialist.
Dies ergibt sich zunächst daraus, dass er trotz seiner Jugend schon vor Ausbruch des Krieges Verwendung im KZ-Dienst fand und schliesslich im Jahre 1940 als geeignet für den Einsatz im KZ Auschwitz angesehen wurde. Trotz seiner Jugend wurde er auch relativ schnell befördert. Bereits mit 18 Jahren wurde er nach weniger als zweijähriger Dienstzeit zum Rottenführer befördert und als Gruppenführer eingesetzt. Mit 19 Jahren wurde er zum SS-Unterscharführer befördert. Dies alles spricht dafür, dass er schon damals innerlich mit der nationalsozialistischen Weltanschauung übereinstimmte und sich als guter Nationalsozialist und SS-Mann im Sinne der Forderungen Eickes bewährt haben muss. Diese Übereinstimmung des Angeklagten St. mit den Zielen des Nationalsozialismus und der SS-Führung, insbesondere mit der von diesen bewusst geförderten feindlichen Einstellung gegenüber sog. Staatsfeinden, wozu in erster Linie die Juden zählten, zeigte sich dann auch bei dem Angeklagten St. im KL Auschwitz.
Der Pädagoge Kx., 69 Jahre alt und von Beruf Gymnasiallehrer, hatte im KL Auschwitz Gelegenheit, den Angeklagten St. zu beobachten. Er war als Häftling in der Aufnahmeabteilung der Politischen Abteilung eingesetzt und kam somit in nähere Berührung mit ihm. Der Zeuge, der einen ausgezeichneten Eindruck auf das Schwurgericht gemacht hat und mit grosser Ruhe und einem tiefen Verständnis für menschliche Schwächen und aus einer gewissen weisen Abgeklärtheit heraus über die damaligen Geschehnisse sprach, hat geschildert, dass er zunächst nach dem äusseren Aussehen des Angeklagten St. und dem ersten Eindruck geglaubt habe, dieser sei ein anständiger Mensch und sympathischer SS-Mann. Darüber sei er froh gewesen. St. habe ihn dann aber bitter enttäuscht. Als die russischen Kriegsgefangenen in das Lager aufgenommen worden seien, habe St. die Kriegsgefangenen oft fürchterlich mit der Peitsche geschlagen. Das sei für ihn - den Zeugen - schrecklich gewesen. Von anderen Häftlingen habe er erfahren, dass dieses Schlagen jedoch noch nicht das Schlimmste sei. Allerdings habe er selbst nicht gesehen, dass St. russische Kriegsgefangene getötet habe. Häftlingen gegenüber habe St. erklärt: "Mitleid heisst Schwäche!" Dieses Verhalten des Angeklagten St. gegenüber den russischen Kriegsgefangenen, das ihm nicht befohlen war, sondern aus eigenen Antrieben erfolgte, zeigte, dass er sich die Grundsätze Eickes über die Behandlung sog. Staatsfeinde zu eigen gemacht und zu seinem eigenen Prinzip erhoben hatte. Auch der zitierte Ausspruch des Angeklagten St. offenbart diese innere Einstellung.
Ein Kollege des Zeugen Kx., ein Professor, der als Häftling im KL Auschwitz war und dem Angeklagten St. Unterricht für die Vorbereitung auf das Abitur erteilt hat, vertrat bereits damals die Auffassung, dass St's Verhalten nur aus seiner nationalsozialistischen Einstellung heraus zu verstehen sei. Der Zeuge Kx., der sich als Pädagoge für St. interessierte, unterhielt sich wiederholt mit diesem Professor über St. Beide fragten sich, wie das Verhalten St's zu erklären sei. Der Professor meinte, dass St. zwar im Kern anständig sei, aber unter dem unheilvollen Einfluss der NS-Ideologie stehe, die er sich zu eigen gemacht habe.
Dass der Angeklagte St. sich ganz mit der Einstellung der NS-Machthaber und der SS-Führung gegenüber sog. Staatsfeinden identifiziert hat, zeigte sich auch in seinem sonstigen Verhalten gegenüber den Häftlingen im KL Auschwitz. Der Zeuge Lei., der zusammen mit dem Angeklagten St. eine Zeitlang als Blockführer eingesetzt war, hat glaubhaft geschildert, dass der Angeklagte St. besonders hart gegen die Häftlinge gewesen sei. Er habe sie mit kreischender, furchterregender Stimme angeschrien. Die Häftlinge hätten alle Angst vor ihm gehabt. St. habe sie sogar mit Füssen getreten. Ein besonders krasser Fall, der Aufschluss über die innere Einstellung St's gegenüber Häftlingen, insbesondere Juden gibt, hat die Zeugin Kraf. geschildert. Eine Jüdin mit dem Vornamen Flora, eine ältere, bescheidene und ängstliche Frau, meldete sich eines Tages in der Aufnahmeabteilung der Politischen Abteilung zur Registrierung. St. fragte sie, wie sie heisse. Als die Jüdin ihren Namen leise nannte, brüllte St. sie an, sie solle lauter sprechen. Als die Jüdin noch immer - nach der Auffassung St's - zu leise sprach, schrie er, sie solle mit ihm herauskommen. Beim Hinausgehen, trat er sie, dass sie hinfiel. Dann musste sie hundertmal laut ihren Namen rufen. St. ging währenddessen weg und befahl der Zeugin Kraf., aufzupassen, dass Flora auch hundertmal ihren Namen rufe. Kurz danach kam er wieder zurück und fragte die Zeugin, wie oft Flora ihren Namen gerufen habe. Die Zeugin Kraf. belog St., indem sie antwortete, Flora habe bereits 96mal ihren Namen gerufen. Sie wollte die ältere Frau nämlich aus ihrer unangenehmen Situation befreien. St., der jedoch sofort durch Befragen der Jüdin entdeckte, dass er von der Zeugin Kraf. belogen worden war, schrie nun die Zeugin an und befahl ihr, sich neben Flora zu stellen und zu rufen, sie dürfe ihre Vorgesetzten nicht belügen. Durch das Dazwischentreten von zwei SS-Führern wurde die Zeugin Kraf. hiervon jedoch befreit. Sie sah aber einige Zeit danach, dass St. mit der Jüdin Flora wegging. Nach einer Weile kam er zurück und sagte zu ihr: "Die habe ich erledigt und Du bist die Nächste! Ich finde schon einen Grund, verlass Dich darauf!"
Ob St. die Jüdin Flora getötet hat, konnte allerdings nicht festgestellt werden. Sein Ausspruch spricht jedoch zumindest dafür, dass er sie schwer geschlagen hat.
Dieses Verhalten des Angeklagten St. gegenüber den Häftlingen und einer jüdischen älteren, hilflosen Frau spricht ebenfalls dafür, dass er auf dem Boden der nationalsozialistischen Weltanschauung stand und das Vernichtungsprogramm der NS-Machthaber bez. der jüdischen Menschen innerlich bejaht und aus innerster Überzeugung von der Richtigkeit dieses Programms bei den geschilderten Tötungen der Juden mitwirken wollte. St. hat bei seiner Vernehmung zur Sache auch erklärt, dass er die Judenvernichtung damals bejaht habe, wobei er entschuldigend hinzufügte, dass daran die NS-Propaganda schuld gewesen sei, die ihnen immer wieder eingehämmert habe, die Juden seien an allem Schuld, die Juden seien das Unglück Deutschlands.
Letzte Zweifel daran, dass St. die geschilderten Tötungen als eigene Taten gewollt hat, wurden schliesslich beseitigt durch sein Verhalten bei den Vergasungen, die der Zeuge Philipp Mü. geschildert hat. Die Art, wie der Angeklagte St. damals die Häftlinge des jüdischen Sonderkommandos kaltblütig erschossen hat, als sie ihm wegen ihres körperlichen Zustandes nicht mehr nützlich erschienen, und wie er die jüdischen Frauen und den entdeckten alten Juden umgebracht hat, zeigt, dass er jegliche moralischen und sittlichen Hemmungen abgestreift hatte. Sie zeugt ferner davon, dass in ihm, der vor seinem Eintritt in die SS ein unauffälliges Leben geführt hatte und auch nach dem Kriege sich wieder ganz in das bürgerliche Leben eingeordnet hat, unter dem Einfluss der NS-Propaganda die niederen Instinkte gegenüber jüdischen Menschen geweckt worden sind und er die Juden nur noch als Ungeziefer ansah, das es zu vernichten galt. Ihm hat es nach der ganzen Art seines Verhaltens offensichtlich Freude und innere Befriedigung bereitet, die jüdischen Menschen nicht nur zu töten, sondern vorher auch noch zu quälen. Damit hat er sich ganz mit dem Hass der NS-Machthaber gegen die Angehörigen der jüdischen Rasse identifiziert und sich ihre Ziele, die Juden auszurotten, zu eigen gemacht.
Das Schwurgericht hat daher keine Zweifel, dass St. in allen unter II.1., 3. und 4. geschilderten Fällen die Tötung der Juden als eigene Tat gewollt, somit als Mittäter gehandelt hat.
Der Angeklagte St. hat in allen unter II.1., 3. und 4. geschilderten Fällen auch vorsätzlich gehandelt. Er hat seinen Tatbeitrag in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken mit anderen SS-Angehörigen geleistet, wobei ihm klar gewesen ist, dass er kausale Tatbeiträge zu den Tötungen leistete. Das kann nach dem geschilderten Sachverhalt nicht zweifelhaft sein. Er hat hierbei auch das Bewusstsein gehabt, Unrecht zu tun. Denn er hat - wie oben schon ausgeführt - erkannt, dass die Tötung unschuldiger jüdischer Menschen, insbesondere von Kindern, verbrecherisch war.
Er hat nicht irrig angenommen, dass die ihm gegebenen Befehle, an der Judenvernichtung mitzuwirken, trotz ihres verbrecherischen Charakters für ihn bindend gewesen seien. Hier gilt das gleiche, was bereits oben unter A.V.2. bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Mulka ausgeführt worden ist. Die Tötung der schuldlosen jüdischen Menschen, insbesondere der Kinder, trug den Stempel des Unrechts so klar auf der Stirn, dass auch der primitivste Mensch, der zur Unterscheidung von Gut und Böse gekommen ist, keine Zweifel daran haben konnte, dass solche verbrecherischen Befehle nicht bindend sein konnten, auch wenn sie von der höchsten Staatsführung ausgingen. Hinzu kommt, dass - was dem Angeklagten St. bekannt war - die Tötungen unter strengster Geheimhaltung und unter Täuschung der Opfer erfolgten.
Dagegen spricht auch nicht, dass St. als junger Mensch ganz dem Einfluss der NS-Propaganda erlegen und in jungen Jahren zu Hass und Härte gegen die sog. Staatsfeinde und blindem Gehorsam gegen die SS-Vorgesetzten erzogen worden ist. Er mag die Tötung der Juden - ebenso wie die NS-Machthaber - zwar für zweckmässig, nützlich und notwendig angesehen haben, das besagt jedoch nicht, dass ihm das Gefühl und die Erkenntnis gefehlt hätten, dass die aus diesen Erwägungen heraus gegebenen Tötungsbefehle gegen anerkannte Rechtsgrundsätze und gegen die allen Angehörigen von Kulturnationen gemeinsame übereinstimmende Rechtsüberzeugung verstiessen und daher nicht bindend sein konnten.
Das hat er bei seiner ersten Vernehmung gegenüber dem Kriminalobermeister Ae. selbst auch so zum Ausdruck gebracht. Wenn er die verbrecherischen Befehle blindlings befolgt hat, dann nur deswegen, weil er sich die verbrecherischen Ziele der NS-Machthaber zu eigen gemacht und darauf vertraut hat, dass er wegen der Tötungen nie zur Verantwortung gezogen werden würde.
Eine jede Erschiessung der vierzig jüdischen Menschen aus den beiden Gruppen (Ziffer II.1.a. und b.) ist als eine selbständige Handlung im Sinne des §74 StGB anzusehen. Denn sie erforderte jeweils eine besondere Willensbetätigung und richtete sich gegen das Leben eines Menschen. Jede Erschiessung wurde durch Zusammenwirken des Angeklagten St. mit dem Rapportführer Palitzsch ausgeführt. Die Tötung der beiden Gruppen konnte nicht nur als zwei Massenverbrechen angesehen werden, da dem deutschen Recht der Begriff des Massenverbrechens fremd ist (vgl. auch Urteil des BGH vom 22.5.1962 - 5 StR 4/62).
Die Tötung einer Gruppe von 200 Personen im kleinen Krematorium durch Gas (Ziff.II.3.) ist als eine selbständige Handlung im Sinne einer gleichartigen Handlungseinheit (§73 StGB) anzusehen, da hier durch eine Willensbetätigung, nämlich das Einwerfen des Zyklon B, 200 Menschen auf einmal getötet worden sind, §211 also 200mal durch ein und dieselbe Handlung verletzt worden ist.
Die Vergasung jüdischer Menschen, die - wie unter II.3. geschildert - vor der Tötung der 200 Personen geschah, und an der der Angeklagte St. ebenfalls beteiligt war, ist nicht angeklagt und vom Eröffnungsbeschluss nicht erfasst. Dem Angeklagten St. wird in Ziff.3 des Eröffnungsbeschlusses nur die Mitwirkung an einer Vergasung, bei der er das Zyklon B in den Vergasungsraum eingeschüttet haben soll, zur Last gelegt. Wegen seiner Mitwirkung an der unter II.3. zunächst geschilderten Vergasung jüdischer Menschen konnte er daher nicht verurteilt werden.
Die Tötung der Gruppe von mindestens 100 Menschen in der Gaskammer eines der umgebauten Bauernhäuser (Ziff.II.4.) war ebenfalls ein Mord, begangen in gleichartiger Tateinheit an mindestens 100 Menschen. Hier gilt das gleiche wie im Falle der Vergasung von 200 Menschen im kleinen Krematorium.
Der Angeklagte St. war daher auf Grund des unter II.1., 3. und 4. festgestellten Sachverhalts wegen gemeinschaftlichen Mordes (§§47, 74, 211 StGB) in 40 Fällen (Erschiessungen im kleinen Krematorium), wegen gemeinschaftlichen Mordes in einem weiteren Fall, begangen in gleichartiger Tateinheit an mindestens 200 Menschen (§§47, 211, 73 StGB) und wegen gemeinschaftlichen Mordes, begangen in gleichartiger Tateinheit an mindestens 100 Menschen (§§47, 211, 73 StGB) zu verurteilen.
2. Zu II.2.
Die Tötung der beiden Kinder erfüllt ebenfalls den Tatbestand des Mordes. Sie erfolgte aus niedrigen Beweggründen. Der äussere Anlass für die Tötung konnte zwar nicht mit Sicherheit geklärt werden. Es ging das Gerede, dass damals das grössere Kind sich ein Kaninchen zum Spielen geholt habe, was ihm als Diebstahl ausgelegt worden sei.
Nach der Überzeugung des Gerichts war jedoch der Hintergrund dieser Tötungen die radikale nationalsozialistische Politik gegen die Angehörigen der polnischen Nation. Das eigentliche Motiv für die Tötungen war der Hass gegen die Polen als Angehörige einer sog. minderwertigen Rasse, die man unterdrücken und teilweise ausrotten wollte. Denn die beiden Kinder waren noch gar nicht strafmündig. Unter normalen Verhältnissen und den normalen, den Grundsätzen aller Kulturnationen entsprechenden Gesetzen wäre die Tötung von Kindern wegen irgendeines Vergehens nicht möglich gewesen. Deutsche strafunmündige Kinder wären auch niemals, selbst wenn sie irgendwelche Vergehen begangen hätten, auf diese Weise getötet worden. Die Gestapo-Leitstelle Kattowitz hat daher nach der Überzeugung des Gerichts die Tötung der beiden Kinder befohlen, weil sie Polen und damit Angehörige einer sog. minderwertigen Rasse waren, mag auch sonst irgendein äusserer Anlass vorgelegen haben, der aber in Wirklichkeit nur als ein willkommener Vorwand diente, um entsprechend der nationalsozialistischen Unterdrückungs- und Ausrottungspolitik zwei weitere Angehörige der "verhassten polnischen Nation" zu "liquidieren". Ein solches Motiv ist aber sichtlich verachtenswert und steht auf niedrigster Stufe; es ist als niedrig im Sinne des §211 StGB anzusehen.
Der Angeklagte St. hat bei den Tötungen auf Befehl mitgewirkt. Seine Handlungsweise muss daher im Rahmen des §47 MStGB beurteilt werden.
Nach der Überzeugung des Gerichts hat der Angeklagte St. klar erkannt, dass die Tötungen der beiden Kinder ein allgemeines Verbrechen war. Jedem geistig normalen Menschen ist bekannt, dass kleine Kinder, vor allem, wenn sie noch so klein sind, dass sie von ihrer Mutter auf dem Arm getragen werden müssen, strafrechtlich noch nicht zur Verantwortung gezogen werden können, da sie Gut und Böse noch nicht unterscheiden können. Das hat nach der Überzeugung des Gerichts auch der Angeklagte St. gewusst, der aus geordneten bürgerlichen Verhältnissen stammt und immerhin bis zu seinem 16. Lebensjahr die höhere Schule besucht und sich in Auschwitz noch auf das Abitur vorbereitet hat, das er im Jahre 1943 auch abgelegt hat. Damit musste sich ihm aber auch gleichzeitig die Erkenntnis aufdrängen, dass die Tötung nicht zur Ahndung strafbaren Unrechts, sondern nur deswegen erfolgte, weil die beiden Kinder Angehörige der verhassten polnischen Nation waren. Nach der Überzeugung des Gerichts hat er diese Erkenntnis auch gehabt, zumal gegen die Kinder, was er wusste, nicht einmal ein Standgerichtsurteil vorlag.
Den Angeklagten St. trifft daher nach §47 MStGB die Strafe des Teilnehmers. Nach der Überzeugung des Gerichts hat St. auch in diesem Fall die Taten als eigene gewollt. Da St. ganz dem Einfluss der NS-Propaganda erlegen ist und sich die Ziele der NS-Machthaber im Bezug auf die Judenpolitik zu eigen gemacht und mit Eifer bei der Tötung der Juden mitgewirkt hat, ist das Gericht - auch auf Grund seines sonstigen Verhaltens in Auschwitz, wie es oben geschildert worden ist - überzeugt, dass er auch in diesem Fall die Tötung der beiden Kinder als eigene Taten gewollt hat.
St. hat auch vorsätzlich gehandelt. Er hat in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken mit einem namentlich nicht bekannten SS-Angehörigen den Tod der Kinder herbeigeführt. Dabei waren ihm die Umstände bekannt, die den Beweggrund für die Tötung als niedrig kennzeichnen. Der Angeklagte St. hat auch das Bewusstsein gehabt, Unrecht zu tun. Das ergibt sich bereits aus dem vorher Gesagten.
Es liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Angeklagte St. irrig angenommen hat, der Tötungsbefehl sei trotz seines verbrecherischen Charakters für ihn bindend. Nach der Überzeugung des Gerichts hat dies der Angeklagte St. nicht geglaubt. Denn die Tötung von kleinen Kindern ist ein so schwerer Verstoss gegen das Recht und trägt den Stempel des Unrechts zu klar auf der Stirn, dass St. zu dieser Annahme nicht kommen konnte.
Wie der Zeuge Sm. bekundet hat, war ein anderer SS-Angehöriger, der ebenfalls in der Aufnahmeabteilung der Politischen Abteilung beschäftigt war, nämlich der SS-Rottenführer Klaus, auch sehr empört darüber, dass die Kinder getötet werden sollten. Sonstige Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe liegen nicht vor. Insbesondere scheidet ein Befehlsnotstand (§52 StGB) aus, da der Angeklagte St. aus innerer Überzeugung und in Übereinstimmung mit den Zielen der NS-Machthaber die Tötungen als eigene Taten gewollt hat.
Die Erschiessungen der beiden Kinder sind als zwei selbständige Handlungen anzusehen (§74 StGB), da sie durch jeweils selbständige Willensbetätigungen ausgeführt worden sind und sich jeweils gegen das Leben eines Menschen richteten.
St. ist daher in diesem Fall wegen gemeinschaftlichen Mordes in zwei Fällen (§§47, 74, 211 StGB) zu bestrafen. Wegen der Erschiessung der Frau hat das Schwurgericht den Angeklagten St. nicht verurteilt. Es ist nicht mit Sicherheit auszuschliessen, dass gegen die Frau ein Standgerichtsurteil vorlag. Ob dieses Standgerichtsurteil als rechtmässiges Todesurteil angesehen werden kann oder ob es in krasser Weise gegen allgemeine Rechtsgrundsätze verstossen hat und daher keine Rechtfertigung für die Tötung der Frau geben konnte, konnte nicht geklärt werden, da alle näheren Umstände nicht bekannt sind. Auch konnte in diesem Fall nicht mit Sicherheit festgestellt werden, selbst wenn die Tötung der Frau objektiv rechtswidrig gewesen ist, ob der Angeklagte St. klar erkannt hat, dass die Tötung der Frau verbrecherisch gewesen ist.
3. Zu II.5.
Die unter diesem Punkt angeführten Taten des Angeklagten St. sind nicht angeklagt und nicht in dem den Angeklagten St. betreffenden Eröffnungsbeschluss enthalten. Denn in Punkt 3 des Eröffnungsbeschlusses wird dem Angeklagten St. nur die Mitwirkung an einer einzigen ganz bestimmten Vergasung im Oktober 1941, bei der er nämlich selbst das Zyklon B eingeworfen hat, zur Last gelegt.
In Punkt 4 des Eröffnungsbeschlusses wird dem Angeklagten die Teilnahme an einer unbestimmten Anzahl von Vernichtungsaktionen ab Sommer 1942 zur Last gelegt. Vergasungsaktionen, die vor dieser Zeit stattgefunden haben, nämlich im Mai und bis zum 21.6.1942, können damit nicht gemeint sein. Die Anklage und der Eröffnungsbeschluss beziehen sich ersichtlich auch nur auf Vergasungsaktionen, die in den umgebauten Bauernhäusern durchgeführt worden sind. Aus diesem Grunde konnte der Angeklagte St. wegen der unter II.6. festgestellten Taten nicht verurteilt werden. Eine rechtliche Würdigung erübrigt sich daher. Auch die Tötung der zu dem Fischelkommando gehörenden Juden ist nicht angeklagt und nicht im Eröffnungsbeschluss enthalten. Diese Taten geben jedoch - wie bereits ausgeführt - Aufschluss über die innere Einstellung des Angeklagten St. zu den Massentötungen der Juden überhaupt. Aus diesem Grunde waren sie daher anzuführen.
V. Anwendung des Jugendstrafrechts auf den Angeklagten St.
Der Angeklagte St. ist am 14.6.1921 geboren. Er war daher bei der Vergasung der Gruppe jüdischer Menschen im Oktober 1941 (II.3.) noch keine 21 Jahre alt. Auch bei der Erschiessung der beiden jüdischen Gruppen (II.1.a. und b.) hatte er das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet. Jedenfalls muss zu seinen Gunsten davon ausgegangen werden, da der Zeitpunkt der Tötung nicht auf den Tag genau festgestellt werden konnte. Da auch nicht mit Sicherheit geklärt werden konnte, wann der Angeklagte St. die beiden Kinder getötet hat, muss zu seinen Gunsten davon ausgegangen werden, dass dies vor dem 14.6.1942, also vor Vollendung des 21. Lebensjahres gewesen ist. Der Angeklagte St. war daher im Zeitpunkt dieser Taten "Heranwachsender" im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes. Nach §105 Abs.I.1 JGG sind auf Verfehlungen Heranwachsender, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht sind, die für einen Jugendlichen geltenden Vorschriften der §§4-32 JGG anzuwenden, wenn die Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters bei Berücksichtigung auch der Umweltbedingungen ergibt, dass er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichstand.
Das ist bei dem Angeklagten St. der Fall. Er kam noch als Jugendlicher, nämlich mit 16 Jahren und fünf Monaten zur SS. Damit kam er unter den unheilvollen Einfluss der nationalsozialistischen Erzieher. Die intensive weltanschauliche und biologische Schulung, die nur in Klischees dachte und mit Phrasen auf den Jugendlichen St. einhämmerte, führte nach dem überzeugenden Gutachten des Sachverständigen Dr. Lec., dem sich das Gericht in vollem Umfang anschliesst, dazu, dass St. keinen Spielraum zu eigenem Denken und einer seelischen Entwicklung und Entfaltung mehr hatte. Er blieb in seiner geistig-seelischen Entwicklung stehen. Die intensive Schulung, die dem einzelnen das Denken abnahm, verhinderte eine Reifung, die zu einer eigenen Meinungsbildung hätte führen können.
Aufschlussreich hierfür ist der Abituraufsatz, den St. im Jahre 1942 kurz vor Vollendung seines 21. Lebensjahres schrieb. Er hatte als Aufsatzthema "Die Befreiung Deutschlands von den Ketten des Versailler Diktates durch Adolf Hitler" gewählt. Der ganze Aufsatz gibt das wieder, was St. in der SS über die deutsche Geschichte gelernt hatte. Er beginnt damit, dass in schicksalsschwerer Stunde der unbekannte Gefreite des Weltkrieges Adolf Hitler zum Reichskanzler berufen wurde: "Dieser Mann hat es durch zähe Energie, Vaterlandsliebe und Verantwortungsbewusstsein fertig gebracht, das Deutsche Reich wieder an den Platz zu stellen, der ihm in der Geschichte gebührt." Der Aufsatz schliesst mit den Worten: "Deutschland hat sich durch sein geniales Staatsoberhaupt seinen Platz in der Welt zurückerobert. Noch steht unser Volk im Existenzkampf, über dessen Ausgang keine Zweifel herrschen. Nach seinem siegreichen Ende wird Deutschland einer Blütezeit entgegensehen, die uns über die schmachvolle Zeit voll stolzer Befriedigung hinwegsetzt. Durch den Vertrag von Versailles wurde das deutsche Volk wehrlos gemacht, aber man hat hierbei die Drachensaat für eine blutige Ernte gesät. Die Sieger hatten damals nicht an die deutsche Einheit und seinen genialen Volksführer gedacht."
Auch die schauerlichen Erlebnisse in Auschwitz hatten nicht genügt, das verlogene Bild eines herrlichen Deutschland, das der Angeklagte St. vor sich sah, zu zerstören. St. ist nach dem überzeugenden Gutachten des Sachverständigen Dr. Lec. ein Beispiel dafür, wie ein durchschnittlich begabter, durchaus normal und unauffällig veranlagter junger Mensch bereitwillig das mit sich geschehen lässt, was man als eine Umkehrung des Gewissens bezeichnen kann.
Diese Macht der Verführung bei dem Angeklagten St. wird bestätigt durch die Aussage des Zeugen Kx. und den Eindruck den der Kollege des Zeugen Kx. von dem Angeklagten St. hatte. Beide konnten sich das Verhalten des Angeklagten, der an sich seinem Erscheinungsbild nach zunächst einen guten Eindruck machte und ihnen im Kern gut erschien, nur durch den unheilvollen Einfluss, den die nationalsozialistische Schulung auf den Angeklagten St. genommen hatte, erklären. Der Gutachter hat daher nach der Überzeugung des Gerichts mit Recht bejaht, dass St. vor Vollendung seines 21. Lebensjahres in Auschwitz noch einem Jugendlichen gleichzuachten sei.
Bei seiner Beteiligung an der Tötung der Juden in einem der umgebauten Bauernhäuser (II.4.) war St. bereits 21 Jahre alt. Denn diese Vergasung erfolgte im Sommer 1942, also nach dem 21.6.1942.
Nach §32 JGG gilt für mehrere Straftaten, die gleichzeitig abgeurteilt werden und auf die teils Jugendstrafrecht und teils allgemeines Strafrecht anzuwenden wäre, einheitlich das Jugendstrafrecht, wenn das Schwergewicht bei den Straftaten liegt, die nach Jugendstrafrecht zu beurteilen wären. Hierbei ist nicht nur auf die äussere Schwere der zu vergleichenden Taten und ihre Anzahl abzustellen. Vielmehr liegt der Schwerpunkt bei den Taten, deren Unrechtsgehalt nach der äusseren und inneren Tatseite die grössere Bedeutung für die Allgemeinheit und den Täter selbst, namentlich für seine Persönlichkeitsentwicklung zukommt. Dabei ist eine Gesamtwürdigung der Täterpersönlichkeit und der Vorgänge, die die einzelnen Straftaten ausmachen, unerlässlich. Die Tatwurzeln, die zu den Taten geführt haben, sind sorgfältig zu berücksichtigen (vgl. Dallinger-Lackner Komm. zum JGG 2.Aufl. Anm.9a zu §32 JGG).
Hier liegt das Schwergewicht bei den Taten, die der Angeklagte St. vor Vollendung des 21. Lebensjahres begangen hat. Die Beteiligung des Angeklagten St. an den Vergasungen in einem der umgebauten Bauernhäuser ist nur eine Fortsetzung der bereits vorher begangenen Taten in der gleichen Umwelt und unter den gleichen Umwelteinflüssen. Irgendein Einschnitt in seiner Entwicklung, die eine weitere geistige und seelische Reifung ermöglicht hätte, ist nicht ersichtlich. Der Angeklagte St. stand weiterhin unter dem unheilvollen Einfluss der nationalsozialistischen Weltanschauung und der Parolen, die die Vernichtung der jüdischen Menschen als notwendig hinstellten. Auch stand er weiterhin unter dem Zwang des in der SS herrschenden Prinzips des blinden Gehorsams. Die Tatwurzeln sind die gleichen für alle Taten. Die Verführung des Angeklagten St. durch die weltanschauliche und biologische Schulung wirkte auch nach Vollendung des 21. Lebensjahres nach, ohne dass St. durch irgendwelche gegensätzlichen Einflüsse sich davon hätte frei machen können.
Nach Auffassung des Schwurgerichts liegt daher der Schwerpunkt bei den Taten, die der Angeklagte St. in der Zeit seines Heranwachsens begangen hat, so dass auf seine gesamten Taten das Jugendstrafrecht gemäss §32 JGG anzuwenden ist. Der Angeklagte St. ist somit wegen der oben im einzelnen angeführten Taten nach Jugendstrafrecht zu bestrafen.
VI. Hilfsbeweisanträge
Der Hilfsbeweisantrag des Verteidigers des Angeklagten St., die Zeugen
1. Moh.,
2. Frau Mü.,
3. Frau Mö.
darüber zu vernehmen, dass der Angeklagte St. in der letzten Mai- und ersten Juniwoche des Jahres 1942 seinen Jahresurlaub zusammen mit Heini Mü. hatte und diesen in Darmstadt verlebte, war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, weil die in das Wissen des Zeugen gestellten Tatsachen so behandelt werden können, als wären sie wahr. Auch wenn der Angeklagte St. in diesen beiden Wochen von Auschwitz abwesend gewesen ist, wird dadurch die Aussage des Zeugen Philipp Mü. nicht erschüttert. Denn der Zeuge Philipp Mü. hat nicht behauptet, dass der Angeklagte St. in der letzten Mai- und in der ersten Juniwoche des Jahres 1942 an Vergasungen im kleinen Krematorium teilgenommen hat. Der Zeuge konnte nur ungefähre Zeitangaben machen. Die vom Zeugen genannten Zahlen der Opfer, hat das Gericht - wie schon ausgeführt - nur als unsichere Schätzungen angesehen und ihnen keinen Beweiswert zuerkannt. Der Urlaub des Angeklagten St. in der letzten Mai- und ersten Juniwoche des Jahres 1942 schliesst nicht aus, dass der Angeklagte St. in den ersten drei Maiwochen und in der zweiten Juniwoche an Vergasungen im kleinen Krematorium teilgenommen hat, durch die eine Vielzahl jüdischer Menschen getötet worden sind.
VII. Strafzumessung
Der Angeklagte musste wegen Mordes in mindestens 44 Fällen unter Anwendung von Jugendstrafrecht bestraft werden. Wegen der Schwere der Schuld, die der Angeklagte im KL Auschwitz vielfältig auf sich geladen hat, musste auf Jugendstrafe erkannt werden (§17 JGG). Gemäss §§32, 31 und 18 JGG war wegen aller Straftaten eine einheitliche Strafe auszuwerfen. Bei ihrer Bemessung waren folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:
Der Erziehungszweck der Jugendstrafe hatte in den Hintergrund zu treten, da seit Begehung der Taten mehr als zwanzig Jahre vergangen sind und der Angeklagte als ausgereifter Mann einer Erziehung im Sinne des Jugendstrafrechts nicht mehr zugänglich ist.
Bei aller Verführung durch die NS-Ideologie und der Erziehung zu blindem Gehorsam behält der gegen den Angeklagten zu erhebende Schuldvorwurf sein besonderes Gewicht. Der Angeklagte hat abgestumpft gegen ethische Wertungen die Mordtaten begangen; er hat mit starkem verbrecherischem Willen den Tod vieler unschuldiger Menschen, darunter Kinder, verschuldet; die Schwere seiner Taten ist von ausserordentlichem Gewicht.
Hiernach erschien es, selbst wenn man berücksichtigt, dass St. ohne sein Zutun KZ-Bewacher geworden, dem einen oder anderen Häftling Gutes erwiesen haben mag, und er nach dem Kriege ein ordentliches Leben geführt hat, unerlässlich, unter Betonung des Sühnegedankens auf das Höchstmass von 10 Jahren Jugendstrafe zu erkennen.
Diese Strafe erschien gerechtfertigt, auch wenn der Angeklagte wenigstens einen geringen Teil seiner Straftaten eingeräumt und damit zu erkennen gegeben hat, dass er bereit ist, für sein Verhalten in Auschwitz Strafe auf sich zu nehmen.
E. Die Straftaten des Angeklagten Dylewski
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Dylewski
Der Angeklagte Dylewski ist als Sohn eines Grubensteigers am 11.5.1916 in Finkenwalde (Kreis Stettin) geboren. Er hat noch eine Schwester. Er verlebte seine Jugendzeit im Elternhaus in Lazisk bei Kattowitz/Oberschlesien. Nach dem ersten Weltkrieg optierte der Vater des Angeklagten für Polen, so dass die ganze Familie die polnische Staatsangehörigkeit erwarb. Der Angeklagte besuchte von 1922 bis 1926 die deutschen Volksschulen in Knurow und Nicolai und anschliessend ein Jahr lang ein Privatgymnasium in Pless. Von diesem wechselte er dann auf das staatliche Gymnasium in Nicolai über, an dem er 1935 die Reifeprüfung ablegte. Nach dem Abitur arbeitete er sechs Monate als Praktikant für Maschinenbau in der Danziger Werft in Danzig. Im Frühjahr 1936 begann er das Studium für Flugzeugtechnik an der Technischen Hochschule in Danzig. 1938 bestand er das Vorexamen. Nach dem 6. Semester wechselte er in die Fachrichtung Maschinenbau über.
Im August 1939 unterbrach er sein Studium und meldete sich freiwillig zur SS-Heimwehr in Danzig. Er will sich allerdings nur unter "moralischem" Druck der Heimwehr freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Seine Meldung sei auch nur - so gibt er an - für den Polenfeldzug gedacht gewesen, da er sein Studium habe fortsetzen wollen. Während des Polenfeldzuges blieb der Angeklagte in Danzig. Nach dem Feldzug bat er um seine Entlassung aus der SS-Heimwehr. Sein Entlassungsgesuch wurde jedoch abgelehnt. Er wurde vielmehr zum 1. SS-Totenkopf-Infanterieregiment 3 versetzt, das in Dachau aufgestellt wurde. Mit dieser Einheit nahm er am Frankreichfeldzug teil.
Nach einem Urlaub im August 1940 kam er zum SS-Totenkopf-Infanterieersatzbataillon III nach Breslau. Von dort wurde er als SS-Sturmmann mit etwa 50 Mann, die von Auschwitz angefordert worden waren, am 1.9.1940 nach Auschwitz zum Wachsturmbann versetzt. Dort wurde er bei einer Wachkompanie als Ausbilder eingesetzt. Vom Frühjahr 1941 bis August 1941 hatte der Angeklagte Studienurlaub. Danach war er noch kurze Zeit als Ausbilder im Wachsturmbann tätig. Am 1.9.1941 wurde er zur Politischen Abteilung im Stammlager des KZ Auschwitz versetzt. Zunächst war er nur als Dolmetscher des Kriminalassistenten oder Kriminalsekretärs Wosnitzka eingesetzt.
Später wurde er auch mit der selbständigen Durchführung von Vernehmungen beauftragt. Er hatte insbesondere Fluchtfälle zu bearbeiten. Am 6.11.1941 wurde er zum SS-Unterscharführer und am 17.4.1944 zum SS-Oberscharführer befördert. Von Ende April oder Anfang Mai 1944 bis Ende Juli oder Anfang August 1944 hatte der Angeklagte einen zweiten Studienurlaub. Während des Urlaubs bemühte er sich über einen Studienkollegen um seine Versetzung von Auschwitz. Im August 1944 wurde er dann auch nach Hersbruck bei Nürnberg zu einer unterirdischen Flugzeugfabrik, die dem SS-WVHA unterstand, versetzt.
Nach dem Zusammenbruch geriet der Angeklagte nicht in Kriegsgefangenschaft. Es gelang ihm, in Zivilkleidung von seiner Dienststelle nach München zu entkommen. Bis zum Herbst 1945 arbeitete er bei einem Bauern in Pfaffenhausen. Von Herbst 1945 bis Ende des Jahres 1947 war er in einer Gärtnerei in Hamburg als Gärtnergehilfe tätig. Er führte damals den falschen Namen Peter Schmidt. Es gelang ihm, einen Führerschein auf den Namen Peter Schmidt zu erhalten. Auf Grund dieses Führerscheins wurde ihm dann ein Personalausweis auf den Namen Peter Schmidt ausgestellt. Der Angeklagte führte den falschen Namen bis zum Jahre 1952.
1948 nahm der Angeklagte sein Studium an der Humboldt-Universität in Ostberlin wieder auf. Er bestand das Examen als Diplom-Gewerbelehrer. Anschliessend war er als Gewerbelehrer in der SBZ und ab 1950 in Düsseldorf tätig. Seit 1952 arbeitete er als Sachverständiger für Werkstoffabnahme beim Technischen Überwachungsverein in Düsseldorf. Er verdiente in dieser Stellung 1800.- DM brutto im Monat. 1952 nahm der Angeklagte seinen richtigen Namen wieder an. Der Angeklagte hat am 5.5.1943 zum ersten Male geheiratet. Aus dieser Ehe mit der Zeugin Ruth geb. Fe. ist eine am 13.6.1944 geborene Tochter hervorgegangen. Die Ehe wurde im Jahre 1952 von dem Landgericht in Köln geschieden. Am 28.2.1953 heiratete der Angeklagte seine jetzige Ehefrau, die eine Tochter mit in die Ehe brachte. Aus der zweiten Ehe stammt ebenfalls eine Tochter.
Der Angeklagte leidet seit Jahren an Gehirnkrämpfen, bei denen Gehirndurchblutungsstörungen auftreten. Erstmalig traten diese Anfälle auf, nachdem er vier bis sechs Wochen in Auschwitz gewesen war. Wegen dieser Gehirnkrämpfe war der Angeklagte nicht frontdienstverwendungsfähig. Die Anfälle treten insbesondere nachts auf. Dabei wird der Angeklagte völlig unbeweglich.
Der Angeklagte Dylewski befand sich vom 24.4.1959 bis zum 25.5.1959 und vom 16.12.1960 bis zum 23.3.1961 in dieser Sache in Untersuchungshaft. Seit dem 5.10.1964 befindet er sich erneut in Untersuchungshaft.
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Mitwirkung des Angeklagten Dylewski an der Massentötung jüdischer Menschen in Auschwitz (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
Der Angeklagte Dylewski war als Angehöriger der Politischen Abteilung an den Massentötungen der mit RSHA-Transporten angekommenen jüdischen Menschen (vgl. oben A.II.) beteiligt. Als Angehöriger der Politischen Abteilung im KL Auschwitz wurde der Angeklagte Dylewski zum Rampendienst eingeteilt. Er war wiederholt auf Grund dieser Einteilung bei der Ankunft, Einteilung und Abwicklung von RSHA-Transporten auf der Rampe. Anfangs wurde er zur Sicherung der angekommenen Transporte mit herangezogen, weil der Wachsturmbann damals diese Aufgabe allein nicht erfüllen konnte. Mit anderen Angehörigen der SS bildete er um die angekommenen Menschen auf der alten Rampe eine Postenkette, damit niemand entfliehen und kein unbefugter das Gelände der alten Rampe betreten konnte.
Später musste er nach der Ankunft von RSHA-Transporten, wenn die jüdischen Menschen aus den Eisenbahnwaggons ausgestiegen waren, zusammen mit anderen SS-Männern die Eisenbahnwaggons durchgehen und zurückgebliebene Personen aus den Wagen hinausschicken. Dies hat er auch getan. Als Angehöriger der Politischen Abteilung hat er ferner die gleichen Überwachungsfunktionen, die auch der Angeklagte Boger (vgl. oben C.II.1.) zu erfüllen hatte, ausgeübt. Er achtete darauf, dass die Häftlinge des Häftlingskommandos nicht mit den Zugängen sprachen und dass die SS-Angehörigen ihren Rampendienst ordnungsgemäss erfüllten.
Schliesslich hat der Angeklagte Dylewski mehrfach die für den Tod bestimmten jüdischen Menschen zusammen mit anderen SS-Angehörigen bis zum Eingang des Lagers Birkenau begleitet, von wo sie dann zu den Gaskammern gebracht und getötet wurden.
Der Angeklagte Dylewski hat in einer unbestimmten Anzahl von Fällen den Rampendienst auf diese Weise versehen. Mit Sicherheit hat er bei der Vernichtung von mindestens zwei RSHA-Transporten, die an zwei verschiedenen Tagen nach Auschwitz gebracht worden sind, einige der geschilderten Tätigkeiten ausgeübt.
Er wusste, dass die jüdischen Menschen nur deswegen getötet wurden, weil sie Juden waren. Es war ihm ferner bekannt, dass die gesamten Vernichtungsaktionen unter strengster Geheimhaltung durchgeführt wurden. Er selbst war - wie alle anderen Angehörigen der SS - zur strengsten Verschwiegenheit verpflichtet worden. Er wusste auch, dass die Opfer über ihr bevorstehendes Schicksal getäuscht und dass sie in den Gaskammern auf die oben im einzelnen geschilderte Art und Weise getötet wurden. Schliesslich war dem Angeklagten Dylewski auch klar, dass er durch seine eigene Tätigkeit im Rahmen des sog. Rampendienstes die Vernichtungsaktionen förderte.
Die Beteiligung des Angeklagten Dylewski an den sog. Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen der für den Tod ausgesuchten Häftlinge (Eröffnungsbeschluss Ziffer 2, 3 und 4)
Der Angeklagte Dylewski hat als Angehöriger der Politischen Abteilung, zu der er am 1.9.1941 versetzt worden ist, auch an den sog. Bunkerentleerungen (vgl. oben C.II.3.) teilgenommen. Er war vor allem Sachbearbeiter von Fluchtsachen. Wiederholt sassen Häftlinge in den Zellen des Arrestbunkers ein, deren Fälle er zu bearbeiten hatte. Zu den Bunkerentleerungen wurde er von Grabner, dem Leiter der Politischen Abteilung, hinbestellt. Er ging zusammen mit den anderen SS-Angehörigen in den Arrestbunker hinunter, wenn dieser - wie sich Grabner auszudrücken pflegte - "ausgestaubt" werden sollte. Wenn die Zellentüren geöffnet wurden und sich die einsitzenden Häftlinge meldeten, berichtete der Angeklagte Dylewski jeweils in den von ihm bearbeiteten Fällen, was gegen den Häftling vorlag und was seine Ermittlung ergeben hatte. In Fluchtfällen bestimmte Grabner in der Regel, dass die betreffenden Häftlinge, sofern sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hatten, zu erschiessen seien. Deutsche Staatsangehörige wurden, auch wenn sie geflohen und wieder ergriffen worden waren, nicht zum Erschiessen ausgewählt. Der Angeklagte Dylewski sorgte dafür, dass die für den Tod bestimmten Häftlinge sich zu der Gruppe der zu Erschiessenden stellten und wachte darüber, dass sie sich nicht unbemerkt zu der in das Lager zu entlassenden Gruppe schlichen. Wenn die Bunkerentleerungen beendet und die für den Tod bestimmten Häftlinge in den Waschraum geführt worden waren, ging der Angeklagte Dylewski mit den anderen SS-Angehörigen in die Blockführerstube. In einigen Fällen verliess er den Block 11 bereits vor der Exekution. In mindestens drei Fällen nahm er jedoch an den anschliessenden - oben unter C.II.3. geschilderten - Exekutionen teil. Er ging mit den anderen SS-Männern auf den Hof und nahm direkt neben dem Ausgang aus dem Block 11 zum Hof Aufstellung.
Von Grabner erhielt Dylewski jeweils auch den Auftrag, sich für einen evt. verzweifelten Aufstand der Häftlinge bereitzuhalten und, falls es zu Widerstandshandlungen der Häftlinge kommen sollte, diese sofort mit Gewalt zu brechen. Dylewski richtete dementsprechend im Arrestbunker sein Augenmerk auf die für den Tod ausgesuchten Häftlinge und beobachtete in den genannten mindestens drei Fällen den Ausgang aus dem Block 11 und das Herausbringen der Delinquenten und die Erschiessungen an der Schwarzen Wand. In den genannten drei Fällen wurden jeweils mindestens 10 Häftlinge unter Anwesenheit des Angeklagten Dylewski erschossen. Der genaue Zeitpunkt dieser Taten konnte nicht mehr festgestellt werden. Mit Sicherheit steht jedoch fest, dass sich der Angeklagte Dylewski an Bunkerentleerungen und den geschilderten Erschiessungen erst nach seiner Versetzung zur Politischen Abteilung, also nach dem 1.9.1941, beteiligt hat.
Dass der Angeklagte Dylewski auf die Entscheidungen über das Schicksal der im Bunker einsitzenden Häftlinge massgebenden Einfluss ausgeübt oder - wie Boger - die Erschiessungen von Häftlingen selbst vorgeschlagen und sich mit Grabner und Aumeier über solche Erschiessungen sehr schnell verständigt und geeinigt hätte, konnte nicht festgestellt werden. Bei einer Bunkerentleerung, deren Zeitpunkt nicht mehr festgestellt werden konnte, wurde unter anderem auch ein Häftling namens Lewandowski aus der Zelle herausgerufen. Lewandowski wollte sich zu der Gruppe, die in das Lager entlassen werden sollte, begeben. Der Angeklagte Dylewski rief ihn jedoch zurück und stellte ihn zu der Gruppe, die für den Tod bestimmt war. Dass er in diesem Falle den Häftling Lewandowski eigenmächtig für den Tod bestimmt hätte, konnte nicht festgestellt werden. Es war nicht auszuschliessen, dass der Häftling Lewandowski schon an der Zellentür durch Grabner für den Tod ausgesucht worden ist und Dylewski (nur) in Ausführung dieser Anordnung verhindert hat, dass Lewandowski mit der Gruppe der zu Entlassenden unbemerkt in das Lager entkommen konnte.
Lewandowski ist anschliessend an der Schwarzen Wand erschossen worden.
Der Angeklagte Dylewski wusste, dass die Häftlinge ohne Todesurteil und ohne Befehl des RSHA oder anderer höherer Dienststellen für den Tod ausgesucht und erschossen wurden. Ihm war auch bekannt, dass die Bunkerentleerungen und die Erschiessungen erfolgten, um Platz für weitere Arrestanten im Bunker zu schaffen. Die gesamten Umstände, unter denen die Bunkerentleerungen und die anschliessenden Erschiessungen stattfanden, erlebte er selbst in den genannten mindestens drei Fällen von Anfang bis zum Ende mit. Ihm war klar, dass die an den Bunkerentleerungen und nachfolgenden Erschiessungen beteiligten SS-Angehörigen nicht befugt waren, über Leben und Tod eines Häftlings zu entscheiden.
III. Einlassung des Angeklagten Dylewski, Beweismittel, Beweiswürdigung
1.
Die Feststellungen über den Lebenslauf des Angeklagten Dylewski beruhen auf seiner Einlassung und den Bekundungen der früheren Ehefrau des Angeklagten Dylewski, der Zeugin Ruth Dylewski.
2. Zu II.1.
Der Angeklagte Dylewski ist geständig, wiederholt Rampendienst versehen zu haben und dabei mit anderen SS-Angehörigen in einer Postenkette Absperr- und Sicherungsaufgaben erfüllt zu haben. Er hat ferner zugegeben, die Eisenbahnwagen nach zurückgebliebenen Personen durchsucht und solche Personen auf die Rampe hinausgeschickt zu haben. Schliesslich hat er auch eingeräumt, die für den Tod bestimmten jüdischen Menschen mit anderen SS-Angehörigen zum Lager Birkenau begleitet zu haben. Dass der Angeklagte Dylewski darüber hinaus als Angehöriger der Politischen Abteilung auf der Rampe auch die Häftlinge des Häftlingskommandos und die SS-Angehörigen die bei den Vernichtungsaktionen mitwirkten, überwacht hat, hat das Gericht auf Grund der Einlassung des Angeklagten Boger festgestellt, der - wie oben ausgeführt - angegeben hat, dass dies zu den Aufgaben der Politischen Abteilung gehört habe.
Da es unmöglich war festzustellen, wie oft der Angeklagte Dylewski "Rampendienst" gemacht hat, er selbst auch keine Zahl mehr angeben konnte, hat sich das Gericht, da es sich nicht auf unsichere Schätzungen einlassen durfte, darauf beschränkt, eine Mindestzahl festzustellen. Dylewski hat nach seiner eigenen Einlassung "wiederholt" Rampendienst gemacht. Es konnte daher mit jeden Zweifel ausschliessender Sicherheit festgestellt werden, dass er mindestens zweimal bei der Vernichtung von RSHA-Transporten mitgewirkt hat. Nach seiner eigenen Einlassung hat der Angeklagte Dylewski auch gewusst, dass die jüdischen Menschen unter strengster Geheimhaltung und nur deswegen getötet werden sollten und getötet wurden, weil sie Juden waren.
Dass der Angeklagte Dylewski auch die gesamten Umstände, unter denen die Opfer getötet wurden (Täuschung über ihr bevorstehendes Schicksal, Tötung durch Gas in den Gaskammern) gekannt hat, hat das Gericht daraus geschlossen, dass er selbst wiederholt auf der Rampe war und die Opfer bis nach Birkenau begleitet hat. Dabei hat er zwangsläufig die gesamten Umstände erfahren.
3. Zu II.2.
Der Angeklagte Dylewski ist ferner geständig, an den Bunkerentleerungen in der geschilderten Weise und an mindestens drei Erschiessungen - so wie es unter II.2. geschildert worden ist - teilgenommen zu haben.
Allerdings behauptet er, dass meist ein Exekutionsbefehl des RSHA vorgelegen hätte, wenn ein Häftling zum Erschiessen bestimmt worden sei. Wenn Grabner Erschiessungen eigenmächtig angeordnet habe, so habe er - Dylewski - das damals noch nicht gewusst. Das habe er erst im Ermittlungsverfahren gegen Grabner erfahren. Er - Dylewski - habe die Erschiessungen als grausam empfunden, habe aber nicht gewusst, wie weit das Kriegsrecht gehe. Er habe sie für rechtmässig gehalten. Diese Einlassung sieht das Schwurgericht als eine Schutzbehauptung an. Unter C.II.3. ist bereits festgestellt worden, dass die Bunkerentleerungen und die nachfolgenden Erschiessungen an der Schwarzen Wand ohne Urteil eines Gerichts und ohne Befehl höherer Dienststellen durchgeführt worden sind. Unter C.IV.4. ist im einzelnen dargelegt worden, warum das Schwurgericht zu diesen Feststellungen gekommen ist. Dort sind alle Umstände angeführt worden, aus denen sich ergibt, dass die Erschiessungen ohne Gerichtsurteile und ohne Befehle des RSHA oder anderer höherer Dienststellen durchgeführt worden sind. Dem Angeklagten Dylewski, der an den Bunkerentleerungen wiederholt teilgenommen hat, waren alle diese Umstände bekannt. Ihm musste sich daher - ebenso wie dem Angeklagten Boger - die Erkenntnis aufdrängen, dass kein Befehl vom RSHA oder einer anderen Dienststelle vorliegen konnte. Vor allem aber kannte er selbst in den Fällen, die er bearbeitet hatte und über die er während der Bunkerentleerungen kurz referieren musste, die Akten, wusste also genau, dass weder ein Exekutionsbefehl, noch ein Gerichtsurteil vorlag. Ihm musste auch klar sein und war nach der Überzeugung des Gerichts auch eindeutig klar, dass für eine Entscheidungsmöglichkeit durch Grabner oder andere SS-Angehörige kein Raum hätte sein können, wenn bereits die Entscheidung vom RSHA oder einer anderen Dienststelle vorgelegen hätte. Der gesamte Aufwand im Arrestbunker wäre dann überflüssig gewesen. Ein einzelner SS-Mann oder der Bunkerkalfaktor hätte auf Grund von Exekutionsbefehlen die betreffenden Delinquenten einzeln zum Erschiessen aus den Zellen herausholen und zur Schwarzen Wand bringen können. Das Gericht ist daher überzeugt, dass der Angeklagte Dylewski ebenso wie der Angeklagte Boger genau gewusst hat, dass weder ein Gerichtsurteil noch Exekutionsbefehle höherer Dienststellen den Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen zugrunde lagen.
Sein Argument für seinen angeblichen Glauben an die Rechtmässigkeit der Erschiessungen entfällt damit.
Andererseits konnte das Gericht nicht mit Sicherheit feststellen, dass Dylewski selbst Häftlinge zum Erschiessen eigenmächtig ausgesucht oder zum Erschiessen vorgeschlagen hätte. Der Zeuge Be. hat zwar in der Hauptverhandlung gemeint, Dylewski habe einen Häftling namens Krammacz zum Erschiessen ausgesucht. Das Gericht hat aber Zweifel, ob die Erinnerung des Zeugen, der sonst einen glaubwürdigen Eindruck gemacht hat und sich nach Kräften bemüht hat, die Wahrheit zu sagen, insoweit zuverlässig ist. Der Zeuge konnte anders als im Falle Boger keine näheren Umstände angeben, die seine Behauptung, Dylewski habe den Krammacz ausgesucht und erschossen, stützen. Bei der Erschiessung des Krammacz war der Zeuge nicht dabei. Er konnte hierüber also keine Angaben als Augenzeuge machen. Dylewski war unter den polnischen Häftlingen und den Arrestanten nicht so bekannt wie Boger. Be. hat schliesslich bei seiner früheren Vernehmung im Ermittlungsverfahren, was ihm in der Hauptverhandlung vorgehalten worden ist, angegeben, dass Boger den Krammacz aus der Zelle herausgerufen habe. Seine Bekundung in der Hauptverhandlung steht daher insoweit in Widerspruch zu seinen früheren Angaben. Das Gericht konnte daher nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass Dylewski den Krammacz tatsächlich eigenmächtig ausgesucht und zum Erschiessen bestimmt hat.
Andere Zeugen, die einen besonderen Eifer des Angeklagten Dylewski bei solchen Bunkerentleerungen beobachtet hätten, sind nicht vorhanden. Insbesondere konnten auch die im Block 11 als Blockschreiber beschäftigt gewesenen Zeugen Bro., Wl. und Pi. nicht bestätigen, dass Dylewski selbständig und eigenmächtig Häftlinge zum Erschiessen bestimmt oder vorgeschlagen hätte.
Der Zeuge Pi., der Blockschreiber im Block 11 von Dezember 1942 - Mai 1944 gewesen ist, hat dies zwar im Fall des Häftlings Lewandowski angenommen, er musste aber auf näheres Befragen einräumen, dass dies nur eine Schlussfolgerung von ihm gewesen sei. Er hält es für möglich, dass Lewandowski durch Grabner schon an der Zellentür zum Erschiessen ausgesucht worden ist und dass Dylewski nur in Ausführung dieser Anordnung den Lewandowski zur Gruppe der zu Erschiessenden gestellt hat.
Der Zeuge Wl., der von Februar 1942 bis Dezember 1942 Blockschreiber auf Block 11 gewesen ist, hat zwar allgemein angegeben, dass ausser Grabner und Aumeier auch andere Angehörige der Politischen Abteilung, zum Beispiel St. und Dylewski, über das Schicksal von Häftlingen bei sog. Bunkerentleerungen entschieden hätten. Er konnte jedoch keine konkreten Fälle angeben, in denen St. und Dylewski Häftlinge selbständig und eigenmächtig zum Tode bestimmt hätte. Bei St. ist dies auch unwahrscheinlich, da er nicht in der Ermittlungsabteilung der Politischen Abteilung tätig gewesen ist. Die Beweisaufnahme hat nicht ergeben, dass Häftlinge im Arrestbunker eingesessen haben, deren Fälle der Angeklagte St. bearbeitet hätte. Es ist auch von keinem zuverlässigen Zeugen bestätigt worden, dass St. überhaupt an Bunkerentleerungen teilgenommen hätte. Es ist nicht auszuschliessen, dass der Zeuge Wl. hier einer Täuschung unterliegt.
Schliesslich musste der Zeuge Wl. auf Vorhalt einräumen, dass in einem Aufsatz über das Bunkerbuch, den er zusammen mit den früheren Schreibern von Block 11, Bro. und Pi. geschrieben hat und der in der Nr.1 der "Hefte von Auschwitz" veröffentlicht worden ist, geschrieben steht, dass bei Bunkerentleerungen "die entscheidende Stimme in den durch die Politische Abteilung geführten Fällen der Leiter dieser Abteilung und in allen anderen das Los der Häftlinge betreffenden Fällen der Lagerführer gehabt habe". Diese Angaben, die unter der Mitwirkung des Zeugen Wl. gemacht worden sind, stehen im Widerspruch zu seinen Aussagen in der Hauptverhandlung. Der Zeuge versuchte den Widerspruch dadurch aufzulösen, dass er behauptete, die anderen Mitglieder der Politischen Abteilung hätten nur in den - seltenen - Fällen selbständig entschieden, in denen Grabner an den Bunkerentleerungen nicht teilgenommen hätte. Einen konkreten Fall, in dem der Angeklagte Dylewski eigenmächtig und selbständig einen Arrestanten zum Erschiessen ausgesucht hätte, konnte er jedoch nicht nennen.
Das Gericht hat daher nicht die Überzeugung gewinnen können, dass Dylewski von sich aus Häftlinge für den Tod bestimmt oder von sich aus dem Grabner die Tötung von Häftlingen vorgeschlagen hätte.
Das Gericht konnte auch nicht mit Sicherheit feststellen, dass Dylewski nach Bunkerentleerungen Häftlinge eigenhändig erschossen hat.
Kein zuverlässiger Zeuge hat behauptet, den Angeklagten Dylewski nach Bunkerentleerungen als Todesschützen gesehen zu haben. Auch die genannten Blockschreiber haben dies nicht behauptet.
Der Zeuge Bro., der im Wege der Rechtshilfe durch das Kreisgericht in Kattowitz vernommen worden ist - das Protokoll über diese Vernehmung ist in der Hauptverhandlung verlesen worden - hat zwar ausgesagt, dass zu Erschiessungen an der Todeswand auch der Angeklagte Dylewski mit dem Kleinkalibergewehr gekommen sei. Aus dieser Aussage geht jedoch nicht hervor, ob Dylewski eigenhändig geschossen hat. Ferner ist nicht ersichtlich, um welche Art von Erschiessungen es sich gehandelt hat. Der Zeuge war bereits im Jahre 1941 auf Block 11 und blieb dort nur bis Februar 1942. Dann wurde er von dem Zeugen Wl. abgelöst. Es ist nicht mit Sicherheit festzustellen, ob es damals schon Bunkerentleerungen mit anschliessenden Erschiessungen gegeben hat. Die Exekutionen wurden zunächst - wie der Zeuge auch geschildert hat - durch ein Exekutionskommando durchgeführt. Es handelte sich um polnische Staatsangehörige (vgl. 2. Abschnitt VII.1.), die zum Zwecke der "Liquidierung" durch das RSHA, häufig auf Grund von Polizeistandgerichtsurteilen, in das KL eingeliefert worden waren und dort erschossen wurden. Die Exekutionen wurden dann vereinfacht. Die Funktion des Exekutionskommandos übernahmen einzelne SS-Angehörige, die die polnischen Staatsangehörigen durch Genickschüsse töteten. Aus der Aussage des Zeugen Bro. geht nicht klar hervor, ob es sich bei den von ihm angeführten Exekutionen um solche Erschiessungen gehandelt hat. Es ist aber anzunehmen, da der Zeuge über Bunkerentleerungen nichts erwähnt hat. Die näheren Umstände dieser Erschiessungen konnten nicht festgestellt werden. Er war nicht zu klären, welche Dienststellen die Exekutionen angeordnet hatten. Ferner konnte nicht festgestellt werden, ob den Erschiessungen Urteile irgendwelcher Sondergerichte zugrunde lagen. Wenn auch anzunehmen ist, dass die Tötungen rechtswidrig waren, konnte nicht festgestellt werden, ob der Angeklagte Dylewski klar erkannt hat, dass die Befehle, die die Tötungen anordneten, verbrecherisch waren. Dabei muss in Betracht gezogen werden, dass bei solchen Exekutionen, die durch das RSHA angeordnet wurden, in der Regel den ausführenden Organen keine näheren Angaben gemacht wurden, so dass Dylewski des Glaubens sein konnte, es lägen rechtmässige Urteile den Exekutionsanordnungen zugrunde.
Die Zeugen Gl., Philipp Mü., Fa. und Fab. wollen den Angeklagten Dylewski dabei beobachtet haben, wie er Menschen an der Schwarzen Wand bzw. im Hof zwischen Block 10 und 11 erschossen hat.
Der Zeuge Gl. war Leichenträger im KL Auschwitz. In dieser Eigenschaft musste er auch bei Erschiessungen an der Schwarzen Wand die Leichen der Erschossenen zur Seite tragen. Er hat bei seiner Vernehmung behauptet, der Angeklagte Dylewski habe in mindestens drei Fällen auch eigenhändig Häftlinge erschossen. In jedem dieser drei Fälle seien acht bis zehn Personen getötet worden. Ob der Angeklagte Dylewski jeweils alle Häftlinge dieser drei Gruppen eigenhändig erschossen habe, könne er allerdings nicht sagen. Bestimmt habe er aber von jeder Gruppe mehr als einen Häftling erschossen.
Das Gericht hat jedoch Bedenken, ob die Erinnerung des Zeugen Gl. insoweit zuverlässig ist. Der Zeuge stand noch stark unter dem Eindruck des Erlebten in Auschwitz. Er hat unzählige Erschiessungen mit eigenen Augen mit ansehen müssen. Es war ihm anzumerken, dass er seelisch noch sehr stark unter dem blutigen Geschehen, das ihm bei der Schilderung während der Hauptverhandlung offensichtlich noch mit allen grässlichen Begleiterscheinungen vor Augen stand, litt. Er war während dieser Vernehmung mehrfach dem Zusammenbruch nahe. Er hat zwar Namen der an den Erschiessungen beteiligten SS-Angehörigen genannt. Soweit es sich jedoch um die Frage gehandelt hat, wer eigenhändig die Erschiessungen durchgeführt hat, hat er mehrfach betont, dass es ihm sehr schwer falle, im Moment der Vernehmung die Namen der Todesschützen zu nennen. Erst auf näheres und dringendes Befragen hat er nach und nach Namen von SS-Angehörigen, unter anderen auch den Namen des Angeklagten Dylewski, genannt. Dabei ist es möglich und verständlich, dass der Zeuge guten Glaubens irrige Angaben gemacht hat. Es erscheint durchaus möglich, dass die schrecklichen Eindrücke so stark waren, dass sie die Erinnerung an die Personen der Todesschützen verdrängt haben, zumal es damals - aus der Sicht der Zeugen gesehen - keine entscheidende Rolle gespielt hat, wer die Erschiessungen eigenhändig durchgeführt und wer nur bei der Durchführung der Aktionen auf andere Weise mitgeholfen hat. Dass es zumindest zweifelhaft erscheint, ob die Erinnerung des Zeugen insoweit zuverlässig ist, ergibt sich auch aus folgendem:
Der Zeuge hat unter anderem geschildert, dass einmal mehrere Offiziere in Uniform gebracht worden seien, von denen er angenommen habe, dass sie deutsche Offiziere seien. Sie seien nackt an der Schwarzen Wand erschossen worden. Bei der Schilderung dieser Begebenheit hat der Zeuge erklärt, er wisse nicht, ob der Angeklagte Boger persönlich die Offiziere erschossen habe. Auf erneutes Befragen betonte er, dass der Angeklagte Boger zwar bei den Erschiessungen dabeigewesen sei, er wisse aber nicht, ob er selbst geschossen habe. Erst nach der Mittagspause behauptete der Zeuge, dass er sich nun entsinne, dass Boger selbst die Offiziere erschossen habe. Eine überzeugende Begründung dafür, woher dem Zeugen nun die sichere Erinnerung daran gekommen sei, konnte er nicht angeben.
Der Zeuge Gl. hat ferner behauptet, der Angeklagte Dylewski habe einen Häftling namens Kowalczyk eigenhändig erschossen. Er erinnere sich deswegen genau an diesen Häftling, weil er eine Brille getragen habe und Schreiber auf Block 28 gewesen sei. Kowalczyk sei auch Leichenträger gewesen und habe mit ihm - Gl. - im HKB zusammengearbeitet. Kowalczyk sei an einem der drei Tage erschossen worden, an denen er Dylewski eigenhändig habe schiessen sehen. Der Zeuge Wei. dagegen, der ebenfalls als Leichenträger auf Block 28 tätig gewesen ist, hat bekundet, dass der Angeklagte Boger eines Tages den Häftling Kowalczyk auf Block 11 eingeliefert habe. Einige Tage später sei er erschossen worden. Boger habe selbst das Kleinkalibergewehr an den Kopf des Häftlings Kowalczyk gelegt und ihn erschossen.
Nach der Eintragung im Bunkerbuch Band I Seite 44 ist der Häftling Kowalczyk - Häftlingsnummer 353 - am 24.9.1943 in den Bunker eingeliefert und am 11.10.1943 erschossen worden.
Bei diesen widersprechenden Aussagen konnte das Gericht nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass Dylewski tatsächlich - wie es der Zeuge Gl. behauptet - den Kowalczyk eigenhändig erschossen hat. Es konnte daher auch nicht die Gewissheit erlangen, dass Dylewski an dem Tag, an dem Kowalczyk erschossen worden ist, überhaupt geschossen hat und dass die übrigen Angaben des Zeugen Gl. betreffend den Angeklagten Dylewski zuverlässig sind.
Der Zeuge Gl. will ferner den Angeklagten Boger schon im Jahre 1941 gesehen haben. Tatsächlich ist Boger aber erst am 1.12.1942 nach Auschwitz gekommen. Auch das zeigt, dass die Erinnerung des Zeugen Gl. an Personen nicht mehr zuverlässig ist, was durchaus verständlich erscheint.
Aus der Aussage des Zeugen Gl. konnten daher bezüglich des Angeklagten Dylewski über die oben getroffenen Feststellungen hinaus keine weitere Feststellungen getroffen werden.
Nach der Aussage des Zeugen Philipp Mü. soll der Angeklagte Dylewski zusammen mit dem Angeklagten St. kleine Judentransporte an der Schwarzen Wand im Hof zwischen Block 10 und 11 erschossen haben.
Auch insoweit bestehen Bedenken, ob die Angaben des Zeugen Mü. zuverlässig sind. Zunächst hat der Zeuge nicht erläutert, woher er die sichere Überzeugung gewonnen hat, dass die Opfer Juden gewesen sind. Kein sonstiger Zeuge hat bestätigt, dass Juden, die im Rahmen der "Endlösung der Judenfrage" nach Auschwitz transportiert worden sind, auch im Hof zwischen Block 10 und 11 erschossen worden sind. Möglicherweise hat der Zeuge Polen, die vom RSHA oder Gestapoleitstellen auf Grund von Polizeistandgerichtsurteilen zur "Liquidierung" nach Auschwitz gebracht worden sind, als Juden angesehen. Ferner hat der Zeuge Mü. den Angeklagten Dylewski damals nicht dem Namen nach gekannt. Er hat erklärt, dass der SS-Unterscharführer, der dem Angeklagten St. bei den Erschiessungen geholfen habe, Klaus geheissen habe. Klaus habe eine Monteuruniform angehabt.
Der Angeklagte Dylewski hiess zwar mit Vornamen Klaus. In Auschwitz gab es aber noch - wie oben schon ausgeführt - einen SS-Oberscharführer Clausen und einen SS-Angehörigen namens Klaus. Möglicherweise verwechselt der Zeuge Philipp Mü. den Angeklagten Dylewski mit einem dieser beiden. Dass der Oberscharführer Clausen häufig bei Erschiessungen anwesend gewesen ist, ist anzunehmen, da er einige Zeit die Funktionen eines Rapportführers inne hatte. Wie der Zeuge P. glaubhaft bekundet hat, war der Angeklagte Dylewski im HKB unter seinem Nachnamen bekannt. Man habe zwar im HKB seinen Vornamen (Klaus) gewusst, habe ihn aber, wenn man über ihn gesprochen habe, nur mit seinem Nachnamen genannt. Der Zeuge meint, wenn Häftlinge gesagt hätten, "der Klaus geht wieder in den Bunker, da müsse wieder etwas los sein", so sei anzunehmen, dass es sich dabei um Clausen gehandelt habe. Allerdings könne er nicht ausschliessen, dass damit auch irgendein anderer SS-Mann gemeint gewesen sein könnte.
Diese Auffassung des ausserordentlich zuverlässigen Zeugen P. zeigt immerhin, dass eine Verwechslungsmöglichkeit besteht. Der Zeuge Philipp Mü. will allerdings den Angeklagten Dylewski in der Hauptverhandlung als den "Klaus" wiedererkannt haben. Dem Schwurgericht erscheint dieses Wiedererkennen jedoch problematisch. Der Zeuge hat mit dem Klaus - anders als mit dem Angeklagten St. - keinen näheren Kontakt gehabt. Es erscheint nicht sicher, dass die Erinnerung des Zeugen an den SS-Mann, den er vor über zwanzig Jahren gesehen hat, ganz zuverlässig ist. Bedenken bestehen vor allem deswegen, weil - wie der Zeuge Philipp Mü. bekundet hat - die Angehörigen des Fischelkommandos dem Zeugen Mü. nach seinem Weggang vom Stammlager später erzählt haben, dass "Klaus" die Funktionen des Angeklagten St. übernommen habe, nachdem St. von Auschwitz weggekommen sei. Dylewski ist jedoch nie Nachfolger des Angeklagten St., nämlich Leiter der Aufnahmeabteilung der Politischen Abteilung gewesen. Das spricht dafür, dass die Angehörigen des Fischelkommandos, zu dem auch der Zeuge Philipp Mü. eine Zeitlang gehört hat, einen anderen
SS-Mann als den Angeklagten Dylewski als Klaus bezeichnet haben und dass der Zeuge Mü. beim angeblichen Wiedererkennen des Angeklagten Dylewski, den er möglicherweise schon in Zeitungen oder Zeitschriften abgebildet gesehen hat, einer Täuschung unterliegt.
Aus der Aussage des Zeugen Philipp Mü. konnte daher das Schwurgericht bezüglich des Angeklagten Dylewski keine sicheren Feststellungen treffen.
Im übrigen muss es auch offen bleiben, welches die Hintergründe für die Erschiessungen gewesen sind, so dass keine sicheren Feststellungen bezüglich der äusseren und inneren Tatseite getroffen werden können. Jedenfalls erscheint es nach der Aussage des Zeugen Philipp Mü. ausserordentlich unwahrscheinlich, dass Mü. Exekutionen nach sog. Bunkerentleerungen gesehen hat.
Der Zeuge Fa. hat folgenden Vorfall geschildert: Im Herbst 1943 habe er eine Exekution im Hof zwischen Block 10 und 11 vom Block 10 aus beobachtet. Eine Frau aus dem Block 10 habe ihm gesagt, dass auf dem Hof zwischen Block 10 und 11 eine ganze Familie stehe. Er habe dann einen etwa 34jährigen Mann, eine junge Frau, ein kleines Kind im Alter von etwa einem Jahr, das die Frau auf dem Arm getragen habe und einen kleinen Jungen, den der Mann an der Hand gehalten habe, auf dem Hof stehen sehen. Die Personen hätten etwa eine halbe Stunde gewartet. Dann sei ein SS-Mann gekommen und habe das kleine Kind in den Kopf geschossen. Die Mutter sei daraufhin zusammengebrochen. Der SS-Mann habe hierauf die Mutter erschossen. Der 34jährige Mann habe sich dann hingekniet und sei ebenfalls erschossen worden. Zuletzt habe der SS-Mann den Jungen getötet.
Der Zeuge Fa. erklärte dann, indem er auf den Angeklagten Dylewski zeigte, dieser Angeklagte sei der Schütze gewesen. Er habe ihn damals in Auschwitz nur unter dem Namen "Klaus" gekannt. Er habe ihn oft auf Block 11 gehen sehen. Die Häftlinge hätten ihn Klaus genannt. Er erkenne jetzt das Gesicht wieder.
Der Zeuge Fa. hat einen ruhigen und glaubwürdigen Eindruck hinterlassen. Seine Aussage war klar, ruhig, sachlich und bestimmt. Das Schwurgericht hat keinen Zweifel, dass sich der vom Zeugen Fa. geschilderte Vorfall tatsächlich abgespielt hat. Das Gericht hatte auch den Eindruck, dass der Zeuge davon überzeugt war, in dem Angeklagten Dylewski den damaligen SS-Mann, der die Familie erschossen hat, wiederzuerkennen. Gleichwohl bleiben letzte Zweifel, ob der Angeklagte Dylewski damals tatsächlich diese Erschiessung durchgeführt hat. Die Beobachtungsmöglichkeit des Zeugen Fa. aus Block 10 war nur beschränkt. Vor den Fenstern des Blockes 10 waren Bretter angebracht worden, um Neugierigen die Sichtmöglichkeit auf den Hof zwischen Block 10 und 11 zu nehmen. Der Zeuge Fa. konnte daher allenfalls durch Ritzen oder Astlöcher auf den Hof schauen. Hinzu kommt, dass Beobachtungen aus Block 10 streng verboten waren. Im Block 10 galten verschärfte Sicherungsbestimmungen. Wer entgegen dem strengen Verbot durch die Ritzen oder Astlöcher der Bretter sah, musste bei Entdeckung mit schweren Strafen rechnen. Eine ruhige Beobachtung war daher kaum möglich. Der Beobachter musste ständig darauf bedacht sein, sich gegen solche Entdeckungen abzusichern. Geräuschen und Bewegungen im Block 10 musste er seine angespannte Aufmerksamkeit widmen, um beim Nähern von SS-Angehörigen sofort unauffällig verschwinden zu können. In einer solchen Situation erscheint es nicht sicher, dass der Zeuge Fa. bereits damals den SS-Schützen, den er nur aus einer gewissen Entfernung sehen konnte, einwandfrei identifiziert hat. Möglicherweise hat er bereits damals den SS-Mann, der vielleicht fremd für ihn war, bei der beschränkten Beobachtungsmöglichkeit guten Glaubens für einen bekannten SS-Mann, den er unter dem Namen Klaus kannte, gehalten. Diese Fehlerquelle lässt sich nach Auffassung des Gerichts nicht mit Sicherheit ausschliessen.
Es lässt sich aber auch bei dem Zeugen Fa. trotz des guten Eindrucks, den er in der Hauptverhandlung gemacht hat, nicht mit letzter Sicherheit feststellen, dass er in dem Angeklagten Dylewski völlig irrtumsfrei den SS-Mann wiedererkannt hat, den er in Auschwitz unter dem Namen Klaus gekannt hat. Insoweit kann auf die obigen Ausführungen beim Zeugen Mü. Bezug genommen werden. Letzte Zweifel, dass auch der Zeuge Fa. einer Täuschung aus nicht näher zu erforschenden Gründen unterliegt, lassen sich daher nicht ausräumen.
Im übrigen sei noch darauf hingewiesen, dass Bedenken bestehen, ob dieser vom Zeugen Fa. geschilderte Fall vom Eröffnungsbeschluss erfasst ist. Nach Ansicht des Schwurgerichts ist dies entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft nicht der Fall. Im Eröffnungsbeschluss wird dem Angeklagten Dylewski unter Ziffer 4 zur Last gelegt, Häftlinge durch Erschiessen an der sog. Schwarzen Wand im Hof zwischen Block 10 und 11 getötet zu haben obwohl - wie er gewusst habe - gegen diese Häftlinge kein rechtmässiges Todesurteil vorgelegen habe.
Der vom Zeugen Fa. geschilderte Fall war bei Anklageerhebung und bei Erlass des Eröffnungsbeschlusses noch nicht bekannt. Er ist erstmalig vom Zeugen Fa. in der Hauptverhandlung geschildert worden. Den Erschiessungen unter Ziffer 4 des Eröffnungsbeschlusses (betr. den Angeklagten Dylewski) liegen daher andere geschichtliche Vorgänge zugrunde.
Das wird zudem deutlich aus der Formulierung des Punktes 4 des Eröffnungsbeschlusses, wonach es sich bei den Opfern um Häftlinge, also Lagerinsassen, und um Erschiessungen an der Schwarzen Wand, also nicht um eine Erschiessung in der Mitte des Hofes gehandelt haben soll.
Bei den vier Personen, die nach der Schilderung des Zeugen Fa. erschossen worden sind, handelt es sich aber offensichtlich um Zivilisten. Die Erschiessung selbst fand nicht an der Schwarzen Wand, sondern im Hof zwischen Block 10 und 11 statt.
Schliesslich hat der Zeuge Fab. geschildert, dass der Angeklagte Dylewski im Jahre 1943 eine jüdische Familie, bestehend aus einem Mann, einer Frau und einem Kind zur Schwarzen Wand gebracht und dort erschossen habe. Auch der Zeuge Fab. kannte den Angeklagten Dylewski in Auschwitz nicht dem Namen nach. Er will ihn aber in der Hauptverhandlung als den SS-Mann wiedererkannt haben, der damals die jüdische Familie erschossen habe.
Auch hier bestehen jedoch Bedenken, ob die Erinnerung des Zeugen Fab. zuverlässig ist und er den Angeklagten Dylewski irrtumsfrei identifiziert hat.
Der Zeuge will den Angeklagten Dylewski im Jahre 1943 auch bei Vergasungen gesehen haben, wenn er - der Zeuge - als Leichenträger Leichen zum Krematorium gebracht habe. Allerdings wisse er nicht - so hat er angegeben - was Dylewski dort gemacht habe. Der Zeuge will im Krematorium vergaste Leichen vorgefunden haben.
Das erscheint wenig glaubhaft. Im kleinen Krematorium wurden, soweit das feststellbar war, im Jahre 1943 keine Vergasungen mehr durchgeführt. Zu dieser Zeit waren bereits die vier neuen Krematorien im Betrieb. Zuvor dienten - ab Sommer 1942 - die umgebauten Bauernhäuser als Vergasungsräume. Fiel eines der vier Krematorien aus, so wurde das eine der beiden umgebauten Bauernhäuser noch weiter als Bunker V zu Vergasungen benutzt. Sollte aber der Zeuge eines der Krematorien in Birkenau gemeint haben, so erscheint seine Aussage noch weniger glaubhaft. Denn bei den strengen Geheimhaltungs- und Sicherungsvorschriften ist nicht anzunehmen, dass man die Leichenträger aus dem Stammlager die vergasten Leichen in den Vergasungsräumen hat sehen lassen. Dagegen spricht eindeutig, dass das jüdische Sonderkommando, das die Leichen aus den Vergasungsräumen zu den Verbrennungsöfen transportieren und dort verbrennen musste, streng isoliert von den anderen Lagerinsassen gehalten wurde. Auch war nach dem Bau der vier Krematorien ein besonderes SS-Kommando zur Bewachung der Krematorien eingesetzt, dass alle Unbefugten, auch SS-Angehörige aus dem Krematoriumsbereich fernhielt. Insoweit muss daher der Zeuge einer Täuschung unterliegen.
Der Zeuge Fab. hat auch den Angeklagten Broad schwer belastet. Auch den Angeklagten Broad will er in der Hauptverhandlung wiedererkannt haben. Auch insoweit hat das Schwurgericht, was hier schon vorweggenommen sei, Bedenken, ob der Zeuge Fab. den Angeklagten Broad zuverlässig wiedererkannt hat.
Der Zeuge Fab. kannte den Angeklagten Broad im KL Auschwitz ebenfalls nicht dem Namen nach. Nach seiner Vernehmung in der Hauptverhandlung wurde er von dem Vertreter der Nebenkläger, Rechtsanwalt Or. befragt, ob er die SS-Männer Dylewski und Broad kenne. Der Zeuge verneinte dies. Er fügte jedoch hinzu, dass junge SS-Männer aus der Politischen Abteilung ebenfalls an der Schwarzen Wand geschossen hätten. Bei der Gegenüberstellung des Zeugen mit den Angeklagten glaubte dann der Zeuge Fab., den Angeklagten Broad - ebenso wie den Angeklagten Dylewski - von damals her zu kennen bzw. wiederzuerkennen. Er erklärte dann weiter, dass Broad geschossen habe, wenn Frauen zu erschiessen gewesen seien. Er habe bei Erschiessungen am linken Flügel der angetretenen SS-Männer gestanden. Häufig habe er auch selbst geschossen. Einmal seien Frauen erschossen worden. Broad habe zunächst nicht geschossen. Dann habe er gerufen: "Warte einmal, das ist eine Junge, die werde ich erschiessen." Er sei dann vorgelaufen und habe ein Gewehr genommen und nicht nur diese, sondern weitere Frauen erschossen. Das sei im Sommer 1944 gewesen. Woher die Frauen gekommen seien, wisse er nicht. Sie seien aus dem Block 11 herausgeführt worden. Viele Frauen seien hingerichtet worden.
Auch in bezug auf den Angeklagten Broad hat das Gericht jedoch Zweifel, ob der Zeuge den Angeklagten Broad irrtumsfrei wiedererkannt hat. Der Zeuge Fab. war nach seiner Bekundung als Leichenträger eingesetzt. Er hatte bei Erschiessungen die Leichen der Erschossenen von der Schwarzen Wand zur Mauer des Blockes 10 zu tragen. Das musste sehr schnell gehen. Für genaue Beobachtungen blieb dabei nicht sehr viel Zeit. Der Zeuge hat Schreckliches erlebt. Darunter hat er ohne Zweifel schwer gelitten. Das war ihm noch in der Hauptverhandlung anzumerken. Das Schwurgericht hat Bedenken, ob die Erinnerung des Zeugen alle Einzelheiten des damaligen Geschehens, insbesondere, was die Personen der Beteiligten betrifft, noch genau wiedergibt. Zweifel an der Zuverlässigkeit seines Gedächtnisses ergeben sich aus folgendem: Bei seiner Vernehmung in Prag, bei der er übrigens diesen Vorfall nicht erwähnt hat, hat der Zeuge angegeben, dass er im Herbst 1943 nach Auschwitz gekommen sei. In der Hauptverhandlung hat er bekundet, er sei bereits im Herbst 1942 nach Auschwitz gebracht worden. Dort sei er nur eine Woche im Stammlager geblieben, dann sei er nach Buna gekommen. Von dort sei er im Frühjahr 1943 in das Stammlager zurückgekommen und dem Leichenträgerkommando zugeteilt worden. Bei den Erschiessungen will der Zeuge auch den Rapportführer Palitzsch gesehen haben. Palitzsch hat zwar in der ersten Zeit (1941 und 1942) zahlreiche Erschiessungen eigenhändig durchgeführt. Im Frühjahr 1943 kam er jedoch zusammen mit dem Angeklagten Hofmann als Rapportführer in das Lager Birkenau. Es ist daher unwahrscheinlich, wenn auch nicht unmöglich, dass Palitzsch danach noch an Erschiessungen an der Schwarzen Wand im Stammlager teilgenommen hat.
Der Zeuge Fab. glaubte auch, den Angeklagten Mulka bei Erschiessungen an der Schwarzen Wand gesehen zu haben. Insoweit dürfte sich aber der Zeuge mit grosser Wahrscheinlichkeit irren. Denn der Angeklagte Mulka kam bereits vor Beginn des Frühjahrs 1943, nämlich am 9.3.1943, von Auschwitz weg. Ferner hat der Zeuge Fab. bei der Gegenüberstellung mit den Angeklagten den Angeklagten Boger zunächst als den Angeklagten Schlage bezeichnet, hat sich dann allerdings verbessert. Auch das zeigt, dass das Erinnerungsbild des Zeugen nach zwanzig Jahren nicht mehr so zuverlässig ist, und dass er die Physiognomien der an den Erschiessungen Beteiligten nicht mehr ganz sicher im Gedächtnis hat, ganz abgesehen davon, dass sich die Angeklagten im Laufe der zwanzig Jahre verändert haben. Denn den Angeklagten Boger will er auch dem Namen nach in Auschwitz gekannt und oft bei Erschiessungen gesehen haben. Weitere Bedenken, ob der Zeuge Fab. tatsächlich den Angeklagten Broad bei Erschiessungen von Frauen im Hof zwischen Block 10 und 11 gesehen hat, bestehen deswegen, weil der Angeklagte Broad von Frühjahr 1943 bis mindestens zum 1.8.1944, wahrscheinlich aber noch länger, als Angehöriger der Politischen Abteilung im Zigeunerlager in Birkenau tätig gewesen ist. Er hatte dort sein Dienstzimmer in einer Baracke vor dem Zigeunerlager und hielt sich tagsüber in Birkenau auf. Es ist daher unwahrscheinlich, dass er zu Erschiessungen im Stammlager herangezogen worden ist.
Ferner hat der Zeuge Sm. bekundet, dass ab Februar 1944 keine Erschiessungen mehr im Hof zwischen Block 10 und 11 stattgefunden hätten. Von diesem Zeitpunkt an seien die Erschiessungen nur noch an der Sauna in Birkenau durchgeführt worden. Die Schwarze Wand wurde nach der glaubhaften Bekundung des Zeugen Pi. abgerissen, nachdem Liebehenschel Kommandant von Auschwitz geworden war (November 1943). Nach dem Wechsel der Kommandanten hörten nach der Bekundung des Zeugen Pi. die Erschiessungen auf Block 11 auf. Diese Angaben decken sich in etwa mit den Bekundungen des Zeugen Sm.
Somit erscheinen die Angaben des Zeugen Fab., dass noch im Sommer 1944 Frauen auf dem Hof zwischen Block 10 und 11 erschossen worden seien, unrichtig. Der Zeuge irrt sich zumindest in der Zeit. Wenn diese Erschiessungen aber früher waren, erscheint es unwahrscheinlich, dass Broad an ihnen teilgenommen hat, weil er im Lager Birkenau dienstlich tätig war.
Im übrigen hat kein anderer Zeuge von diesen vom Zeugen Fab. geschilderten Erschiessungen der Frauen und von dem auffälligen Benehmen des Angeklagten Broad dabei berichtet. Der Zeuge Pi., der von Dezember 1942 bis Mai 1944 Blockschreiber im Block 11 gewesen ist, hätte eigentlich davon etwas wissen müssen, wenn sie in dieser Zeit stattgefunden hätten. Dass sie nicht mehr nach dem Weggang Pi's stattgefunden haben können, ergibt sich aus den Aussagen der Zeugen Sm. und Pi.
Aus all diesen Gründen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Zeuge Fab., der an sich einen guten Eindruck auf das Gericht gemacht hat, einem Irrtum zum Opfer gefallen ist und möglicherweise Erschiessungen mit den Angeklagten Dylewski und Broad in Verbindung bringt, die zu anderen Zeiten und unter Beteiligung anderer SS-Angehöriger stattgefunden haben. Das Schwurgericht konnte daher auf Grund der Aussage des Zeugen Fab. keine für die Angeklagten Dylewski und Broad nachteiligen Feststellungen treffen.
Zusammenfassend lassen sich somit aus den Aussagen der Zeugen Gl., Philipp Mü., Fa. und Fab. keine sicheren Feststellungen bezüglich des Angeklagten Dylewski treffen.
Da es nicht möglich war, festzustellen, wie oft der Angeklagte Dylewski an Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen teilgenommen hat, weil zuverlässige Zahlenangaben fehlen, hat sich das Schwurgericht darauf beschränkt, Mindestzahlen festzustellen. Nach der eigenen Einlassung des Angeklagten Dylewski hat er in mindestens drei Fällen, also an drei verschiedenen Tagen, sowohl an Bunkerentleerungen als auch an den anschliessenden Erschiessungen in der oben geschilderten Art und Weise teilgenommen, so dass dies mit Sicherheit den tatsächlichen Feststellungen zugrunde gelegt werden konnte. Die Feststellungen, dass an diesen drei verschiedenen Tagen je mindestens zehn Häftlinge erschossen worden sind, beruht ebenfalls auf der Einlassung des Angeklagten Dylewski. Nach der Überzeugung des Gerichts ist das die Mindestzahl der an diesen drei Tagen jeweils getöteten Häftlinge.
IV. Rechtliche Würdigung
1. Zu II.1.
Der Angeklagte Dylewski hat in den festgestellten mindestens zwei Fällen die Mordtaten der Haupttäter (vgl. oben A.V.1.) dadurch gefördert, dass er nach der Ankunft der für die Vernichtung bestimmten RSHA-Transporte auf der Rampe die unter II.1. geschilderten Tätigkeiten ausgeübt hat. Er war ein Glied in dem gesamten Vernichtungsapparat und hat im Zusammenwirken mit anderen SS-Angehörigen zu dem reibungslosen Ablauf der Vernichtungsaktionen beigetragen und zum Tode von mindestens je 750 Menschen einen kausalen Tatbeitrag geleistet. Da er auf Befehl seiner Vorgesetzten Rampendienst versehen hat, ist seine strafrechtliche Verantwortlichkeit im Rahmen des §47 MStGB zu beurteilen. Dylewski hat klar erkannt, dass die gegebenen Tötungsbefehle verbrecherisch waren und die Massentötung der unschuldigen jüdischen Menschen ein allgemeines Verbrechen darstellte. Das hat er selbst bei seiner Einlassung eingeräumt. Im übrigen gilt auch bei dem Angeklagten Dylewski das gleiche, was oben bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Mulka unter A.V.2. ausgeführt worden ist.
Der Angeklagte Dylewski ist daher für seine befohlene Mitwirkung bei der Massentötung jüdischer Menschen strafrechtlich verantwortlich. Es konnte jedoch nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass er die Tötung der jüdischen Menschen als eigene Taten gewollt hat. Ein besonderer Eifer des Angeklagten Dylewski beim Rampendienst konnte nicht festgestellt werden. Er hat nur das getan, was ihm befohlen war. Auch ein eigenes persönliches Interesse des Angeklagten an der Massentötung der Juden war nicht ersichtlich. Sein sonstiges Verhalten im KL Auschwitz lässt ebenfalls keine Schlüsse auf einen Täterwillen zu. Das Schwurgericht konnte daher nur feststellen, dass er die Mordtaten der Haupttäter befehlsgemäss fördern und unterstützen wollte. Seine Tatbeiträge konnten daher nur als Beihilfehandlungen gewertet werden.
Der Angeklagte Dylewski, für dessen Mitwirkung an der Massentötung jüdischer Menschen keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich sind, hat auch vorsätzlich gehandelt. Er hat - wie unter II.1. festgestellt worden ist - gewusst, dass er die Mordtaten der Haupttäter an den unschuldigen jüdischen Menschen durch seine Tätigkeiten im Rahmen des von ihm ausgeübten Rampendienstes förderte und somit einen kausalen Tatbeitrag leistete. Das wollte er auch. Ferner waren ihm die gesamten Tatumstände bekannt, die die Beweggründe für die Tötungen der Juden als niedrig und die Art der Ausführung als heimtückisch und grausam kennzeichneten.
Dass er auch das Bewusstsein gehabt hat, Unrecht zu tun, ergibt sich schon aus dem vorher Gesagten, dass er nämlich die Befehle der Haupttäter als verbrecherisch erkannt und auch gewusst hat, dass die Tötung unschuldiger Menschen ein allgemeines Verbrechen ist.
Irgendwelche Umstände, aus denen er hätte entnehmen können, dass seine Mitwirkung gerechtfertigt sei, lagen nicht vor. Er hat auch nicht irrig das Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen eines Rechtfertigungsgrundes angenommen. Das behauptet er selbst nicht. Schliesslich hat er auch nicht irrig angenommen, dass die verbrecherischen Befehle für ihn bindend gewesen seien. Hierzu kann auf die Aufführung unter A.V.2. Bezug genommen werden.
Dem Angeklagten Dylewski ist die Mitwirkung bei der Massentötung der RSHA-Juden nicht durch eine wirkliche oder vermeintliche Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben abgenötigt worden. Er beruft sich selbst nicht darauf, dass sein Wille gebeugt worden sei. Er ist gar nicht auf die Idee gekommen, sich den verbrecherischen Befehlen seiner Vorgesetzten zu entziehen oder ihre Ausführung abzulehnen. Wie die anderen SS-Angehörigen hat er sein Gewissen zum Schweigen gebracht und getreu dem in der SS herrschenden Prinzip des blinden Gehorsams alles ausgeführt, was ihm befohlen worden ist im Vertrauen darauf, dass er wegen seiner Mitwirkung an den Verbrechen nicht zur Verantwortung gezogen werden könne. Er hat auch nie einen Versuch gemacht, sich vom Rampendienst zu "drücken" oder davon befreit zu werden.
Sonstige Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich.
Er war daher wegen seiner Mitwirkung an der Vernichtung von mindestens zwei RSHA-Transporten wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in zwei Fällen (§§47, 49, 211, 74 StGB) begangen jeweils in gleichartiger Tateinheit an je mindestens 750 Menschen (§73 StGB) zu bestrafen.
2. Zu II.2.
Wie schon unter C.V.3. ausgeführt worden ist, war die Tötung der Häftlinge nach sog. Bunkerentleerungen Mord. Der Angeklagte Dylewski hat diese Mordtaten in den festgestellten Fällen gefördert und hierzu einen kausalen Beitrag geleistet, indem er über die Fälle der von ihm eingelieferten Häftlinge referiert hat in dem Bewusstsein, dass viele dieser Häftlinge von Grabner zum Tode bestimmt werden würden und indem er ferner die von Grabner zum Erschiessen ausgewählten Häftlinge zur Gruppe der Todeskandidaten gestellt und darüber gewacht hat, dass sie sich nicht mehr durch irgendwelche Manipulationen ihrem von Grabner bestimmten Schicksal entziehen konnten. Seine Anwesenheit im Arrestbunker diente ebenso wie die aller anderen SS-Angehörigen dazu, den Häftlingen klar zu machen, dass ein verzweifelter Aufstand sinnlos sei. Die ihm übertragenen Abschirm- und Sicherungsaufgaben dienten dem reibungslosen Ablauf der Erschiessungsaktionen. Durch die Ausübung dieses Abschirm- und Sicherungsdienstes leistete er somit ebenfalls einen kausalen Beitrag zu den Mordtaten. All dies war dem Angeklagten Dylewski auch bewusst.
Der Angeklagte Dylewski hat an den Bunkerentleerungen und nachfolgenden Erschiessungen auf Befehl Grabners, seines unmittelbaren Vorgesetzten, teilgenommen. Die Frage, ob er sich strafbar gemacht hat oder ob nur Grabner als sein Vorgesetzter für diese Taten strafrechtlich verantwortlich ist, muss daher ebenfalls im Rahmen des §47 MStGB geprüft werden.
Der Angeklagte Dylewski hat nach der Überzeugung des Gerichts klar erkannt, dass die ihm von Grabner gegebenen Befehle, an diesen Bunkerentleerungen und den anschliessenden eigenmächtig angeordneten Erschiessungen in der geschilderten Art und Weise teilzunehmen, ein allgemeines Verbrechen bezweckten. Oben ist im einzelnen dargelegt worden, dass der Angeklagte Dylewski wusste, dass weder Gerichtsurteile noch Befehle höherer Dienststellen den Erschiessungen zugrunde lagen und dass seine Behauptung, er habe dies nicht gewusst, nur eine Schutzbehauptung ist. Wie alle anderen SS-Angehörigen wusste er, dass weder Grabner noch Aumeier befugt waren, selbständig und eigenmächtig die Tötung von Häftlingen zu befehlen. Denn er war wie alle anderen SS-Angehörigen im KL Auschwitz darüber belehrt worden, dass niemand im Lager solche Tötungen eigenmächtig anordnen durfte. Auch die gesamten Begleitumstände, unter denen diese Tötungen vollzogen wurden, nämlich das Verfahren im Arrestbunker bei der Auswahl der zu erschiessenden Häftlinge, die Art und Weise, wie die Häftlinge getötet wurden und schliesslich die Art, wie diese Taten dann verschleiert wurden, mussten ihm die Erkenntnis aufdrängen, dass die Erschiessungen verbrecherisch waren. Ihn trifft daher für seine Mitwirkung die Strafe des Teilnehmers.
Auch hier konnte nicht festgestellt werden, dass der Angeklagte Dylewski die Tötung der Häftlinge zu seiner eigenen Sache gemacht, somit mit Täterwillen gehandelt hat. Anders als beim Angeklagten Boger konnte nicht festgestellt werden, dass der Angeklagte Dylewski mit besonderem Eifer an dem Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen teilgenommen hat oder von sich aus Häftlinge zum Erschiessen vorgeschlagen oder ausgesucht hätte. Auch hat er nicht mit dem gleichen Eifer wie Boger im Lager Häftlinge wegen irgendwelcher Vergehen aufgespürt und in den Bunker eingeliefert. Er hat die Häftlinge nicht - wie der Angeklagte Boger - im Lager in Angst und Schrecken versetzt. Der Zeuge P., der durch sein ausgezeichnetes Gedächtnis alle Prozessbeteiligten in Erstaunen versetzt hat, weil er noch von vielen Häftlingen die Häftlingsnummer kannte, und vollen Glauben verdient, hat Dylewski relativ gut beurteilt. Er hat bekundet, dass Dylewski kein Schläger gewesen sei. Der Zeuge Dr. Hun. hat von einem Gespräch berichtet, das zwischen dem Generalbevollmächtigten der Kruppwerke Beitz und dem jetzigen polnischen Ministerpräsidenten Cyrankiewicz nach einer Verhandlung über andere Fragen über den Angeklagten Dylewski geführt worden ist. Der polnische Ministerpräsident, der im KL Auschwitz als Häftling gewesen ist, hat bei diesem Gespräch nach der glaubhaften Aussage des Zeugen Dr. Hun. in bezug auf den Angeklagten Dylewski geäussert, dass der Mann (Dylewski) ihn hätte töten können, wenn er es gewollt hätte. Das habe er jedoch nicht getan. Wenn er - Cyrankiewicz - jetzt noch lebe, so habe er das ihm (Dylewski) zu verdanken.
Das Gericht hat daraus in Verbindung mit der Einlassung des Angeklagten Dylewski den Schluss gezogen, dass der Angeklagte Dylewski in Auschwitz den jetzigen polnischen Ministerpräsidenten als Häftling vernommen, aber dafür gesorgt hat, dass er nicht erschossen worden ist. Die Staatsanwaltschaft hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, Dylewski habe demnach doch eine Entscheidungsbefugnis über Leben und Tod eines Häftlings gehabt. Dieser Auffassung hat sich das Gericht jedoch nicht anschliessen können. Es ist durchaus denkbar, dass Dylewski nur die Möglichkeit gehabt hat, durch eine gute Beurteilung oder durch eine relativ harmlose Darstellung des Ermittlungsergebnisses einen Häftling vor dem Bunker und damit vor einer evtl. späteren Erschiessung zu retten. Damit ist jedoch nicht gesagt, dass Dylewski überhaupt keine Häftlinge in den Bunker hätte einliefern brauchen oder dass er in jedem Fall hätte damit rechnen müssen, dass ein in den Bunker eingelieferter Häftling getötet werden würde. Auch steht damit keineswegs fest, dass Dylewski tatsächlich bei Bunkerentleerungen eigenmächtig und selbständig Häftlinge für den Tod bestimmt hätte. Im übrigen konnte der Angeklagte Dylewski als Angehöriger der Politischen Abteilung in Fluchtfällen, wenn nichtdeutsche Häftlinge nach gelungener Flucht wieder ergriffen worden waren, die betreffenden Häftlinge kaum vor dem Bunker bewahren, da insoweit der Tatbestand klar lag.
Auch der Zeuge Pi. hat bekundet, dass er dem Angeklagten Dylewski das Leben verdanke. Der Zeuge hat als Blockschreiber im Block 11 andere Häftlinge vor einem Spitzel, dem bereits erwähnten Lewandowski, gewarnt. Unter den Häftlingen, die er gewarnt hatte, befand sich ebenfalls ein Spitzel, der dem Angeklagten Dylewski von dieser Warnung berichtete. Dylewski fragte daraufhin am nächsten Tag den Zeugen Pi., was er für Dummheiten im Lager erzähle. Im übrigen liess er die Sache auf sich beruhen. Nach den damaligen Gepflogenheiten in der Politischen Abteilung - so meinte der Zeuge Pi. - hätte er wegen dieser Warnung sein Leben verwirkt gehabt. Wenn ihm nichts passiert sei, so verdanke er das dem Angeklagten Dylewski.
Auch der Zeuge Ber. (früher Berx.), der durch das Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Melbourne am 2.4.1962 vernommen worden ist, hat bekundet, Dylewski habe sich, als er - Ber. - von ihm - Dylewski - wegen eines Fluchtversuches als Häftling vernommen worden sei, korrekt verhalten. Er - Ber. - habe nie von anderen Häftlingen gehört, dass Dylewski sich bei Vernehmungen unmenschlich verhalten habe. Auch sonst habe er nichts von Misshandlungen oder Tötungen durch Dylewski gehört. Das Protokoll über die Vernehmung des Zeugen ist in der Hauptverhandlung verlesen worden, ebenso das Protokoll über seine Vereidigung durch das deutsche Konsulat vom 25.1.1965. Das Gericht hat keine Veranlassung, den Angaben dieses Zeugen zu misstrauen, zumal er den Angeklagten Boger belastet hat. Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, warum der Zeuge, der in Auschwitz als Häftling ein schweres Leben gehabt hat, den Angeklagten Dylewski wahrheitswidrig hätte entlasten sollen.
Schliesslich hat der Zeuge Bur. erklärt, dass Dylewski im Gegensatz zu Boger bei Vernehmung humaner gewesen sei. Er habe die Menschen bei Vernehmungen in der Politischen Abteilung nicht gefoltert oder getötet. Allerdings hat der Zeuge hinzugefügt, Dylewski habe die Menschen "mit dem Bleistift getötet", er habe "Todesurteile mit dem Bleistift so hingeschrieben". Dabei handelte es sich aber offensichtlich um eine Schlussfolgerung des Zeugen. Dylewski hat ohne Zweifel viele Häftlinge nach durchgeführten Ermittlungen und Vernehmungen in den Block 11 eingewiesen. Damit bestand - wie allen Lagerinsassen bekannt war - die Gefahr, dass sie bei einer Bunkerentleerung getötet werden könnten. Insofern kam die Einweisung in den Arrestbunker aus der Sicht der Häftlinge fast einem Todesurteil gleich. Der Zeuge hat seine Behauptung, dass Dylewski die Menschen mit dem Bleistift getötet habe, auch nur auf die Tatsache gestützt, dass Häftlinge aus dem Vernehmungszimmer Dylewskis herausgekommen seien und gesagt hätten, sie seien zum Tode verurteilt, sie kämen auf Block 11. Daraus ist ersichtlich, dass die Häftlinge die Einweisung in den Block 11 einem Todesurteil gleichgeachtet haben - so auch der Zeuge Bur. - ohne dass jedoch feststeht, dass Dylewski tatsächlich auch selbst den Tod dieser Häftlinge als eigene Tat gewollt hat. Denn es war nicht möglich, aufzuklären, ob es immer in der Macht des Angeklagten Dylewski stand, die Häftlinge vor dem Arrestbunker zu bewahren, wenn seine Vernehmungen und Ermittlungen ein bestimmtes aktenkundiges Ergebnis gehabt hatten. Es steht auch nicht fest, ob der Angeklagte Dylewski bei Einweisungen in den Arrestbunker stets mit der Tötung des von ihm eingewiesenen Häftlings gerechnet und dies von vornherein billigend in Kauf genommen hat. Immerhin sind bei weitem nicht alle in den Arrestbunker eingewiesenen Häftlinge getötet worden.
Schliesslich sprechen auch weitere Umstände dagegen, dass Dylewski die Erschiessungen nach Bunkerentleerungen zu seiner eigenen Sache gemacht und sie als eigene Taten gewollt hat. So hat die Zeugin Ruth Dylewski, die frühere geschiedene Ehefrau des Angeklagten Dylewski, die auf das Gericht einen glaubwürdigen Eindruck gemacht hat, bekundet, dass sich ihr früherer Ehemann im KL Auschwitz nicht wohl gefühlt habe. Er habe nach seiner Versetzung nach Auschwitz einen deprimierten Brief geschrieben. Er sei ziemlich verbittert gewesen. Von Anfang an habe er sich bemüht, von Auschwitz wegzukommen. Schliesslich sei ihm das im Jahre 1944 gelungen. In seinen Briefen habe er immer wieder geäussert, dass für ihn ein Bleiben in Auschwitz unerträglich sei. Infolge der Erlebnisse in Auschwitz habe er ein Nervenleiden bekommen, das zu nächtlichen Anfällen geführt habe. Vorher sei er gesund gewesen.
Die Angaben der Zeugin werden in gewisser Hinsicht bestätigt durch ein Schreiben, das der Angeklagte Dylewski am 3.9.1941 an die "Kameradschaft Ferdinand Schulz" und "Akaflieg in Danzig" gerichtet hat. Das Original dieses Schreibens lag dem Gericht nicht vor. Das Schreiben ist jedoch in dem 5. Rundbrief der Kameradschaft Ferdinand Schulz aus dem September 1941 wörtlich zitiert. Der Rundbrief wurde insoweit in der Hauptverhandlung verlesen.
Das Gericht hat daher keinen Zweifel, dass der Angeklagte Dylewski damals tatsächlich diesen Brief geschrieben hat. In dem Brief beklagt sich der Angeklagte Dylewski darüber, dass er nach wie vor an Auschwitz "gekettet" sei und keine Anzeichen darauf deuteten, dass er das Kriegsende an einem anderen Ort erleben solle. Wörtlich heisst es dann: "Eine einzige Chance des Wegkommens, die uns mal geboten wurde, konnte ich nicht ausnutzen, weil ich mit einer Nervengeschichte ans Bett gebunden war. Im Augenblick geniesse ich den einzigen Vorteil dieser Erkrankung, einen zweiwöchigen Erholungsurlaub."
Diese Ausführungen bestätigen die Angaben der Zeugin Ruth Dylewski, dass der Angeklagte Dylewski tatsächlich von Auschwitz von Anfang an wegwollte, und dass die Verhältnisse ihn offensichtlich nervlich stark belastet haben.
All dies spricht nicht für einen Täterwillen des Angeklagten Dylewski bei den Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen.
Allerdings haben einige Zeugen von Tötungshandlungen des Angeklagten Dylewski berichtet, die er angeblich im KL Auschwitz begangen haben soll. Diese Taten sind weder in der Anklage noch im Eröffnungsbeschluss aufgeführt. Gleichwohl musste sich das Gericht mit diesen Zeugenaussagen auseinandersetzen. Denn wären die von den Zeugen geschilderten Tatsachen erwiesen, so wären damit sehr starke Beweisanzeichen dafür gegeben, dass der Angeklagte Dylewski sowohl die Tötung der "RSHA-Juden" als auch die Tötung der im Arrestbunker ausgesuchten Häftlinge als eigene Taten gewollt hat. In keinem der von den nachfolgend aufgeführten Zeugen geschilderten Fällen konnte jedoch das Gericht die sichere Überzeugung gewinnen, dass der Angeklagte Dylewski tatsächlich der Täter gewesen ist.
Der Zeuge Doe. hat von einem Fall berichtet, der sich Ende 1943 oder Anfang 1944 abgespielt hat. Der Zeuge musste sonntags mit anderen Häftlingen Baumaterial
vom Bahnhof auf einem schmalen Weg, der von Steinblöcken umsäumt war, in das Lager Birkenau tragen. Hinter dem Zeugen ging ein Pole namens Galezowski. Unterwegs gab es eine Stockung. Die SS-Männer, die die Aufsicht führten, riefen den Häftlingen zu, sie sollten schneller gehen. Ein hinter Galezowski gehender Häftling stiess daraufhin den Galezowski von hinten an und rief, er möge schneller gehen. Galezowski, der krank und abgezehrt war, konnte jedoch seine Schritte nicht beschleunigen. Er drehte sich zu dem Häftling um und sagte ihm auf polnisch, er könne nicht schneller gehen. Hierauf tauchte ein SS-Mann, der sich hinter einem Steinblock versteckt hatte, auf und rief Galezowski zu sich. Er schlug ihn mit der Hand nieder. Hierauf befahl er Galezowski, wieder aufzustehen. Als dieser dem Befehl nachkam, schlug ihn der SS-Mann erneut und dann immer wieder, bis Galezowski nach hinten auf einen der Steinblöcke fiel. Galezowski wurde am nächsten Tag in den HKB verbracht und starb einige Tage später, wie der Zeuge Doe. von Kameraden erfahren hat.
Der Zeuge Doe. kannte den SS-Mann, der den Galezowski niedergeschlagen hat, nicht. Er meinte aber, es sei Dylewski gewesen. Denn der Blockälteste habe ihm gesagt, der Schläger sei Dylewski von der Politischen Abteilung gewesen.
Das Gericht konnte jedoch nicht die Überzeugung gewinnen, dass der Blockälteste den SS-Mann, der den Galezowski niedergeschlagen hat, richtig identifiziert hat. Denn es ist nicht sicher, dass er den Angeklagten Dylewski damals nicht mit einem anderen SS-Mann verwechselt hat. Dem Gericht fehlt jede Möglichkeit, sich davon zu überzeugen, dass der Blockälteste, dessen Namen der Zeuge Doe. nicht mehr genau in Erinnerung hatte - er meinte, er habe Kaufhold geheissen, war sich aber nicht mehr ganz sicher - den Angeklagten Dylewski genau gekannt hat. Es spricht immerhin einiges dagegen, dass der Angeklagte Dylewski der Schläger gewesen ist. Oben ist bereits angeführt worden, dass der Zeuge P. bekundet hat, dass Dylewski kein Schläger gewesen sei. Ebenso haben die Zeugen Ber. und Bur. ausgesagt, dass Dylewski bei Vernehmungen die Häftlinge nicht gefoltert und geschlagen habe. Ferner hat sich der Angeklagte Dylewski dahin eingelassen, dass er tagsüber nicht in Birkenau gewesen sei. Sonntags sei er fast nie im Lagerbereich geblieben, sondern mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Seine Einlassung erscheint insoweit nicht unbedingt unglaubhaft. Denn tatsächlich war er als Angehöriger der Politischen Abteilung nur im Stammlager beschäftigt. Kein anderer Zeuge hat bestätigt, dass Dylewski auch in Birkenau dienstlich zu tun gehabt hätte. Dort hat vielmehr der Angeklagte Broad im Zigeunerlager (B.II.e.) als Angehöriger der Politischen Abteilung deren Aufgaben wahrgenommen. Er hatte vor diesem Lagerabschnitt sein Dienstzimmer. Auch der Angeklagte Boger tauchte öfters in Birkenau auf und führte dort Ermittlungen durch. Von dem Angeklagten Dylewski ist jedoch im Zusammenhang mit dem Lager in Birkenau sonst nie die Rede gewesen.
Die frühere Ehefrau des Angeklagten Dylewski hat schliesslich bestätigt, dass sie nach der Eheschliessung mit dem Angeklagten Dylewski am 5.5.1943 nach Nikolai/Oberschlesien (in der Nähe von Auschwitz) gezogen sei und dort bis etwa Mai 1944 gewohnt habe. Ihr früherer Ehemann sei fast jedes Wochenende nach Hause gekommen. Er sei dann stets von Samstag bis Montag früh geblieben.
Die Zeugin erschien - wie oben bereits ausgeführt - glaubwürdig. Das Gericht hatte nicht den Eindruck, dass die Zeugin, die ihre Aussage mit dem Eid bekräftigt hat, ihren früheren Ehemann wahrheitswidrig entlasten wollte.
Bei Abwägung all dieser Gesichtspunkte konnte das Gericht aus der Aussage des Zeugen Doe., dem das Gericht den geschilderten Vorfall geglaubt hat, weil der Zeuge selbst einen ausgezeichneten persönlichen Eindruck hinterlassen und seine Aussage knapp, klar und präzise gemacht hat und genau zwischen dem unterschied, was er selbst erlebt und gesehen und was er von anderen erfahren hat, nicht die Überzeugung gewinnen, dass der Angeklagte Dylewski derjenige gewesen ist, der den Häftling Galezowski niedergeschlagen und seinen Tod verursacht hat.
Der Zeuge Krx. hat den Angeklagten Dylewski ebenfalls schwer belastet. Der Zeuge kam Anfang Juni 1941 nach Auschwitz und kam sofort in die Strafkompanie, die damals im Block 11 untergebracht war. Er blieb drei Monate, also bis Ende August 1941 in der SK.
Der Zeuge Krx. behauptete bei seiner Vernehmung, dass der Angeklagte Dylewski während dieser Zeit eines Abends mit zwei weiteren SS-Männern in ihren Saal hineingekommen sei, um einen Häftling abzuholen. Man habe vergessen, beim Eintritt der SS-Männer Achtung zu rufen. Deswegen habe Dylewski "Sportmachen" angeordnet. Der "Sport" sei von einem Funktionshäftling durchgeführt worden und habe eine halbe Stunde gedauert. Danach hätten sich alle Häftlinge auf den Boden legen müssen und seien mit zehn Eimern Wasser übergossen worden. Dann sei ein Fenster geöffnet worden. Ein Häftling sei daraufhin zum Fenster hinaus auf den Drahtzaun gesprungen, der mit elektrischem Strom geladen gewesen sei. Der Häftling sei sofort tot gewesen. Während der Nacht seien dann noch vier Häftlinge an den Folgen des "Sportmachens" gestorben. Dylewski habe nach dem "Sport" den einen Häftling weggeführt. Der Zeuge Krx. hat weiter behauptet, der Angeklagte Dylewski habe sich während dieser Zeit (zwischen Juni und August 1941) zusammen mit anderen SS-Führern und Unterführern, nämlich dem zweiten Schutzhaftlagerführer Schwarz, dem Rapportführer Palitzsch, dem SS-Führer Fritsch und anderen SS-Angehörigen an einem "Massaker" in der Kiesgrube beteiligt. Die SS-Männer hätten die Häftlinge mit Schaufelstielen geschlagen, erschossen und gejagt. Dann habe man vier Rollwagen voll Leichen in das Lager zurückgefahren. Auf einem Rollwagen, den er selbst habe schieben helfen, hätten zwanzig Leichen gelegen. Der Angeklagte Dylewski habe auch einen Stiel in der Hand gehabt und habe damit auf einen Häftling eingeschlagen.
Die Aussage des Zeugen Krx. scheint dem Gericht jedoch aus einer Reihe von Gründen nicht zuverlässig genug, um die sichere Überzeugung gewinnen zu können, dass der Angeklagte Dylewski tatsächlich an den geschilderten Vorfällen beteiligt gewesen ist, auch wenn man davon ausgeht, dass sich diese Vorfälle tatsächlich so abgespielt haben, wie es der Zeuge Krx. geschildert hat.
Der Zeuge selbst hat angegeben, dass er jedesmal zwei bis drei Wochen krank werde, wenn er an Auschwitz denke. Er habe deswegen immer versucht, die Erinnerung an Auschwitz zu verdrängen. Schon aus diesem Grunde besteht die Gefahr, dass der Zeuge Krx., der ohne Zweifel Schweres im KL Auschwitz erlebt hat und der noch immer darunter leidet, in seiner Erinnerung unbewusst Erlebnisse in Verbindung zu Angeklagten bringt, die daran gar nicht beteiligt waren. Ferner ist noch unklar, woher der Zeuge bereits damals, als er kurz nach seiner Einlieferung in das Lager in der SK gewesen ist, den Angeklagten Dylewski gekannt haben soll. Die SS-Männer haben sich den Häftlingen nicht vorgestellt. Der Zeuge hat auch selbst nicht behauptet, dass er den Angeklagten Dylewski bereits vor dem Ereignis auf Block 11 gekannt habe. Zwar kann der Zeuge Krx. später, als er im Lager als Kapo und später als Oberkapo eingesetzt war, den Angeklagten Dylewski kennengelernt haben. Möglich ist aber, dass er nachträglich irrtümlich entweder schon damals oder jetzt nach zwanzig Jahren die Erlebnisse auf dem Block 11 und in der Kiesgrube mit dem Angeklagten Dylewski in Verbindung gebracht hat. Denn es erscheint fraglich, ob Krx., der noch relativ neu im Lager war und für den die Erlebnisse schockierend und mit Angst für sein eigenes Leben verbunden gewesen sein müssen, die beteiligten SS-Männer so genau angesehen hat, dass er sie nach Wochen und Monaten zuverlässig wiedererkennen konnte und dass er die damalige gedankliche Verbindung heute noch zuverlässig nachvollziehen kann.
Hiervon abgesehen erscheint es aber auch unwahrscheinlich, dass der Angeklagte Dylewski bereits zwischen Juni und August 1941 in das Schutzhaftlager und in den Block 11 kommen konnte. Von Juni bis August 1941 war der Angeklagte Dylewski nach seiner Einlassung im Studienurlaub. Insoweit ist seine Einlassung glaubhaft. Denn er hat dies von Anfang an so angegeben, auch als die schwerwiegenden Belastungen des Zeugen Krx., die der Zeuge erstmals in der Hauptverhandlung vorgebracht hat, noch nicht bekannt waren. Sie wird auch durch die glaubhafte Aussage der Zeugin Ruth Dylewski bestätigt. Die Zeugin hat bekundet, dass ihr früherer Ehemann, den sie im Februar 1941 kennengelernt hat, schon 1941 - noch vor ihrer Eheschliessung - einen längeren Studienurlaub gehabt habe. Der Angeklagte Dylewski war nach seinem Studienurlaub noch im Wachsturmbann eingesetzt. Er kam erst am 1.9.1941 in die Politische Abteilung. Wie sich aus seinem - bereits oben erwähnten - Schreiben vom 3.9.1941 an die Kameradschaft Ferdinand Schulz ergibt, hatte er zu dieser Zeit Krankheitsurlaub. Als Angehöriger des Wachsturmbannes durfte er das Schutzhaftlager nicht betreten. Es erscheint daher kaum möglich, dass er bereits in der Zeit zwischen Juni und August 1941 den Block 11 betreten hat.
Gegen die Zuverlässigkeit der Aussage des Zeugen Krx. sprechen aber noch weitere Gründe. Bei seiner Vernehmung in der Hauptverhandlung hat der Zeuge verschwiegen, dass er - was immerhin für die Beurteilung seiner Aussage von Wichtigkeit sein konnte - in Auschwitz Kapo und Oberkapo gewesen ist. Erst auf Vorhalt und Befragen durch die Verteidiger hat er zugegeben, dass er Oberkapo im Neubaukommando gewesen sei. Auf weiteres Befragen hat er energisch in Abrede gestellt, jemals in seiner Eigenschaft als Kapo oder Oberkapo Häftlinge geschlagen zu haben. Auch das erscheint auf den ersten Blick nicht recht glaubhaft. Denn - wie sich aus der Beweisaufnahme ergeben hat - sparten die Kapos gegenüber den Häftlingen, deren Vorgesetzte sie waren, nicht mit Schlägen, weil sie auf Befehl der SS sich rücksichtslos gegenüber den Häftlingen durchsetzen und diese immer wieder zu besseren Arbeitsleistungen antreiben mussten. Ein Kapo, der gegenüber den Häftlingen zu "weich" war, konnte sich in der Regel nicht lange auf seinem Posten halten.
Eine Reihe ukrainischer Zeugen, die ebenfalls als Häftlinge im KL Auschwitz waren, haben auch übereinstimmend bekundet, dass Krx. als Oberkapo Häftlinge seines Arbeitskommandos geschlagen hätte. Die ukrainischen Zeugen kamen damals mit anderen ukrainischen Nationalisten, darunter Wasil Bandera im Jahre 1942 in das KL Auschwitz. Wasil Bandera war ein ukrainischer Nationalistenführer, der eine unabhängige Ukraine hatte schaffen wollen und deswegen von den Deutschen mit seinem Anhang festgenommen und in das Gefängnis eingeliefert worden war. Auch der Bruder des Wasil Bandera, Alexander Bandera, war in der damaligen Zeit in das KL Auschwitz verbracht worden. Zwischen den polnischen Häftlingen und den ukrainischen Nationalisten bestanden damals starke Spannungen im Lager. Das haben nicht nur die ukrainischen Zeugen, sondern auch polnische Zeugen, unter anderem der Zeuge Kl., bestätigt. Die Brüder Bandera kamen bald nach ihrer Einlieferung in das Lager zu Tode. Die Hintergründe hierfür konnten in der Hauptverhandlung nicht geklärt werden. Die ukrainischen Zeugen haben zwar behauptet, der Zeuge Krx. sei an der Tötung der Gebrüder Bandera massgeblich beteiligt gewesen. Ihre Aussagen waren jedoch nicht widerspruchsfrei, so dass auf Grund ihrer Aussagen insoweit keine sicheren Feststellungen getroffen werden konnten. Fest steht jedoch nach ihren Aussagen, die insoweit übereinstimmten, dass die Brüder Bandera im Neubaukommando des Zeugen Krx. gearbeitet haben. Man hat auch bereits damals den Zeugen Krx. für ihren Tod verantwortlich gemacht. Der Zeuge F. hat glaubhaft bekundet, dass die Politische Abteilung bereits damals dem Zeugen Krx. vorgeworfen habe, er habe den einen der Gebrüder Bandera vom Gerüst herabgestürzt, und sie habe ihn deswegen zur Verantwortung gezogen. Krx. selbst habe ihm damals im Lager erzählt, dass es zwischen dem einen Bandera und einem andern Häftling einen Streit gegeben habe und dass dabei Bandera vom Gerüst herabgestürzt sei. Er - Krx. - sei dafür verantwortlich gemacht worden.
In der Hauptverhandlung hat nun der Zeuge Krx. energisch in Abrede gestellt, die Brüder Bandera damals überhaupt gekannt zu haben. Er hat ferner behauptet, er sei damals von der Politischen Abteilung verhaftet worden, weil er einer geheimen Lagerorganisation angehört habe. Beides erscheint angesichts der Bekundung des Zeugen F. unglaubhaft. Denn wenn sich Krx. bereits damals gegenüber dem Zeugen F. in der von diesem geschilderten Weise geäussert hat, woran das Gericht angesichts des guten und zuverlässigen Eindrucks des Zeugen F. in der Hauptverhandlung keinen Zweifel hat, so muss Krx. bereits damals mindestens einen der Brüder Bandera gekannt haben. Ferner muss er damals nicht wegen der Zugehörigkeit zu einer Untergrundorganisation, sondern im Zusammenhang mit dem Tode eines der Brüder Bandera festgenommen und in den Bunker eingeliefert worden sein.
Wenn aber Krx. in diesem - an sich nebensächlichen - Punkt - der für ihn aber wichtig genug sein mag - in der Hauptverhandlung nicht die Wahrheit gesagt hat, erscheint es zweifelhaft, ob er in anderer Hinsicht, vor allem in bezug auf die Belastung des Angeklagten Dylewski vollen Glauben verdient.
Dass die Erinnerung des Zeugen Krx. nicht zuverlässig ist, zeigt sich an einem weiteren Beispiel: In der Hauptverhandlung hat der Zeuge Krx. bekundet, mit ihm zusammen sei nach seiner damaligen Festnahme im Lager ein Häftling namens Wroblewski in die Zelle Nr.20 des Arrestbunkers eingeliefert worden. Wroblewski sei völlig zerschlagen gewesen. Am nächsten Morgen habe Boger sie - die Häftlinge - aus der Zelle herausgerufen. Wroblewski habe jedoch nicht aufstehen können. Boger habe daraufhin den Ja. gerufen und durch ihn den Wroblewski aus der Zelle herausholen lassen. Er - Krx. - habe dann mit eigenen Augen gesehen, dass Boger den Wroblewski mit der Pistole erschossen habe. Früher hat der Zeuge Krx. bei einer Anhörung durch den Zeugen Sm. in der Wohnung des Krx. eine andere Darstellung gegeben. Der Zeuge Sm. hat - wie er glaubhaft bekundet hat - über diese Anhörung eine schriftliche Aufzeichnung gefertigt, die in die Form einer Vernehmung gekleidet ist. Das Gericht hat keine Zweifel, dass der zuverlässige Zeuge Sm. nur das aufgezeichnet hat, was ihm der Zeuge Krx. angegeben hat. Die schriftliche Aufzeichnung wurde dem Zeugen Krx. in der Hauptverhandlung vorgehalten. Sie stimmt nach der Überzeugung des Gerichts mit der damaligen Darstellung des Zeugen Krx. gegenüber Sm. überein. Danach hat er gegenüber dem Zeugen Sm. erklärt, dass Wroblewski sofort nach ihrer Einlieferung in den Arrestbunker, also bereits abends, von Boger erschossen worden sei. Er - Krx. - sei in der Zelle gewesen. Boger habe den Wroblewski aus der Zelle herausgeholt und kurz danach habe er - Krx. - einen Schuss gehört. Nach dieser Darstellung war Krx. also nicht Augenzeuge der Erschiessung. Er hat danach nur den Schuss gehört und daraus den Schluss gezogen, dass Boger den Wroblewski getötet hat. Die beiden Darstellungen weichen somit erheblich voneinander ab. Auch das spricht gegen die Zuverlässigkeit der Angaben des Zeugen Krx.
Aus all diesen Gründen hat das Gericht die Aussage des Zeugen Krx. nicht verwertet. Es konnte somit auch nicht mit jeden Zweifel ausschliessender Sicherheit feststellen, dass der Angeklagte Dylewski an den beiden vom Zeugen Krx. geschilderten Vorfälle beteiligt gewesen ist. Aus der Aussage des Zeugen Krx. lassen sich somit keine Schlüsse auf die innere Einstellung des Angeklagten Dylewski bei den Bunkerentleerungen und den Erschiessungen an der Schwarzen Wand ziehen.
Auch der Zeuge Mot. hat den Angeklagten Dylewski schwer belastet. Er hat behauptet, Dylewski habe im Sommer 1942 einen Häftling vor der SS-Küche getötet, weil sich der Häftling einige Kartoffeln angeeignet habe. Dylewski habe zunächst den Häftling mit einem Stock geschlagen und dann, nachdem der Häftling zu Boden gefallen sei, den Stock über den Hals des Häftlings gelegt. Hierauf habe er sich mit den Füssen auf die beiden Enden des Stockes gestellt und den Häftling gewürgt. Er - Mot. - habe dies durch das Fenster der SS-Kantine, in der er beschäftigt gewesen sei, beobachtet. Im Jahre 1942 sei er von Dylewski vernommen worden. Dylewski habe ihm dabei nicht nur Ohrfeigen gegeben, sondern ihn auch mit der Peitsche in das Gesicht geschlagen. Ausserdem habe er ihm einen Finger mit der Tischschublade gequetscht. Danach habe er ihn mit der Peitsche bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen. Auf Grund dieser Misshandlung habe er einen Schädelbruch erlitten.
Auch dieser Zeuge erscheint jedoch nicht zuverlässig. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass der Zeuge tatsächlich Erlebnisse infolge der damals erlittenen Verletzungen und infolge des langen Zeitraumes, der seither verstrichen ist, unbewusst, vielleicht auch aus nicht näher zu erforschenden Gründen, bewusst, wahrheitswidrig auf den Angeklagten Dylewski projiziert. Denn der Zeuge hat auch den Angeklagten St. zu Unrecht belastet. Er hat behauptet, dass der Angeklagte St. um die Jahreswende des Jahres 1942/1943 auf der Strasse vor Block 27 sieben bis neun Personen zum Erschiessen ausgesucht habe. Unter ihnen sei ein Häftling namens Niebudeck gewesen und ein ehemaliger Oberst namens Kamuniecki. St. habe dann diese Personen persönlich erschossen. Der Zeuge hat mit aller Bestimmtheit erklärt, dass St. diese Personen ausgesucht und mit einem Kleinkalibergewehr auf den Block 11 gebracht habe. Eine Stunde später seien Leichenträger mit Rollwagen auf Block 11 gefahren und hätten die Leichen der von St. ausgesuchten Personen abgeholt. Das habe er mit eigenen Augen gesehen. Von einem Kameraden namens Wetulan habe er erfahren, dass St. mit Bestimmtheit die Häftlinge erschossen habe.
Diese Aussage des Zeugen kann jedoch nicht der Wahrheit entsprechen. Aus der ersten Eintragung auf Blatt 105 des ersten Bandes des Bunkerbuches, die in der Hauptverhandlung verlesen worden ist, ergibt sich eindeutig, dass der Häftling Kamuniecki am 6.1.1943 auf Anordnung der Politischen Abteilung in den Arrestbunker eingeliefert worden ist und am 25.1.1943 verstorben (wahrscheinlich erschossen worden) ist. Zu dieser Zeit war jedoch der Angeklagte St. überhaupt nicht in Auschwitz. Er hatte Studienurlaub und studierte an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt am Main Rechtswissenschaft. Dies ergibt sich eindeutig aus dem Studienbogen für den Angeklagten St., der bei der Universität Frankfurt am Main aufbewahrt wird und in der Hauptverhandlung verlesen worden ist. Danach ist der Angeklagte St. am 8.12.1942 an der Universität in Frankfurt am Main immatrikuliert worden. Am gleichen Tag hat er Gebührenfreiheit beantragt. Ferner ist an diesem Tag für ihn ein Studienausweis, den er eigenhändig unterzeichnet hat, von dem Universitätssekretariat ausgestellt und ferner eine Karteikarte angelegt worden.
Damit wird die Einlassung des Angeklagten St., dass er von Dezember 1942 bis zum 1.4.1943 in Frankfurt am Main studiert hat, bestätigt. Das Schwurgericht hält es für ausgeschlossen, dass St. während seines Studienurlaubs freiwillig nach Auschwitz gefahren ist und dort trotz Urlaubs Dienst gemacht hat.
Damit ist bereits die Bekundung des Zeugen Mot. hinsichtlich des Angeklagten St. widerlegt. Sie steht aber auch im Widerspruch zu einer Eintragung im Heft Nr.4 (Seite 64 ff.) der Auschwitzer Hefte (Kalendarium der Ereignisse) die dem Zeugen Mot. in der Hauptverhandlung vorgehalten worden ist. Wenn aber der Zeuge Mot. in bezug auf den Angeklagten St. offensichtlich die Unwahrheit gesagt hat, wobei es dahingestellt bleiben kann, ob bewusst oder unbewusst, kann der Aussage insgesamt auch in bezug auf den Angeklagten Dylewski kein Beweiswert mehr zuerkannt werden.
Auch der Zeuge Kam. hat den Angeklagten Dylewski schwer belastet. Kam. ist im Februar 1941 nach Auschwitz gekommen. Er war damals 16 Jahre alt. Er kam sofort in die Strafkompanie, die damals im Block 11 untergebracht war. Dieser Block trug damals allerdings noch die Nummer 13. Kam. musste mit anderen Angehörigen der Strafkompanie in der Kiesgrube arbeiten. Der Zeuge hat geschildert, dass im Spätsommer 1941 der Angeklagte Dylewski in der Kiesgrube erschienen sei und alle Kapos zusammengerufen habe. Dann habe er diesen die Anweisung erteilt, alle Juden zu liquidieren. Daraufhin seien die Kapos losgerannt und hätten angefangen, die Juden zu schlagen und zu töten. Ein Kapo habe sich an Dylewski wegen eines Judenjungen, der 15-16 Jahre alt gewesen sei, gewandt. Er - der Zeuge - habe zwar nicht verstanden, was der Kapo gesagt habe. Aber wahrscheinlich habe er sich für den Jungen eingesetzt. Dylewski habe daraufhin den Jungen zu sich gerufen und habe ihn angeschaut. Dann habe er ihm bedeutet, zur Arbeit zurückzugehen. Als sich der Judenjunge zurückgewandt habe, habe Dylewski ihn erschossen.
Auch in diesem Fall konnte das Schwurgericht nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass der Zeuge den Vorfall zutreffend mit dem Angeklagten Dylewski in Verbindung gebracht hat.
Der Zeuge kannte damals den Angeklagten Dylewski nicht. Auf die Frage, wieso er Dylewski gekannt habe, hat der Zeuge keine befriedigende Antwort gegeben. Er hat eingeräumt, dass er den Namen Dylewski nicht gekannt habe. Er habe ihn - Dylewski - so gab der Zeuge zur Erläuterung an - gesehen, als er zu ihnen gekommen sei, um die Arbeit der Strafkompanie zu überwachen. Auf die Frage, ob Dylewski denn Bewachungsaufgaben gehabt habe, erklärte der Zeuge, das könne er nicht sagen. Aber jedesmal, wenn er gekommen sei, seien sie von den Kapos schärfer angefasst worden. Später musste der Zeuge auf Vorhalt einräumen, dass er den SS-Unterführer, den er jetzt als den Angeklagten Dylewski bezeichnet, insgesamt nur zweimal gesehen hat. Dylewski war im Sommer 1941 in Studienurlaub. Danach war er noch eine Zeitlang im Wachsturmbann. Erst im September 1941 kam er zur Politischen Abteilung. Anfang September 1941 war er - wie schon oben ausgeführt - zwei Wochen krank. Danach wurde er in der Politischen Abteilung mit Dolmetscheraufgaben betraut und hatte Schreibarbeiten auszuführen. Erst später wurden ihm selbständige Vernehmungen übertragen. Es ist daher unwahrscheinlich, dass Dylewski bereits im Spätsommer 1941 zur Überwachung der Strafkompanie eingesetzt worden ist. Das war im übrigen auch nicht Sache der Politischen Abteilung, sondern der Schutzhaftlagerführung.
Der Zeuge hat auch gar nicht gewusst, ob der SS-Mann, den er jetzt als den Angeklagten Dylewski bezeichnet, damals zur Politischen Abteilung gehört hat. Das hat er selbst eingeräumt. Er hat es lediglich angenommen. Er habe, so hat er auf Befragen erklärt, geglaubt, dass alle, die zur SK gekommen seien "um sich auszutoben", zur Politischen Abteilung gehört hätten.
Zur Begründung dafür, warum er geglaubt habe, dass der SS-Mann, der den Judenjungen erschossen hat, der Angeklagte Dylewski gewesen sei, hat der Zeuge noch angegeben, dass man den SS-Mann "Klaus" genannt habe.
Der Angeklagte Dylewski hiess zwar mit dem Vornamen Klaus, aber nach Auffassung des Schwurgerichts ist das noch kein sicherer Beweis, dass Dylewski damals tatsächlich der Täter gewesen ist. Im KL Auschwitz gab es noch - wie oben schon ausgeführt - den SS-Unterführer Clausen. Dieser war eine Zeitlang Rapportführer. Er war sehr gefürchtet. Es ist möglich, dass dieser - was zu seinen Aufgaben gehört hat - von Zeit zu Zeit die SK kontrolliert hat. Ausserdem gab es noch einen SS-Mann mit dem Nachnamen Klaus. Schliesslich kann nicht ausgeschlossen werden, dass unter den vielen anderen SS-Männern weitere mit Vornamen Klaus gewesen sind. Auffällig war auch, dass der Zeuge Kam. keine Namen anderer SS-Männer mehr hat nennen können. So wusste er nicht einmal mehr den Namen des SS-Kommandoführers oder seines Blockführers.
Es besteht daher die Möglichkeit, dass der Zeuge Kam. einen Vorfall, den er vor mehr als zwanzig Jahren tatsächlich erlebt hat, nachträglich zu Unrecht auf den Angeklagten Dylewski projiziert hat.
Auch insoweit lässt sich daher nicht mit Sicherheit feststellen, dass Dylewski tatsächlich die Liquidierung der Juden angeordnet und einen Judenjungen eigenmächtig erschossen hat.
Schliesslich erscheinen auch weitere Zeugen, die den Angeklagten Dylewski belastet oder negativ beurteilt haben, nicht voll glaubwürdig.
So hat der Zeuge My. in der Hauptverhandlung behauptet, der Angeklagte Dylewski habe zusammen mit dem Angeklagten Boger einen Häftling auf der Schaukel geschlagen. Er, der Zeuge, sei zu dieser Vernehmung hinzugekommen. Bei seiner früheren Vernehmung durch das Kreisgericht in Gleiwitz am 18.8.1962 hat der Zeuge, was ihm in der Hauptverhandlung vorgehalten worden ist und was er bestätigt hat, jedoch angegeben, dass er den Angeklagten Dylewski bei Vernehmungen von Häftlingen nicht gesehen habe. Eine befriedigende Erklärung für diesen Widerspruch konnte der Zeuge nicht angeben.
Der Zeuge Sew. hat früher im Ermittlungsverfahren behauptet, der Angeklagte Dylewski habe ihn bewusstlos geschlagen. In der Hauptverhandlung hat er ausgesagt, dass Dylewski ihn nur geschlagen habe, weil er einen Brief seines Chefs - des Angeklagten B. - zu einem Fräulein Pisch, die in der Verwaltung beschäftigt gewesen ist, gebracht habe. Als er dem Angeklagten Dylewski aber auf seine Frage, woher er den Brief habe, gesagt habe, der Brief sei von B., habe der Angeklagten Dylewski das überprüft und habe ihn entlassen. Er - der Zeuge - habe dann wieder in seine Unterkunft zurückgehen können. Erst auf Vorhalt, dass er früher behauptet habe, von dem Angeklagten Dylewski bewusstlos geschlagen worden zu sein, gab der Zeuge an, er habe auf der Erde gelegen. Man habe ihn mit Wasser übergossen. Trotzdem sei er noch glimpflich davongekommen. Schon diese widerspruchsvollen Angaben lassen Zweifel an der Zuverlässigkeit des Zeugen aufkommen. Hinzu kommt aber noch, dass der Zeuge auch im Falle Lupa, der dem Angeklagten Boger zur Last gelegt wird (Eröffnungsbeschluss betr. Boger 4g.) und der noch in einem späteren Abschnitt zu erörtern sein wird, widerspruchsvolle Angaben gemacht hat. Seine Bekundungen in diesem Fall lassen den Eindruck entstehen, dass der Zeuge zu phantasievollen Erzählungen neigt. Seiner Aussage konnte daher kein Beweiswert zuerkannt werden.
Der Zeuge Kro. schliesslich hat in der Hauptverhandlung behauptet, dass der Angeklagte Dylewski brutal gewesen sei. Er hat den Angeklagten Dylewski allerdings selbst nie bei Vernehmungen gesehen. Sein negatives Urteil hat der Zeuge damit begründet, dass er oft Blut von den Wänden und von dem Schreibtisch des Angeklagten Dylewski habe wegwischen müssen. Daraus hat der Zeuge den Schluss gezogen, dass Dylewski ein brutaler Schläger gewesen sein müsse.
Der Angeklagte Dylewski arbeitete jedoch im gleichen Zimmer wie der Angeklagte Boger. Auch der Zeuge Kro. hat bestätigt, dass der Angeklagte Dylewski nach seiner Erinnerung im gleichen Raum wie Boger amtiert habe. Es ist daher nicht ausgeschlossen - bei der erwiesenen Brutalität des Angeklagten Boger sogar wahrscheinlich -, dass die Blutspuren von Vernehmungen des Angeklagten Boger herrührten. Sie lassen jedoch keinen Schluss auf die Vernehmungsmethoden des Angeklagten Dylewski zu.
Zusammenfassend lassen sich somit aus den Aussagen der Zeugen Doe., Krx., Mot., Sew., My., Kam. und Kro. keine Erkenntnisse zur inneren Einstellung und Willensrichtung des Angeklagten Dylewski bei seiner Beteiligung an den Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen gewinnen.
Es kann daher nur festgestellt werden, dass der Angeklagte Dylewski die Tötungen der Arrestanten fördern und unterstützen wollte.
Irgendwelche Rechtfertigungsgründe für die Beteiligung des Angeklagten Dylewski sind nicht ersichtlich.
Der Angeklagte Dylewski hat auch vorsätzlich gehandelt. Dies ergibt sich aus den getroffenen Feststellungen unter II.2. und den bereits oben gemachten Ausführungen, dass ihm bewusst gewesen ist, zu den als rechtswidrig erkannten Tötungen kausale Tatbeiträge zu leisten und dass er die gesamten Umstände gekannt hat, die die Beweggründe für die Tötungen als niedrig und die Art ihrer Ausführung als grausam kennzeichnen. Irgendwelche Schuldausschliessungsgründe liegen nicht vor. Der Angeklagte Dylewski beruft sich selbst nicht darauf, dass er in einem Nötigungsnotstand (§52 StGB) oder einem allgemeinen Notstand (§54 StGB) gehandelt habe. Er hat lediglich angegeben, dass es damals eine Befehlsverweigerung nicht gegeben habe, er habe dazu auch keine Veranlassung gehabt. Damit hat er zum Ausdruck gebracht, dass er gar nicht auf die Idee gekommen ist, den Befehl Grabners nicht auszuführen, oder sich der Beteiligung an den Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen zu entziehen. Er hat vielmehr auf Grund freier Entschliessung - wenn vielleicht auch widerwillig - die Befehle ausgeführt. Dafür, dass sein Wille unter Gefahr für Leib oder Leben gebeugt worden sei, liegen jedoch keine Anhaltspunkte vor. In diesem Fall ist das auch schon deswegen nicht anzunehmen, weil damals der intelligente und gewandte Angeklagte nur eine Meldung über die - auch nach der damaligen Anschauung der SS-Führung - rechtswidrigen Tötungen an vorgesetzte Dienststellen (RSHA) hätte zu machen brauchen, um sich einer angeblichen Nötigung zu entziehen. Aus den gleichen Gründen bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Angeklagte Dylewski irrig die tatsächlichen Voraussetzungen eines Nötigungsnotstandes oder eines allgemeinen Notstandes angenommen hätte. Er beruft sich auch selbst nicht darauf.
Die Erschiessung eines jeden einzelnen Häftlings ist als eine selbständige Handlung im Sinne des §74 StGB anzusehen, weil bei jedem einzelnen Häftling der Entschluss für seine Tötung von den Tätern jeweils besonders gefasst worden ist und weil es bei der Tötung eines jeden Häftlings jeweils besonderer Willensbetätigung bedurft hat, die sich jeweils gegen das Leben eines bestimmten Menschen richtete.
Der Angeklagte Dylewski war daher wegen seiner Beteiligung an den Bunkerentleerungen und mindestens drei Erschiessungsaktionen, bei denen mindestens dreissig Menschen getötet worden sind, wegen Beihilfe zu gemeinschaftlichem Mord in mindestens dreissig Fällen (§§47, 49, 211, 74 StGB) zu verurteilen.
V. Strafzumessung
Gegen den Angeklagten Dylewski musste eine gerecht erscheinende Strafe wegen Beihilfe zum Mord in 32 Fällen gefunden werden.
Massgeblich waren dabei folgende Umstände:
Der Angeklagte hat vor und nach seiner Tätigkeit in Auschwitz ein ordentliches Leben geführt und wäre nicht straffällig geworden, wenn er nicht durch Befehle in Verbrechen verstrickt worden wäre. Er ist, ohne gefragt zu werden, zum Wachsturmbann nach Auschwitz versetzt worden, hat unter den dortigen Zuständen seelisch gelitten und sich immer wieder bemüht, wegzukommen. Er hat nie einen besonderen Eifer gezeigt, sich in die Mordmaschinerie des Vernichtungslagers Auschwitz einspannen zu lassen. Der Angeklagte hat im Gegenteil, wie dies im einzelnen bereits ausgeführt ist, in zahlreichen Fällen unmittelbar und zeitweilig auch unter Inkaufnahme eigener Gefährdung bewirkt, dass zahlreiche Häftlinge vor ihrer Vernichtung geschützt wurden. Er hat, was ebenfalls strafmildernd ins Gewicht fiel, jeweils keinen besonders wesentlichen Tatbeitrag geleistet. Demgegenüber konnte auch bei diesem Angeklagten nicht daran vorbeigesehen werden, dass er trotz seiner Intelligenz bestialischen Mördern seine Hand lieh und so zum Gelingen verwerflichster Mordkomplotte beitrug.
Für alle Beihilfehandlungen erschienen gleich hohe Strafen angemessen:
Bezüglich der Tätigkeit auf der Rampe war zu Gunsten des Angeklagten zu berücksichtigen, dass sein Tatbeitrag gering war und die Vernichtung jüdischer Menschen auf den Plänen der damaligen Staatsspitzen beruhte; demgegenüber musste die Zahl der Opfer, die unter seiner Mitwirkung gemordet wurden, straferschwerend ins Gewicht fallen. Bei den sog. Bunkerentleerungen, die der Initiative örtlicher SS-Führer entsprangen, hatte das Mitwirken des Angeklagten schon mehr Bedeutung, mag auch in jedem Fall "nur" ein Mensch umgebracht worden sein.
Danach wurde in jedem Fall eine Zuchthausstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten als gerechte Strafe und Sühne erachtet; die nach §74 StGB zu bildende Gesamtstrafe erschien bei Berücksichtigung aller angeführten Umstände in Höhe von 5 Jahren angemessen.
F. Die Straftaten des Angeklagten Broad
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Broad
Der Angeklagte Broad ist als Sohn eines brasilianischen Kaufmanns und dessen deutscher Ehefrau am 25.4.1921 in Rio de Janeiro geboren; bald nach seiner Geburt zog seine Mutter mit ihm nach Deutschland, und zwar zunächst nach Freiburg und im Jahre 1926 nach Berlin. Sein Vater blieb in Brasilien zurück. Der Angeklagte besuchte die Volksschule in Berlin von 1927 bis 1931 und anschliessend das Realgymnasium, an dem er im Jahre 1940 die Reifeprüfung ablegte.
In die Hitlerjugend trat er bereits im Jahre 1931 ein. Er gehörte ihr bis 1936 an. Später erhielt er wegen dieser frühzeitigen Mitgliedschaft das goldene HJ-Ehrenabzeichen. Nach dem Abitur studierte der Angeklagte bis Dezember 1941 an der Technischen Hochschule in Berlin. Dann meldete er sich freiwillig zur SS. Auf Grund dieser Meldung wurde er im Januar 1942 zum Infanterieersatzbataillon der SS-Division "Nord" nach Wehlau/Ostpreussen eingezogen.
Als Grund für seine freiwillige Meldung zur Waffen-SS gibt der Angeklagte an, dass er wegen seiner brasilianischen Staatsangehörigkeit Schwierigkeiten gehabt habe. Man habe ihm die Aufenthaltsbewilligung nicht verlängern wollen. Mit seinem Vater in Brasilien habe er keine Verbindung gehabt. Er habe nicht einmal seine Adresse gewusst. Ein Bekannter von ihm, der Beziehungen zur SS gehabt habe, habe ihm geraten, sich zur SS als Dolmetscher zu melden, nachdem seine Meldung zur Wehrmacht keinen Erfolg gehabt habe. Denn die Wehrmacht habe ihn wegen seiner brasilianischen Staatsangehörigkeit nicht genommen. Da die Waffen-SS auch Staatsangehörige anderer Nationen aufgenommen habe, habe er sich zu dieser gemeldet.
Eine Woche nach seiner Einberufung wurde das Infanterieersatzbataillon der Division "Nord" nach Trautenau (Sudetenland) verlegt. Dort erhielten die Rekruten ihre militärische Ausbildung. Ende März oder Anfang April 1942 kam die Einheit bereits zum Einsatz an die Front. Da der Angeklagte sehr stark kurzsichtig und deswegen nur g.v.H. war, kam er nicht zum Einsatz. Er wurde vielmehr noch im April 1942 zum KL Auschwitz versetzt. Dort machte er zunächst Wachdienst in einer Wachkompanie des Wachsturmbannes. Als Dolmetscher für die Politische Abteilung gesucht wurden, meldete er sich. Er kam daraufhin im Juni 1942 als Schreiber und Dolmetscher zur Politischen Abteilung. Später wurden ihm auch selbständige Arbeiten (Vernehmungen usw.) übertragen.
Im Sommer 1944 sollte der Angeklagte, der es in Auschwitz nur bis zum SS-Rottenführer gebracht hatte, an einem Vorbereitungslehrgang in Arolsen für die SS-Führerschule teilnehmen. Er kam auch nach Arolsen, wurde aber wegen seiner Kurzsichtigkeit vom Lehrgang zurückgestellt. Er will dann gleichwohl als "Putzer" bis zur Beendigung des Lehrganges in Arolsen geblieben sein. Nach seiner Rückkehr aus Arolsen war der Angeklagte Broad weiterhin in der Politischen Abteilung des KZ Auschwitz bis zur Auflösung des Lagers im Jahre 1945 tätig. Als das Lager geräumt wurde, brachte er mit anderen SS-Angehörigen sechs inhaftierte SS-Männer in das Konzentrationslager Gross-Rosen bei Breslau und setzte sich mit einem LKW, der mit Akten der Politischen Abteilung beladen war, zum Konzentrationslager Mittelbau bei Nordhausen/Harz ab. Ende März 1945 begleitete er einen Häftlingstransport zum Konzentrationslager Ravensbrück. Bei Ravensbrück kam er noch kurz zum Fronteinsatz und geriet am 6.5.1945 in englische Kriegsgefangenschaft.
Als der Angeklagte im englischen Kriegsgefangenenlager Gorleben war, meldete er sich freiwillig bei dem Kommandanten der in Gorleben liegenden englischen Abteilung. Die Abteilung hatte die Aufgabe, die Vernehmungen von deutschen Kriegsgefangenen durchzuführen. Der Kommandeur der englischen Einheit war der Zeuge van het Kaa. Der Angeklagte berichtete diesem, dass er in Auschwitz gewesen sei und dass er über die Zustände in diesem Lager Angaben machen könne. Daraufhin liess der Zeuge van het Kaa. den Angeklagten Broad aus dem Kriegsgefangenenlager herausholen, in eine englische Uniform einkleiden und bei der englischen Abteilung Unterkunft gewähren. Der Angeklagte Broad schrieb dann handschriftlich auf deutsch auf Befehl des Zeugen van het Kaa. in wenigen Tagen einen ausführlichen Bericht über das Konzentrationslager Auschwitz. Von dem Zeugen Wi., der damals Sergeant in der Abteilung des Zeugen van het Kaa. war, wurde dann der Bericht mit der Schreibmaschine wörtlich mit mehreren Durchschlägen abgeschrieben. Er umfasste 75 Schreibmaschinenseiten. Broad fertigte ausserdem eine Liste der in Auschwitz beschäftigt gewesenen Personen an. Er blieb in der Folgezeit weiterhin bei der englischen Einheit, auch als diese nach Munsterlager verlegt wurde. Er half den Engländern bei der Ermittlung gegen SS-Angehörige. Er war stets bemüht, im Auftrag der Engländer Kriegsverbrecher und verdächtige Personen ausfindig zu machen.
Im Jahre 1947 wurde der Angeklagte aus der englischen Einheit entlassen. Er fand Arbeit als kaufmännischer Angestellter in einem Sägewerk in Munsterlager. Als dieser Betrieb im Jahre 1953 Konkurs machte, zog er nach Braunschweig und betätigte sich wieder als kaufmännischer Angestellter. 1957 wurde er in Braunschweig von der Firma Heinrich Hinz Elektroapparatebau eingestellt, bei der er noch im Zeitpunkt seiner Verhaftung in dieser Sache am 30.4.1959 tätig war. Nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft am 23.12.1960 wurde er erneut von der Firma Hinz mit einem Bruttogehalt von 1042.- DM eingestellt. Der Angeklagte hat im Herbst das erste Mal geheiratet. Die erste Ehe mit Gisela Mü. wurde im Jahre 1955 vor dem Landgericht Braunschweig geschieden. 1958 schloss der Angeklagte die Ehe mit Irmgard Pag. Diese verstarb 1959. Kinder sind aus den beiden Ehen nicht hervorgegangen. Inzwischen hat der Angeklagte erneut geheiratet. Der Angeklagte war in Untersuchungshaft vom 30.4.1959 bis zum 23.12.1960. Am 6.11.1964 wurde der Haftbefehl des Amtsgerichts Stuttgart vom 6.4.1959 wieder in Vollzug gesetzt. Seitdem befindet sich der Angeklagte wieder in Untersuchungshaft.
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Mitwirkung des Angeklagten Broad an der Massentötung jüdischer Menschen in Auschwitz (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
Der Angeklagte Broad war als Angehöriger der Politischen Abteilung, zu der er im Juni 1942 versetzt worden war, an der Massentötung der mit RSHA-Transporten angekommenen jüdischen Menschen (vgl. oben A.II.) beteiligt.
Der Angeklagte Broad wurde ebenso wie die anderen Angehörigen der Politischen Abteilung auch zum Rampendienst eingeteilt. Er war wiederholt bei der Ankunft, Einteilung und Abwicklung von RSHA-Transporten auf der Rampe. Dort hat er die gleichen Überwachungsfunktionen wie der Angeklagte Boger ausgeführt (vgl. oben C.II.). Er achtete darauf, dass die Häftlinge des Häftlingskommandos nicht mit den Zugängen sprachen, damit diese nichts über ihr bevorstehendes Schicksal erführen, und dass die SS-Angehörigen ihren Rampendienst befehlsgemäss versahen. Er sorgte auch dafür, dass die bereits als arbeitsunfähig beurteilten Menschen, die für den Tod bestimmt waren, nicht dadurch ihrem Tode entgingen, dass sie sich der Gruppe der als arbeitsfähig anerkannten und für die Aufnahme in das Lager vorgesehenen Häftlinge zugesellten.
Einmal warnte ein Häftling aus dem Häftlingskommando, das die Gepäckstücke der angekommenen Menschen auf die LKWs zu verladen hatte, eine Frau aus einem angekommenen RSHA-Transport heimlich. Er sagte ihr, dass in dem Rot-Kreuz-Wagen Gas sei und dass sie getötet und anschliessend verbrannt werden sollten. Der Angeklagte Broad hatte zu dieser Zeit gerade Rampendienst. Die Frau lief zu Broad hin und erklärte ihm, sie sei erschrocken, weil man sie - wie ihr ein Häftling gesagt habe - vergiften und töten wolle. Broad liess sich den Häftling zeigen, der ihr diese Mitteilung gemacht hatte, und beruhigte die Frau, indem er ihr antwortete, sie solle dem Häftling, der dies gesagt habe, nicht glauben. Es sei ein Verbrecher, das sehe sie schon an seinen abstehenden Ohren und seiner Glatze. Nachdem die Frau weggebracht worden war, erstattete der Angeklagte Broad Meldung über den Häftling. Dieser wurde anschliessend wegen "Verbreitung von Greuelnachrichten" zu 150 Stockschlägen "verurteilt". Der Lagerführer las das "Urteil" vor. Dem Häftling wurden dann von seinen Mithäftlingen auf Befehl der SS 150 Stockschläge verabreicht. Er starb an den Folgen der Schläge.
Der Angeklagte Broad hat in einer unbestimmten Anzahl von Fällen die Überwachungsfunktionen bei der Ankunft von RSHA-Transporten ausgeübt. Mit Sicherheit hat er dies mindestens in zwei Fällen getan. In diesen beiden Fällen sind jeweils mindestens 1000 Menschen aus den angekommenen Transporten getötet worden.
Der Angeklagte Broad wusste, dass die jüdischen Menschen nur deswegen unschuldig getötet wurden, weil sie Juden waren. Ihm war ferner bekannt, dass die Vernichtungsaktionen unter strengster Geheimhaltung und unter Täuschung der Opfer über ihr bevorstehendes Schicksal durchgeführt wurden. Auch wusste er, dass die Opfer in der oben geschilderten Art und Weise in den Gaskammern getötet wurden. Schliesslich war dem Angeklagten Broad auch klar, dass er durch seine eigene Tätigkeit (Überwachung des Häftlingskommandos, Überwachung der SS-Angehörigen, Überwachung der als arbeitsunfähig ausgesonderten Menschen) die Vernichtungsaktionen förderte.
2. Die Beteiligung des Angeklagten Broad an den sog. Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen an der Schwarzen Wand (Eröffnungsbeschluss Ziffer 2)
Der Angeklagte Broad wurde von dem Leiter der Politischen Abteilung, Grabner, auch zu den sog. Bunkerentleerungen bestellt. Er ging mit den anderen SS-Angehörigen zu solchen Bunkerentleerungen mit in den Arrestbunker. In mindestens zwei Fällen ging er auch mit zu den anschliessenden Erschiessungen auf den Hof und war während der gesamten Erschiessungsaktionen auf dem Hof anwesend.
Seine Anwesenheit im Arrestbunker und bei den Erschiessungen im Hof sollte zusammen mit der Anwesenheit der anderen SS-Angehörigen den Opfern einen Widerstand oder Aufstand von vornherein als aussichtslos erscheinen lassen. Er sollte ferner einen eventuellen Widerstand oder einen plötzlichen verzweifelten Aufstand der Opfer zusammen mit den anderen SS-Angehörigen brechen. Hierfür hielt sich der Angeklagte Broad bereit. Er war sich dessen auch bewusst.
Dass der Angeklagte Broad bei den Bunkerentleerungen einen massgebenden Einfluss auf die Auswahl der zu erschiessenden Häftlinge ausgeübt hätte, konnte nicht festgestellt werden. Auch konnte nicht festgestellt werden, dass er selbst eigenhändig Häftlinge, die durch die sog. Bunkerentleerungen zum Erschiessen ausgewählt worden waren, anschliessend erschossen hätte.
In den mindestens zwei Fällen, in denen der Angeklagte Broad an den Bunkerentleerungen und anschliessenden Erschiessungen teilnahm, sind mindestens jeweils zehn Häftlinge, insgesamt zwanzig Häftlinge, getötet worden. Der genaue Zeitpunkt dieser Taten konnte nicht mehr festgestellt werden. Mit Sicherheit steht jedoch fest, dass sich der Angeklagte Broad an Bunkerentleerungen und den geschilderten Erschiessungen erst nach seiner Versetzung zur Politischen Abteilung, also nach dem 1.6.1942, beteiligt hat.
Der Angeklagte Broad wusste, dass die Häftlinge ohne Todesurteil und auch ohne Befehl des RSHA oder einer sonstigen höheren Dienststelle für den Tod ausgesucht und erschossen wurden.
Ihm war auch bekannt, dass die Bunkerentleerungen und anschliessenden Erschiessungen erfolgten, um Platz für weitere Arrestanten zu schaffen. Er merkte auch auf Grund seiner eigenen Anwesenheit, wie die Auswahl der Opfer im einzelnen vor sich ging und wie anschliessend die Erschiessungen durchgeführt wurden. Ihm war klar, dass die an den Bunkerentleerungen und nachfolgenden Erschiessungen beteiligten SS-Angehörigen nicht befugt waren, über Leben und Tod eines Häftlings zu entscheiden.
III. Einlassung des Angeklagten Broad, Beweismittel, Beweiswürdigung
1.
Die Feststellungen zum Lebenslauf des Angeklagten Broad beruhen auf seinen eigenen Angaben sowie auf den glaubhaften Aussagen der Zeugen van het Kaa. und Wi.
2. Zu II.1.
Der Angeklagte Broad bestreitet, jemals zum Rampendienst eingeteilt oder befohlen worden zu sein. Er hat auch in Abrede gestellt, jemals bei der Abwicklung der RSHA-Transporte auf der Rampe tätig gewesen zu sein. Er sei zwar öfter - so hat er sich eingelassen - an der alten Rampe mit dem Fahrrad vorbeigefahren, weil er dienstlich vom Stammlager zum Lager Birkenau hätte fahren müssen. Dabei habe er auch wiederholt angekommene RSHA-Transporte gesehen. Er habe jedoch nichts mit der Einteilung und dem Abtransport der jüdischen Menschen zu tun gehabt. Nur zwei- bis dreimal sei er vom Fahrrad abgestiegen, weil er hätte wissen wollen, was da vor sich gehe. Dabei habe er auch mit einigen Menschen gesprochen. Diese seien froh gewesen, dass sie sich mit ihm in französischer Sprache hätten unterhalten können. Es könne sein, dass sie dabei zu nahe an ihn herangekommen seien und er sie mit der Hand zurückgestossen habe. Möglicherweise seien diese Handbewegungen von Zeugen so ausgelegt worden, als ob er selektiert habe.
Diese Einlassung des Angeklagten Broad ist an sich schon unglaubhaft, denn es erscheint unwahrscheinlich, dass er als Rottenführer gewagt haben soll, mit den angekommenen Menschen zu sprechen, ohne zum Rampendienst eingeteilt gewesen zu sein. Denn das Betreten der Rampe war Unbefugten, auch SS-Angehörigen verboten. Ferner war es allen SS-Angehörigen streng verboten, sich mit den Zugängen zu unterhalten. Seine Einlassung ist nach der Überzeugung des Gerichts nur eine Schutzbehauptung, mit der der intelligente Angeklagte, der sich sagen muss, dass seine Anwesenheit auf der Rampe während der Abwicklung von RSHA-Transporten anderen Personen nicht verborgen geblieben sein kann, seiner Anwesenheit auf der Rampe eine harmlose Erklärung geben wollte, um einer Bestrafung zu entgehen.
Das Gericht sieht als erwiesen an, dass der Angeklagte ebenfalls zum Rampendienst eingeteilt worden ist und den Rampendienst auch in der geschilderten Weise nicht nur auf der alten Rampe, sondern auch auf der Rampe im Lager Birkenau versehen hat.
Der oben bereits erwähnte glaubwürdige Zeuge Erich K. hat - wie er glaubhaft bekundet hat - den Angeklagten Broad wiederholt auf der Rampe in Birkenau bei der Abwicklung von RSHA-Transporten gesehen. Der Zeuge hat den Vorfall beobachtet, der zur Meldung des Häftlings, der eine Frau hat warnen wollen, führte. Er war selbst dabei, wie der Häftling auf Grund der Meldung des Angeklagten Broad die 150 Stockschläge bekam. Der Zeuge hat zwar nicht selbst das Gespräch zwischen dem später getöteten Häftling und der Frau gehört, auch nicht die Erklärung, die der Angeklagte Broad der Frau auf ihr Befragen hin gegeben hat. Ein anderer Häftling aus dem Kanada-Kommando hat dem Zeugen K. jedoch unmittelbar nach der Bestrafung des von Broad gemeldeten Häftlings hiervon berichtet. Dieser andere Häftling war in unmittelbarer Nähe und hat die Gespräche mit anhören können. Das Gericht hat keinen Zweifel, dass der Häftling aus dem Kanada-Kommando dem Zeugen K. zutreffend berichtet hat. Es ist kein Grund ersichtlich, warum der Häftling damals dem Zeugen K. etwas Falsches hätte berichten sollen. Im übrigen wird sein Bericht gestützt durch die Tatsache, dass der Häftling - was der Zeuge K. selbst gehört hat - "auf Grund der Meldung des SS-Rottenführers Broad wegen Verbreitung von Greuelnachrichten" zu den 150 Stockschlägen "verurteilt" worden ist. Beim Verlesen des "Urteils" wurde ausdrücklich auf die Meldung des Angeklagten Broad Bezug genommen. Der Zeuge K. hat auch selbst die Vollstreckung der verhängten Strafe, die unmittelbar nach Verlesung des "Urteils" erfolgte, miterlebt. Aus dem Vorfall ergibt sich, dass der Angeklagte Broad zum Rampendienst eingeteilt gewesen sein muss und dass er in diesem Fall Überwachungsfunktionen ausgeübt hat.
Auch die Zeugin Pal. hat den Angeklagten Broad wiederholt auf der Rampe in Birkenau bei der Ankunft griechischer, holländischer und ungarischer Transporte gesehen. Die Zeugin hat als Blockschreiberin im FKL den Angeklagten Broad gut gekannt. Eine Verwechslungsmöglichkeit scheidet aus. Denn der Angeklagte Broad, der als Angehöriger der Politischen Abteilung für das Lager Birkenau zuständig war, kam aus dienstlichen Gründen wiederholt auf den Block, in dem die Zeugin als Schreiberin tätig war. Er hat - wie die Zeugin glaubhaft versichert hat - wiederholt mit der Zeugin gesprochen.
Die Zeugin hat den Angeklagten Broad auch zutreffend charakterisiert. Er sei - so gab sie an - kein typischer SS-Mann gewesen. Er habe englisch gelernt und Bücher gelesen. Diese Beschreibung passt genau auf den Angeklagten Broad. Die Zeugin hat zwar nicht näher angeben können, was der Angeklagte Broad auf der Rampe in Birkenau getan hat. Sie hat nur bekundet, dass er während der Selektion auf der Rampe gestanden habe. Das spricht für die Glaubwürdigkeit der Zeugin. Es beweist aber auch, dass Broad zum Rampendienst eingeteilt war und auch diesen Dienst versehen hat. Dass die Zeugin keine besonderen Tätigkeiten des Angeklagten Broad beobachten konnte, ist nicht verwunderlich. Denn die Überwachung der Häftlinge und der SS-Angehörigen erforderte keine besonderen, für Aussenstehende auffälligen Tätigkeiten.
Schliesslich beruhen die Feststellungen des Schwurgerichts über die Einteilung des Angeklagten Broad zum Rampendienst und seine Überwachungsfunktionen auf der Rampe auch noch auf der Einlassung des Angeklagten Boger. Boger hat eingeräumt, als Angehöriger der Politischen Abteilung zum Rampendienst eingeteilt gewesen zu sein und diesen Dienst auch versehen zu haben. Wenn aber Boger als Mitglied der Politischen Abteilung zum Rampendienst eingeteilt worden ist, so ist der Schluss gerechtfertigt, dass auch Broad als Mitglied der Politischen Abteilung zum Rampendienst befohlen worden ist. Denn die Angehörigen der verschiedenen Abteilungen wurden abwechselnd zum Rampendienst eingeteilt. Es ist kein Grund ersichtlich, warum man Broad von dieser Einteilung hätte ausnehmen sollen. Die Einlassung Bogers stützt auch die Überzeugung des Gerichts, dass Broad auf der Rampe Überwachungsfunktionen ausgeübt hat. Denn Boger hat eingeräumt, solche Funktionen auf der Rampe wahrgenommen zu haben. Wenn aber die Überwachungsfunktionen zum Aufgabenbereich der Politischen Abteilung gehörten, so kann nach der Überzeugung des Gerichts ohne weiteres gefolgert werden, dass auch Broad diese Funktionen während des Rampendienstes wahrgenommen hat. Die Annahme, Broad sei nur als Zuschauer zur Rampe befohlen worden, wäre lebensfremd.
Das Schwurgericht hat auch keine Zweifel, dass Broad den Grund für die Tötungen der Juden kannte. Allen SS-Angehörigen im KL Auschwitz war klar, dass die jüdischen Menschen nur deswegen getötet wurden, weil sie Juden waren, also wegen ihrer Abstammung.
Es kann auch nicht zweifelhaft sein, dass der Angeklagte Broad genau die Umstände gekannt hat, unter denen die Opfer getötet wurden. Er selbst hat die Frau, die sich auf Grund der Warnung durch einen Häftling an ihn gewandt hatte, bewusst über ihr bevorstehendes Schicksal, die Tötung durch Gas, getäuscht. Das zeigt, dass ihm die gesamten Täuschungsmanöver, unter denen die jüdischen Menschen zu den Gaskammern geführt wurden, geläufig waren. Ferner hat er bei seiner Vernehmung selbst eingeräumt, gewusst zu haben, dass die jüdischen Menschen zunächst in den beiden umgebauten Bauernhäusern und später in den neu gebauten vier Krematorien durch Gas getötet würden. Wenn auch nicht mit Sicherheit feststeht, ob er selbst solche Vergasungen in den Bauernhäusern oder in den Krematorien beobachtet hat, so waren ihm die Umstände, unter denen die Menschen starben, dennoch bekannt. Einmal wurde darüber unter den SS-Angehörigen in Auschwitz trotz Verbotes gesprochen; zum anderen hat er nach seiner eigenen Einlassung einmal im Stammlager von seinem Dienstzimmer aus eine Vergasung im kleinen Krematorium beobachtet. Er hat gesehen, wie SS-Angehörige das Zyklon B eingeworfen haben und er hat das Geschrei der Opfer gehört. Somit war ihm klar, unter welchen Umständen die jüdischen Menschen sterben mussten, da die Tötungsart in den Bauernhäusern und in den vier Krematorien die gleiche war wie im kleinen Krematorium im Stammlager.
Die Überzeugung, dass dem Angeklagten Broad auch klar geworden ist, durch seine Tätigkeit auf der Rampe die Vernichtungsaktion zu fördern, hat das Schwurgericht aus dem geschilderten objektiven Sachverhalt gewonnen. Dem intelligenten Angeklagten Broad kann nicht verborgen geblieben sein, dass er, wenn er den Rampendienst versah und Häftlinge und SS-Angehörige überwachte, für den reibungslosen Ablauf der Vernichtungsaktionen einen Tatbeitrag leistete. Vor allem musste ihm das klar sein und war ihm nach der Überzeugung des Gerichts auch klar, als er die Frau bewusst über ihre bevorstehende Tötung täuschte. Denn hier liegt es auf der Hand, dass er durch diese Täuschung Unruhe unter den jüdischen Menschen und Schwierigkeiten bei der Durchführung der Vernichtungsaktionen verhindern wollte und auch verhindert hat.
Es war nicht möglich, genau festzustellen, wie oft der Angeklagte Broad Überwachungsfunktionen auf der Rampe ausgeübt hat. Das Gericht hat sich daher, da es das Urteil nicht auf unsichere Schätzungen stützen durfte, darauf beschränkt, eine Mindestzahl festzustellen und diese dem Urteil zugrunde zu legen. Nach den übereinstimmenden Aussagen der Zeugen Erich K. und Pal. hat der Angeklagte Broad wiederholt, also mehr als einmal, somit mindestens zweimal, Rampendienst auf der Rampe in Birkenau versehen. In einem dieser beiden Fälle hat er die jüdische Frau über ihr bevorstehendes Schicksal getäuscht und den Häftling zur Meldung gebracht.
Die Rampe in Birkenau wurde erst im Jahre 1944 in Betrieb genommen. Zu dieser Zeit waren die RSHA-Transporte durchschnittlich 3000 Personen stark. Hiervon wurden höchstens 25% als arbeitsfähig in das Lager aufgenommen, 75% getötet. Um ganz sicher zu gehen, hat das Gericht nur eine Mindestzahl von je 1000 Personen, die jeweils von diesen beiden Transporten getötet worden sind, festgestellt und dem Urteil zugrunde gelegt.
3. Zu II.2.
Die Feststellungen unter II.2. beruhen zunächst auf der Einlassung des Angeklagten Broad. Der Angeklagte Broad hat eingeräumt, dass er von Grabner zu Bunkerentleerungen bestellt und mindestens drei- bis viermal zu Bunkerentleerungen in den Arrestbunker mitgenommen worden sei. Er hat ferner eingeräumt, dass er auch mindestens zweimal bei den anschliessenden Erschiessungen dabeigewesen sei, wobei er drei bis fünf Meter von der Schwarzen Wand entfernt gestanden habe. Allerdings will er angeblich nicht gewusst haben, warum man ihn überhaupt mitgenommen habe. Er habe - so hat er behauptet - bei den Bunkerentleerungen nichts zu tun gehabt. Insoweit ist seine Einlassung unglaubhaft.
Es wäre lebensfremd anzunehmen, dass Grabner den Angeklagten Broad nur als unbeteiligten Zuschauer bei den Bunkerentleerungen und den Erschiessungen hätte dabei haben wollen. Denn Grabner musste einerseits ein Interesse daran haben, den Kreis der an den Bunkerentleerungen und Erschiessungen Beteiligten möglichst klein zu halten, damit über die eigenmächtigen Erschiessungen, die auch nach der damaligen Auffassung der SS-Führung rechtswidrig waren, nichts in die Aussenwelt dränge. Jeder Zuschauer, der nicht in die rechtswidrigen Tötungen verstrickt war, konnte für Grabner gefährlich werden, wenn er hierüber einer übergeordneten Dienststelle berichtete oder anderen davon erzählte. Es erscheint daher unwahrscheinlich, dass Grabner mehr SS-Angehörige als unbedingt nötig zur Durchführung der Erschiessungsaktionen mit hineingezogen hat.
Andererseits mussten die SS-Führer Aumeier und Grabner mit verzweifelten Aufstands- oder Widerstandshandlungen der zum Tode bestimmten Menschen rechnen. Denn Menschen, die den Tod als unausweichlich vor Augen sehen, können in aussichtsloser Situation zu allem fähig sein. Da häufig eine grössere Anzahl von Häftlingen zum Tode bestimmt und nicht einzeln, sondern in einer Gruppe ausserhalb der Zellen aufgestellt und geschlossen zum Waschraum geführt wurde, lag diese Gefahr um so näher, zumal es sich bei den Arrestanten oft um entschlossene und nationalbewusste Polen handelte. Grabner musste daher dafür sorgen, dass genügend SS-Angehörige anwesend waren, die kraft ihrer Anzahl solche verzweifelten Widerstands- oder Aufstandshandlungen von vornherein als aussichtslos für die Opfer erscheinen lassen mussten und die, falls trotzdem ein Aufstand gewagt werden sollte, in der Lage waren, diesen im Keim zu ersticken. Dass Grabner daran gedacht hat, ergibt sich aus der Einlassung des Angeklagten Dylewski, der eingeräumt hat, dass Grabner ihm solche Sicherungsaufgaben zugewiesen und ihm befohlen habe, sich für einen verzweifelten Aufstand der Häftlinge bereit zu halten und diesen, falls er erfolgen sollte, zu verhindern.
Das Gericht ist daher überzeugt, dass der Angeklagte Broad nicht nur als unbeteiligter Zuschauer zu den Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen mitgenommen worden ist, sondern dass er von Grabner die gleichen Sicherungsaufgaben wie der Angeklagte Dylewski zugewiesen bekommen hat und dass dem Angeklagten Broad entgegen seiner Einlassung auch durchaus bewusst gewesen ist, dass er für den reibungslosen Ablauf der Aktion im Bunker und an der Schwarzen Wand mitverantwortlich war.
Der Angeklagte Broad hat sich weiter dahin eingelassen, dass er geglaubt habe, die Exekutionen auf Block 11, beziehungsweise an der Schwarzen Wand, erfolgten auf Grund von Standgerichtsurteilen oder auf Grund von Exekutionsbefehlen. Er habe sie daher für rechtmässig gehalten. Auch diese Einlassung ist unglaubhaft und nur eine Schutzbehauptung. Sie wird bereits widerlegt durch seine schriftlichen Aufzeichnungen, die er in dem sog. Broad-Bericht im Jahre 1945 gemacht hat. In dem Bericht hat er die Erschiessungen an der Schwarzen Wand nach Bunkerentleerungen beschrieben. Er hat nichts davon erwähnt, dass die Erschiessungen auf Grund von Urteilen oder auf Grund von Befehlen höherer Dienststellen erfolgt seien. Vielmehr hat er eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass Grabner das Wochenende dazu benutzt habe, den Bunker "auszustauben". Er hat dann eingehend beschrieben, wie die Kommission, bestehend aus mehreren SS-Angehörigen begonnen hat, den Bunker "auszustauben" und wie dann dieses "Ausstauben" im einzelnen vor sich gegangen ist. Unter anderem hat er wörtlich ausgeführt: "Aumeier hält eine Liste aller Arretanden gegen die Tür, über die er nun mit Grabner zusammen hier unten Gericht halten will." Weiter hat er in dem Bericht angegeben, dass Grabner über das Schicksal der Häftlinge, die von der Politischen Abteilung eingesperrt worden seien, entschieden habe und dass Aumeier in den Fällen, in denen die Häftlinge von der Schutzhaftlagerführung in den Arrest verbracht worden seien, entschieden habe. Daraus ergibt sich bereits eindeutig, dass der Angeklagte Broad bereits damals genau gewusst hat, dass die Erschiessungen nicht durch Gerichtsurteile oder Befehl des RSHA oder sonstiger höherer SS-Dienststellen gedeckt waren, sondern eigenmächtig von Grabner oder Aumeier angeordnet wurden. Dass diese hierzu nicht befugt und die Tötungen daher unrechtmässig waren, war dem Angeklagten Broad damals ebenfalls klar. Das ergibt sich ebenfalls aus dem Bericht. Bei der Beschreibung der Erschiessungen durch Palitzsch hat Broad nämlich wörtlich unter anderem ausgeführt: "Er (Palitzsch) ist stolz darauf, ohne jede Gewissensempfindungen diese unschuldigen Menschen umzubringen .... Nach etwa einer Stunde ist dieses unbeschreiblich grauenhafte Schauspiel vorbei. Grabner hat seinen Bunker "ausgestaubt" und sitzt nun bei einem guten Frühstück ...."
Im übrigen gilt insoweit für den Angeklagten Broad das gleiche, war bereits unter E.III.3. bzgl. des Angeklagten Dylewski ausgeführt worden ist. Auch dem Angeklagten Broad waren alle Umstände bekannt, aus denen sich ergibt, dass die Erschiessungen ohne Gerichtsurteile und ohne Befehle des RSHA oder höherer Dienststellen erfolgt sind. Ihm musste sich daher ebenso wie dem Angeklagten Boger und dem Angeklagten Dylewski die Erkenntnis aufdrängen, dass keine Urteile und keine Befehle den Tötungen zugrunde liegen konnten. Auch ohne den Broad-Bericht stünde es daher zur Gewissheit des Gerichtes fest, dass der Angeklagte Broad gewusst hat, dass die Erschiessungen eigenmächtig ohne Gerichtsurteil und ohne Befehle höherer SS-Dienststellen erfolgt sind und daher unrechtmässig waren.
Aus dem erwähnten Teil des Broad-Berichtes ergibt sich schliesslich, dass dem Angeklagten Broad auch bekannt war, dass die Erschiessungen zum Zwecke des "Ausstaubens" d.h. um Platz für weitere Arrestanten zu schaffen, erfolgt sind. Von der Art der Durchführung der Erschiessungen und ihrer Vorbereitung hat der Angeklagte Broad ebenfalls Kenntnis genommen, was sich daraus ergibt, dass er sie von Anfang bis Ende miterlebt hat.
Wie oft der Angeklagte Broad an den Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen teilgenommen hat, konnte nicht geklärt werden. Das Gericht hat sich daher darauf beschränkt, Mindestzahlen festzustellen. Nach der Einlassung des Angeklagten Broad hat er an mindestens zwei Erschiessungen, denen Bunkerentleerungen vorausgegangen waren, teilgenommen. Er hat zwar nicht angegeben, wieviel Menschen bei diesen Erschiessungen getötet worden sind. Da jedoch bei Bunkerentleerungen stets eine grössere Anzahl von Häftlingen für den Tod bestimmt und erschossen worden ist, konnte das Gericht - ebenso wie im Falle Dylewski, der als Mindestanzahl zehn Häftlinge pro Bunkerentleerung und Erschiessung angegeben hat - mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass in jedem der beiden Fälle mindestens zehn Menschen getötet worden sind.
IV. Rechtliche Würdigung der unter II. getroffenen Feststellungen
1. Zu II.1.
Der Angeklagte Broad hat in den festgestellten mindestens zwei Fällen die Taten der Haupttäter (vgl. oben A.V.1.) dadurch gefördert, dass er durch die Überwachung der Angehörigen des Häftlingskommandos und die Überwachung der an der Abwicklung der RSHA-Transporte beteiligten SS-Angehörigen für einen reibungslosen Ablauf der Vernichtungsaktionen gesorgt hat. In einem Fall hat er darüber hinaus zur Täuschung der Opfer beigetragen, indem er einer durch einen Häftling gewarnten Frau vorgespiegelt hat, der Häftling habe sie belogen. Hierdurch hat er die Arglosigkeit der Opfer durch eigene aktive Tätigkeit aufrecht erhalten.
Da er als Angehöriger der Waffen-SS auf Befehl seiner Vorgesetzten den Rampendienst versehen hat, ist seine strafrechtliche Verantwortlichkeit im Rahmen des §47 MStGB zu beurteilen.
Der Angeklagte Broad hat klar erkannt, dass die Befehle, die die Tötung unschuldiger jüdischer Menschen anordneten, Handlungen betrafen, die ein allgemeines Verbrechen bezweckten. Der Angeklagte Broad hat selbst die Vergasungen der Juden als Verbrechen bezeichnet. Im übrigen gilt hier das gleiche, was oben bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Mulka unter A.V.2. ausgeführt worden ist.
Der Angeklagte Broad muss daher wegen seiner Mitwirkung an der Massentötung jüdischer Menschen als Teilnehmer bestraft werden. Auch bei ihm konnte nicht festgestellt werden, dass er die Tötung jüdischer Menschen als eigene Tat gewollt hat. Ein besonderer Hass des Angeklagten Broad auf die Juden oder ein besonderer Eifer beim Rampendienst konnte nicht festgestellt werden. Wenn er den Häftling, der trotz seines Sprechverbotes mit einer der angekommenen Frauen gesprochen hat, zur Bestrafung gemeldet hat, lag das im Rahmen des ihm gegebenen Auftrages und kann noch nicht als besonderer, über die gegebenen Befehle hinausgehender Eifer angesehen werden. Ein persönliches Interesse des Angeklagten Broad an der Vernichtung der Juden war nicht ersichtlich. Auch das sonstige Verhalten des Angeklagten Broad im KL Auschwitz lässt keine Schlüsse auf einen Täterwillen zu. Das Gericht konnte daher nur feststellen, dass der Angeklagte Broad die Mordtaten der Haupttäter befehlsgemäss fördern und unterstützen wollte.
Der Angeklagte Broad, für dessen Mitwirkung an den Massentötungen jüdischer Menschen keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich sind, hat auch vorsätzlich gehandelt. Er hat - wie sich aus den Feststellungen unter II.1. ergibt - gewusst, dass er durch seine Überwachungstätigkeit die Vernichtungsaktionen förderte und somit einen kausalen Beitrag zu den Massentötungen leistete. Das wollte er auch. Ferner kannte er - wie sich ebenfalls aus den Feststellungen unter II.1. ergibt - die gesamten Tatumstände, die die Beweggründe der Haupttäter als niedrig und die Art der Ausführung der Tötung als heimtückisch und grausam kennzeichnen. Dass er auch das Bewusstsein gehabt hat, Unrecht zu tun, ergibt sich daraus, dass er die Tötungsbefehle als verbrecherisch erkannt und auch gewusst hat, dass die Tötung unschuldiger jüdischer Menschen ein allgemeines Verbrechen ist. Irgendwelche Umstände, aus denen er hätte entnehmen können, dass seine Mitwirkung gerechtfertigt sei, lagen nicht vor. Er hat auch nicht irrig das Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen eines Rechtfertigungsgrundes angenommen. Das behauptet er selbst nicht. Schliesslich hat er auch nicht irrig angenommen, dass die verbrecherischen Befehle, weil sie von der höchsten Staatsführung ausgegangen sind, trotz ihres verbrecherischen Charakters für ihn bindend gewesen seien. Hierzu kann auf die Ausführung unter A.V.2. Bezug genommen werden.
Dem Angeklagten Broad ist seine Mitwirkung bei der Massentötung jüdischer Menschen auch nicht durch eine wirkliche oder vermeintliche Drohung mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben abgenötigt worden. Er beruft sich nicht darauf, dass sein Wille gebeugt worden sei. Er ist ebenso wie der Angeklagte Dylewski gar nicht auf die Idee gekommen, sich den verbrecherischen Befehlen seiner Vorgesetzten zu entziehen und ihre Ausführung abzulehnen. Er hat ebenso wie die anderen SS-Angehörigen sein Gewissen zum Schweigen gebracht und in blindem Gehorsam alles ausgeführt, was ihm befohlen wurde im Vertrauen darauf, dass er wegen seiner Mitwirkung an den Massentötungen nicht zur Verantwortung gezogen werden würde. Sonstige Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich.
Der Angeklagte Broad war daher wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zu gemeinschaftlichem Mord in mindestens zwei Fällen (§§47, 49, 211, 74 StGB) begangen jeweils in gleichartiger Tateinheit (§73 StGB) an mindestens je 1000 Menschen zu bestrafen.
2. Zu II.2.
Der Angeklagte Broad hat die Tötung der Häftlinge in den festgestellten zwei Fällen dadurch gefördert, dass er durch seine befohlene Anwesenheit im Arrestbunker und anschliessend auf dem Hof und durch die befohlene Übernahme von Sicherungsaufgaben die reibungslose Durchführung der Erschiessungen im Zusammenwirken mit anderen SS-Angehörigen ermöglicht hat. Damit hat er einen kausalen Beitrag zu den Tötungen geleistet. Das war ihm auch bewusst. Da er auf Befehl Grabners, seines unmittelbaren Vorgesetzten, gehandelt hat, ist seine strafrechtliche Verantwortlichkeit im Rahmen des §47 MStGB zu prüfen. Der Angeklagte Broad hat nach der Überzeugung des Gerichts klar erkannt, dass die Erschiessungen der im Arrestbunker einsitzenden Häftlinge ein allgemeines Verbrechen waren. Wie sich aus den Feststellungen unter II.2. ergibt, hat Broad gewusst, dass die Tötungen ohne Gerichtsurteil und nicht auf Grund von Befehlen höherer SS-Dienststellen erfolgt sind. Soweit Broad das Gegenteil behauptet, ist das nur eine Schutzbehauptung, wie unter III.3. näher ausgeführt worden ist. Damit entfällt auch sein Argument für seinen angeblichen Glauben an die Rechtmässigkeit der Tötungen. Der Angeklagte Broad wusste - ebenso wie Boger und Dylewski und alle anderen SS-Angehörigen -, dass weder Grabner noch Aumeier befugt waren, eigenmächtig Tötungen von Häftlingen anzuordnen.
Den Angeklagten Broad trifft daher für seine Mitwirkung an den Bunkerentleerungen und den anschliessenden Tötungen die Strafe des Teilnehmers. Auch hier konnte jedoch nicht festgestellt werden, dass der Angeklagte Broad die Tötungen der Häftlinge zu seiner eigenen Sache gemacht, somit mit Täterwillen gehandelt hat. Einen besonderen Eifer hat der Angeklagte Broad nach den getroffenen Feststellungen nicht gezeigt. Auch konnte nicht festgestellt werden, dass er sich zu den Erschiessungen nach Bunkerentleerungen vorgedrängt oder sonst massgeblichen Einfluss auf die Auswahl der zu tötenden Häftlinge genommen habe. Auch das sonstige Verhalten des Angeklagten Broad lässt keine Schlüsse auf einen Täterwillen zu. Der Zeuge van V., der im Zigeunerlager als Blockältester eingesetzt war, hat den Angeklagten Broad positiv beurteilt. Nach der Meinung dieses Zeugen passte der Angeklagte Broad nicht in die SS. Der Zeuge hat nie selbst gesehen oder gehört, dass Broad einen Häftling geschlagen habe, obwohl Broad nach der Aussage des Zeugen täglich in das Zigeunerlager hineingekommen ist. Einmal verriet ein Häftling dem Angeklagten Broad, dass der Zeuge van V. Geld habe. Der Besitz von Geld war verboten. Der Angeklagte Broad machte bei dem Zeugen van V. eine Durchsuchung und fand das Geld. Gleichwohl meldete er den Zeugen van V. nicht, so dass diesem nichts passierte. Der Zeuge van V. ist glaubwürdig. Er war als holländischer Offizier in das KL Auschwitz eingewiesen worden. Jetzt ist er Oberst in der holländischen Armee. Er hat seine Aussage klar, präzise und sachlich gemacht. Bedenken, dass er in der einen oder anderen Richtung übertrieben hätte, bestehen nicht.
Auch der Zeuge Bur. hat günstig über den Angeklagten Broad ausgesagt. Der Zeuge kannte den Angeklagten Broad, da er als Reiniger in der Politischen Abteilung tätig war, ebenso wie die Angeklagten Boger und Dylewski. Der Zeuge konnte nicht feststellen, dass Broad die Häftlinge bei Vernehmungen misshandelt oder geschlagen hätte. Einmal beauftragte der Angeklagte Broad den Zeugen Bur., misshandelten und gefolterten Häftlingen, die von Angehörigen der Kattowitzer Gestapo "vernommen" worden waren, Wasser zu bringen. Dabei brachte er seine Empörung über die Vernehmungsmethode der Kattowitzer Gestapo zum Ausdruck. Ein andermal sollte der Angeklagte Broad eine Gruppe jüdischer Menschen, die von deutschen Polizisten gebracht worden waren und bewacht wurden, auf dem Motorrad nach Birkenau zu den Gaskammern geleiten, da die Polizisten den Weg nicht kannten. Nach der glaubhaften Aussage des Zeugen Bur. entzog sich Broad jedoch dieser Aufgabe, indem er einem SS-Führer gegenüber erklärte, er habe ein krankes Bein und könne nicht mit dem Motorrad fahren. Tatsächlich war Broad jedoch gesund.
Auch die Zeugin Meh. hat Broad dahin charakterisiert, dass er nicht der Typ eines SS-Mannes gewesen sei. Das Protokoll über die Vernehmung dieser Zeugin wurde verlesen, da die Zeugin verstorben ist.
Die Zeugin Hilli Wei. hat den Angeklagten Broad als den "anständigsten Menschen der Lagerverwaltung" bezeichnet. Das richterliche Protokoll über die Vernehmung dieser Zeugin wurde verlesen, da die Zeugin wegen Erkrankung in der Hauptverhandlung nicht vernommen werden konnte. Allerdings ist zweifelhaft, ob man der Zeugin in der Beurteilung des Angeklagten Broad folgen kann. Von den Zeuginnen Wa., Maj. und Scha. wurde der Angeklagte Broad als klug, intelligent, raffiniert, undurchsichtig und hinterlistig charakterisiert. Keine der Zeuginnen hat jedoch über konkrete Fälle berichten können, aus denen der Schluss auf einen Täterwillen des Angeklagten Broad bei den Erschiessungen nach Bunkerentleerungen gezogen werden konnte. Nach der Aussage der Zeugin Wa. hat Broad russischen Kriegsgefangenen bei Vernehmungen zunächst höflich Platz angeboten. Dann hat er sie allerdings beschimpft mit Ausdrücken wie "Du russisches Schwein", "Wie kannst Du sitzen bleiben, wenn ein SS-Mann sitzt". Dabei habe sich Broad - so gab die Zeugin an - amüsiert. Er habe sich überhaupt über alles im Lager amüsiert. Im übrigen habe Broad bei Vernehmungen auch geschlagen. Doch wisse sie nicht, ob jemand an den Schlägen gestorben sei. Nähere Einzelheiten konnte die Zeugin nicht angeben. Irgendwelche Erkenntnisse für die hier interessierende Frage lassen sich aus der Aussage der Zeugin nach Auffassung des Schwurgerichts nicht gewinnen.
Über die Vernehmungsmethoden Broads haben noch weitere Zeugen Angaben gemacht. Aus ihnen ergibt sich kein einheitliches Bild. Hierüber werden noch Ausführungen bei der Erörterung des Punktes 3 des den Angeklagten Broad betreffenden Eröffnungsbeschlusses in einem späteren Abschnitt zu machen sein. Hier sei nur erwähnt, dass der Schuldvorwurf in Ziffer 3 des Eröffnungsbeschlusses durch die Beweisaufnahme nicht bestätigt worden ist. Es konnte nicht festgestellt werden, dass Broad bei Vernehmungen einen Häftling getötet hat. Damit ergeben sich auch keine sicheren Beweisanzeichen dafür, dass Broad mit Täterwillen bei den Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen mitgewirkt hat. Der Zeuge Fab. hat den Angeklagten Broad, wie bereits oben bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Dylewski unter E.III.3. ausgeführt worden ist, schwer belastet. Dort ist jedoch bereits ausgeführt, dass das Gericht nicht die sichere Überzeugung davon gewinnen konnte, dass der Zeuge Fab. den Angeklagten Broad irrtumsfrei erkannt, bzw. wiedererkannt hat und dass Bedenken gegen die Zuverlässigkeit dieses Zeugen bestehen.
Der Zeuge Wei. will ebenso wie der Zeuge Fab. den Angeklagten Broad in der Hauptverhandlung wiedererkannt haben. In der Sitzung vom 6.11.1964 zeigte der Zeuge bei der Gegenüberstellung mit den Angeklagten auf den Angeklagten Broad und erklärte wörtlich: "Ich meine, den kenne ich auch von Block 11, den Namen kenne ich nicht." Dabei war sich der Zeuge jedoch nicht ganz sicher. In der Sitzung vom 12.11.1964 wurde der Zeuge von der Staatsanwaltschaft nach dem Angeklagten mit der Brille gefragt, den er am 6.11.1964 zu erkennen geglaubt habe. Dabei zeigte der betreffende Staatsanwalt auf den Angeklagten Dylewski, der einige Reihen hinter dem Angeklagten Broad sass. Der Zeuge Wei. bekundete nun in bezug auf den Angeklagten Dylewski in der Meinung, es sei der von ihm am 6.11.1964 als bekannt bezeichnete (Broad), dass er auch einige Male an der Schwarzen Wand gewesen sei, wenn Frauen hingerichtet worden seien. Auf seinen Irrtum hingewiesen, erklärte der Zeuge, er sei sich nicht sicher gewesen, die beiden (Broad und Dylewski) sähen sich ähnlich. Er erinnere sich nicht an Dylewski. Broad, den er nicht mit dem Namen gekannt habe, habe jedoch eigenhändig Menschen erschossen. Ob er auch auf Frauen geschossen habe, das wisse er nicht.
Das Schwurgericht konnte auf diese Aussage hin keine sicheren Feststellungen in bezug auf den Angeklagten Broad treffen. Schon bei dem angeblichen Wiedererkennen am 6.11.1964 zeigte sich eine gewisse Unsicherheit bei dem Zeugen. Der Zeuge brachte dies auch durch seine vorsichtige Formulierung "er meine", ihn (Broad) wiederzuerkennen, zum Ausdruck. Die Verwechslung in der Sitzung vom 12.11.1964 aber macht deutlich, dass der Zeuge kein zuverlässiges Erinnerungsbild mehr an die damaligen SS-Schützen hat und er möglicherweise den Angeklagten Broad mit einem anderen SS-Mann, der an der Schwarzen Wand Menschen erschossen hat, verwechselt. Der Angeklagte Broad hat allerdings selbst bei seiner Vernehmung durch den Zeugen Ae. im Ermittlungsverfahren - wie der Zeuge Ae. glaubhaft bekundet hat - eingeräumt, es könne möglich sein, dass er auch selbst an der Schwarzen Wand geschossen habe. Ja. habe ihm einmal gesagt, er (Broad) habe ihm bald in die Hand geschossen. Wenn sich auch aus dieser Aussage des Angeklagten Broad ergibt, dass er selbst an der Schwarzen Wand eigenhändig Menschen erschossen hat, so lässt sich jedoch nicht mehr mit Sicherheit feststellen, ob er Arrestanten nach sog. Bunkerentleerungen erschossen hat oder, ob die Opfer seiner Genickschüsse zum Tode verurteilte Menschen (durch Stand- oder Sondergerichtsurteile) gewesen sind. Eine exakte rechtliche Beurteilung ist daher nicht möglich, da weder im objektiven noch subjektiven Bereich sichere Tatsachenfeststellungen getroffen werden können. Die Tatsache allein, dass er auch eigenhändig geschossen hat (selbst nach Bunkerentleerungen), wäre im übrigen noch kein sicherer Beweis, wenn auch ein starkes Indiz für seinen Täterwillen, da er möglicherweise nur auf Befehl gehandelt haben könnte.
Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass keine sicheren Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass der Angeklagte Broad mit Täterwillen an den Erschiessungen nach sog. Bunkerentleerungen mitgewirkt hat. Es konnte nur festgestellt werden, dass er als Gehilfe die Taten Grabners, Aumeiers und Bogers und anderer fördern wollte.
Der Angeklagte Broad, für dessen Mitwirkung keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich sind, hat auch vorsätzlich gehandelt.
Wie sich aus den unter II.2. getroffenen Feststellungen ergibt, war er sich durchaus bewusst, dass er bei den Bunkerentleerungen und anschliessenden Erschiessungen Sicherungsaufgaben zu erfüllen hatte. Diese hat er bewusst und gewollt geleistet. Daraus ergibt sich gleichzeitig, dass ihm auch klar sein musste und nach der Überzeugung des Gerichts auch klar war, dass er zu den Taten einen kausalen Tatbeitrag leistete. Der Angeklagte Broad kannte nach den getroffenen Feststellungen auch die gesamten Tatumstände, die die Beweggründe für die Tötung als niedrig und die Art ihrer Ausführung als grausam kennzeichnen. Der Angeklagte Broad hat auch das Bewusstsein gehabt, Unrecht zu tun. Unter III.3. ist im einzelnen ausgeführt worden, dass seine Behauptung, er habe geglaubt, die Erschiessungen seien durch Urteile und Exekutionsbefehle höherer Dienststellen gedeckt und daher rechtmässig, eine Schutzbehauptung ist und dass der Angeklagte Broad erkannt hat, dass die Häftlinge unschuldig getötet wurden und daher die Erschiessungen unrechtmässig waren.
Irgendwelche Schuldausschliessungsgründe liegen nicht vor. Der Angeklagte Broad beruft sich nicht darauf, dass er sich in einem Befehlsnotstand (§52 StGB) oder einem allgemeinen Notstand (§54 StGB) befunden habe und dass ihm seine Mitwirkung durch Beugung seines Willens abgenötigt worden sei. Es liegen auch sonst keine Anhaltspunkte für das Vorliegen solcher Notstände vor. Der Angeklagte Broad hat nie irgendeinen Versuch gemacht, sich der Mitwirkung an den Bunkerentleerungen und den Erschiessungen zu entziehen. Für den intelligenten Angeklagten, der gewusst hat, dass Grabner die Erschiessung von Häftlingen auch nach den damaligen Anschauungen der SS-Führung nicht eigenmächtig befehlen durfte, wäre es leicht gewesen, Meldung über die rechtswidrigen Tötungen an vorgesetzte Dienststellen (RSHA) zu erstatten, um diese zu unterbinden oder sich nicht daran beteiligen zu müssen.
Aus den gleichen Gründen bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Angeklagte Broad irrig die tatsächlichen Voraussetzungen eines Nötigungsnotstandes oder eines allgemeinen Notstandes angenommen hätte. Er beruft sich auch selbst nicht darauf.
Die Erschiessung eines jeden Häftlings ist als eine selbständige Handlung im Sinne des §74 StGB anzusehen. Es kann hierzu auf die bereits gemachten Ausführungen Bezug genommen werden (C.V.3.).
Der Angeklagte Broad war daher wegen seiner Beteiligung an den Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zu gemeinschaftlichem Mord in mindestens zwanzig Fällen (§§47, 49, 211, 74 StGB) zu bestrafen.
V. Strafzumessung
Insgesamt musste gegen den Angeklagten eine Gesamtstrafe wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in 22 Fällen ausgesprochen werden. Der Findung der angemessenen Einzelstrafen liegen folgende Zumessungserwägungen zugrunde: Der ausserordentlich intelligente und kaum durchschaubare Angeklagte hat sich in allen Situationen im Konzentrationslager Auschwitz, wie auch später nach seiner Gefangennahme, so verhalten, wie es ihm opportun erschien. Er hat sich damals für sein Teil zur Mitwirkung an zahlreichen Mordtaten einspannen lassen, ohne je irgendwelchem Abscheu gegen die ungeheuerliche Ausrottung menschlichen Lebens Ausdruck zu geben.
Demgegenüber spricht für den Angeklagten:
Er hat nach dem Kriege einen ordentlichen Beruf ausgeübt und sich unauffällig geführt. Er ist verhältnismässig jung durch eine Reihe von Zufällen in die Politische Abteilung gelangt und in Situationen gestellt worden, aus denen sich seine Straftaten entwickelten. Er hat sich bei der befohlenen Erfüllung seiner "Aufgaben" im wesentlichen zurückgehalten, hat es wohl deshalb auch nur bis zum SS-Rottenführer gebracht und hat sich, wie die Zeugen Bur. und van V. geschildert haben, jedenfalls gelegentlich auch anständig verhalten, sein Tatbeitrag war nur in einem Falle erheblich; seine Funktionen hatten vergleichsweise geringere Bedeutung.
In dem unter II.1. geschilderten Fall seiner Teilnahme am Rampendienst hat der Angeklagte in Erfüllung seiner "Aufgabe" die Bedenken eines gewarnten Opfers raffiniert zu zerstreuen gewusst; hier erreicht seine Beihilfehandlung grösseres Gewicht. Unter Berücksichtigung der angeführten Strafzumessungsgründe ist daher für diese Tat auf eine Einsatzstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten Zuchthaus erkannt worden, während in allen anderen Fällen die Mindeststrafe von 3 Jahren Zuchthaus als ausreichende Strafe und Sühne erachtet worden ist.
Die Gesamtstrafe wurde bei Beachtung aller angeführten wesentlichen Strafzumessungsgründe gem. §74 StGB auf 4 Jahre Zuchthaus festgesetzt.
G. Die Straftaten des Angeklagten Schlage
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Schlage
Der Angeklagte Schlage wurde am 11.2.1903 als Sohn eines Arbeiters in Truttenau/Krs.Königsberg (Ostpreussen) geboren. Er besuchte die Volksschule von seinem 6. bis zum 14. Lebensjahr zunächst in Truttenau, dann in Itzehoe, wohin seine Eltern im Jahre 1912 verzogen, und schliesslich in Rosengarten bei Langerbrück/Krs.Angerburg (Schleswig-Holstein), nachdem seine Eltern in Langerbrück einen Bauernhof erworben hatten. Nach der Schulentlassung arbeitete der Angeklagte zunächst bei der Reichsbahn. Wegen der schlechten Verdienstmöglichkeiten erlernte er jedoch in 3 Jahren das Maurerhandwerk. Nach der Gesellenprüfung besuchte er 1927 oder 1928 eine Werkmeisterschule. Im Anschluss daran arbeitete er als Maurerpolier bei einer Königsberger Firma, und zwar auf Baustellen, die meist im Ausland (Litauen, Lettland) lagen. Im Jahre 1924 heiratete der Angeklagte. Aus der Ehe sind zwei Söhne hervorgegangen, die jetzt 40 und 38 Jahre alt und verheiratet sind.
Bei Kriegsausbruch lebte der Angeklagte in Königsberg. Er wurde im Frühjahr (März oder April) 1940 zu einer Polizeiverfügungstruppe nach Plock an der Weichsel / Ostpreussen eingezogen und alsbald einer SS-Standarte zugeteilt. Ende des Jahres 1940 oder Anfang 1941 wurde er mit anderen SS-Angehörigen zu dem KZ Auschwitz versetzt. Damals war er SS-Sturmmann. Vor der Versetzung nach Auschwitz will der Angeklagte noch einige Zeit - etwa von Herbst 1940 an - in Tschenstochau gewesen sein.
In Auschwitz wurde der Angeklagte zunächst der 3. Kompanie des Wachsturmbannes zugeteilt. Eine Zeitlang versah er bei dieser Kompanie die Funktionen des Hilfskuriers. Eines Tages - der Angeklagte gibt an, es sei im Frühjahr oder Frühsommer 1942 gewesen, der genaue Zeitpunkt liess sich jedoch nicht mehr feststellen -, wurde der Angeklagte Schlage zum Schutzhaftlager kommandiert und als Läufer, Hilfsblockführer und schliesslich als Blockführer eingesetzt.
Im Herbst 1942 - der genaue Zeitpunkt liess sich nicht mehr feststellen - wurde der Angeklagte Schlage Arrestaufseher in dem Arrestblock 11 des Stammlagers. Diese Funktion übte er mindestens 8-10 Wochen ununterbrochen aus. Anschliessend, etwa von Januar oder Februar 1943 bis Mitte April 1943, war der Angeklagte Kommandoführer eines Häftlingskommandos, das in der Zementfabrik in Golleschau arbeitete. Wegen Fluchtbegünstigung von 3 Häftlingen wurde er dort Mitte April 1943 verhaftet und - wie er sich einlässt - für unbestimmte Zeit in den Arrestblock 11 gebracht, wo er ca. 3 Wochen in Haft gewesen sein will. Anschliessend wurde er wieder im Lagerdienst eingesetzt. Er blieb im Stammlager bis zur Evakuierung dass Lagers. Er gibt an, er sei Ende September oder am 3.10.1943 in das Lazarett gekommen. Im April oder Mai 1944 sei er aus dem Lazarett entlassen worden und nach Auschwitz zurückgekommen. Anschliessend habe er, so gibt er an, 10 Wochen Genesungsurlaub bekommen, den er bei seiner Familie in Königsberg verbracht habe. Anschliessend habe er noch 8 Wochen Erholungsurlaub nach Gorenka bekommen. Erst im August 1944 sei er nach Auschwitz zurückgekommen und als z.b.V. bei der Postzensur eingesetzt worden. Mit dem Block 11 habe er nichts mehr zu tun gehabt.
Nach der Auflösung des Konzentrationslagers Auschwitz begleitete der Angeklagte, der in Auschwitz noch zum SS-Unterscharführer befördert worden war, einen Häftlingstransport bis zum Konzentrationslager Gross-Rosen. Im Mai 1945 geriet er in polnische Kriegsgefangenschaft und kam in das Lager 66110 bei Bromberg. Er gab sich als Wehrmachtsangehöriger aus. Am 8.8.1949 wurde er aus der Gefangenschaft und der Wehrmacht entlassen und begab sich zu seiner Familie nach Dehme - Bad Oeynhausen, wo er heute noch wohnt.
Seit Oktober 1961 ist der Angeklagte als Hausmeister bei einer Damenmantel- und Kostümfabrik in Gefeld mit einem Bruttoverdienst von zuletzt über 1000.- DM monatlich beschäftigt gewesen. Er bezieht ausserdem eine Unfallrente von 76.30 DM monatlich. Das Eigentum an dem Grundstück, auf dem er wohnt, hat er seinem Sohn übertragen. Ihm und seiner Ehefrau steht noch ein Einsitzrecht zu.
Der Angeklagte hat sich vor und nach der sog. Machtübernahme nie politisch betätigt. Er trat weder der NSDAP noch einer ihrer Gliederungen bei. Er war nur Mitglied der Deutschen Arbeitsfront.
Der Angeklagte ist während der Hauptverhandlung auf Grund des Haftbefehls des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 13.4.1964 verhaftet worden. Seitdem befindet er sich in dieser Sache in Untersuchungshaft.
II. Die Beteiligung des Angeklagten Schlage an sog. Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen von Häftlingen an der Schwarzen Wand (Eröffnungsbeschluss betr. den Angeklagten Schlage)
Der Angeklagte Schlage wurde - wie in seinem Lebenslauf bereits geschildert - im Herbst 1942 Arrestaufseher im Block 11. Er hatte jeweils 12 Stunden Dienst, dann wurde er von einem anderen Arrestaufseher abgelöst. Während der Dienststunden hatte er sich im Block 11 aufzuhalten. Er führte die Aufsicht über die im Block 11 beschäftigten Funktionshäftlinge und hatte für Ruhe, Ordnung und Sauberkeit im Block zu sorgen. Für die im Arrestbunker befindlichen Zellen hatte er die Schlüssel. Morgens schloss er die Zellentüren auf und führte die in den Zellen eingesperrten Häftlinge zum Waschen. Auch war er für die Verteilung des Essens an die Häftlinge verantwortlich.
An den Bunkerentleerungen (vgl. oben C.II.3.) nahm er teil. Er ging mit Grabner, Aumeier und den anderen SS-Angehörigen in den Arrestbunker hinab und schloss dort nacheinander die einzelnen Zellentüren auf. Danach schloss er sie wieder zu. Auch er hatte sich für eventl. Widerstands- und Aufstandshandlungen der Häftlinge im Arrestbunker bereit zu halten und falls es hierzu kommen sollte, diese sofort zu brechen. Nach den Bunkerentleerungen holte er gelegentlich das Kleinkalibergewehr aus der Blockführerstube und trug es zur Exekutionsstätte. Er ging auch mit auf den Hof und griff ein, wenn Häftlinge sich in ihrer Todesangst nicht zur Schwarzen Wand führen lassen wollten. Dann trieb er sie zur Exekutionsstätte. Es gab auch Fälle, dass Häftlinge beim Herausführen aus dem Block 11 sich dem Griff des Bunkerkalfaktors widersetzten, stehen blieben und riefen: "Es lebe Polen!" Dann griff der Angeklagte Schlage ebenfalls ein und half, die Häftlinge zur Schwarzen Wand zu bringen.
Im übrigen hatte sich der Angeklagte Schlage ebenso wie die Angeklagten Broad und Dylewski während der Erschiessungen und schon vorher während des Wartens der Häftlinge im Waschraum und auf dem Flur genauso wie zuvor im Arrestbunker für einen eventl. Widerstand oder Aufstand der Häftlinge bereitzuhalten, um einen solchen im Zusammenwirken mit den anderen SS-Angehörigen sofort niederschlagen zu können. Nach Beendigung der Erschiessungen beaufsichtigte der Angeklagte Schlage das Aufladen der Leichen auf die Rollwagen und ihren Abtransport zum Krematorium.
Der Angeklagte Schlage hat an mindestens acht Bunkerentleerungen und anschliessenden Erschiessungen teilgenommen. In diesen Fällen wurden jeweils mindestens je zehn Häftlinge erschossen. Ob der Angeklagte Schlage auch selbst eigenhändig Häftlinge nach solchen Bunkerentleerungen erschossen hat, konnte trotz erheblichen Verdachts nicht mit letzter Sicherheit festgestellt werden. Der Angeklagte Schlage wusste, dass die Häftlinge ohne Todesurteil und ohne Befehle höherer SS-Dienststellen nur auf Grund der Anordnung der im Arrestbunker versammelten SS-Führer und Unterführer erschossen wurden. Er wusste auch, dass die Erschiessungen zur Räumung des Bunkers, um Platz für weitere Arrestanten zu schaffen, erfolgten. Den gesamten Ablauf der Aktion nahm er als unmittelbar Beteiligter von Anfang bis zum Ende wahr. Dem Angeklagten Schlage war auch klar, dass er durch seine - oben geschilderten - Tätigkeiten die Erschiessungsaktionen förderte und unterstützte.
III. Einlassung des Angeklagten Schlage, Beweismittel, Beweiswürdigung
Der Angeklagte Schlage hat sich widersprüchlich eingelassen. Zunächst hat er eingeräumt, dass er acht bis zehn Wochen als Arrestaufseher im Block 11 gewesen sei. Er hat auch zugegeben, dass er mindestens an einer Bunkerentleerung teilgenommen habe. Dabei will er allerdings nur die Zellentüren aufgeschlossen haben. Im übrigen habe er - so hat er sich eingelassen - mit den Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen nichts zu tun gehabt. Er sei vielmehr nach der einen Bunkerentleerung wieder in sein Dienstzimmer gegangen. Nur gerüchtweise habe er gehört, dass Palitzsch die Häftlinge erschossen habe. Gesehen habe er gar nichts. Nur die Schüsse habe er gehört. Im Widerspruch hierzu hat er dann eingeräumt, dass er auch teilweise auf dem Hof gewesen sei, wenn die Leichen der Erschossenen aufgeladen worden seien. Später ist er von dieser Einlassung wieder abgerückt. Er hat behauptet, nie Arrestaufseher gewesen zu sein. Er sei nur tageweise aushilfsweise zum Block 11 kommandiert worden.
Diese Einlassung des Angeklagten Schlage ist schon in sich unglaubhaft. Auf Grund der Aussagen der Zeugen Wl., Pi. und Bor. steht fest, dass Schlage längere Zeit, und zwar ab Herbst 1942 Arrestaufseher in Block 11 gewesen ist. Der Zeuge Wl., der von Februar 1942 bis Dezember 1942 Schreiber auf Block 11 gewesen ist und anschliessend noch bis April 1943 auf der Quarantänestation im Block 11 blieb, hat glaubhaft bekundet, dass Schlage im Spätherbst 1942 Arrestaufseher geworden sei. Das Gericht hat keine Bedenken, dass die Aussage dieses Zeugen der Wahrheit entspricht. Wl. hat als Blockschreiber täglich mit den Arrestaufsehern zu tun gehabt. Er musste sie daher genau kennen. Seine Bekundung wird bestätigt durch den Zeugen Bor. Dieser war vom 17.12.1942 bis zum 9.3.1943 im Arrest des Blockes 11, wie sich aus der Eintragung im Bunkerbuch ergibt. Er hat den Angeklagten Schlage als Arrestaufseher erlebt. Auch der Zeuge Pi. hat den Angeklagten Schlage als Arrestaufseher kennengelernt. Auch dieser Zeuge, der im Dezember 1942 nach dem Zeugen Wl. Blockschreiber geworden ist, musste täglich mit dem Angeklagten Schlage als Arrestaufseher zusammenarbeiten. Ein Irrtum des Zeugen in der Person des Angeklagten Schlage erscheint daher ausgeschlossen.
Die ursprüngliche Einlassung des Angeklagten Schlage, er sei Arrestaufseher gewesen, verdient daher mehr Glauben, als seine spätere Behauptung, er habe diese Funktion nie ausgeübt. Das Gericht ist daher überzeugt, dass seine ursprüngliche Einlassung, acht bis zehn Wochen Arrestaufseher gewesen zu sein, auf jeden Fall den Mindestzeitraum ergibt, während dessen er die Funktion eines Arrestaufsehers innegehabt hat. Da die Zeugen insoweit keine sicheren Zeitangaben machen konnten, ist das Gericht von dieser Einlassung ausgegangen und hat nur festgestellt, dass der Angeklagte Schlage mindestens acht Wochen Arrestaufseher gewesen ist.
Die Einlassung des Angeklagten Schlage, ausser dem Aufschliessen der Zellentüren nichts mit den Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen zu tun gehabt zu haben, ist jedoch unglaubhaft. Sie verdient schon deswegen keinen Glauben, weil es zu den Aufgaben des Arrestaufsehers, dessen Verantwortlichkeit die Arrestanten unterstanden, gehört hat, für Ruhe und Ordnung im Block 11, insbesondere auch im Arrestbunker, zu sorgen. Es erscheint nur natürlich, dass er bei den Bunkerentleerungen und anschliessenden Erschiessungen auch für die Einhaltung von Ruhe und Ordnung zu sorgen hatte und für deren reibungslose Durchführung eingesetzt wurde. Schlage hat auch indirekt in Widerspruch zu dieser Einlassung zugegeben, dass er doch mit diesen Aktionen etwas zu tun gehabt haben muss, indem er eingeräumt hat, nach den Erschiessungen teilweise beim Aufladen der Leichen im Hof zugegen gewesen zu sein. Damit hat er auch zugegeben, mehr als einmal an solchen Bunkerentleerungen und Erschiessungen teilgenommen zu haben.
Die Überzeugung des Gerichts, dass Schlage in der geschilderten Weise an den Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen beteiligt gewesen ist, stützt sich aber nicht nur auf diese allgemeine Erwägung, sondern auch auf die Einlassung des Angeklagten Dylewski und die glaubhafte Aussage des Zeugen Pi.
Der Angeklagte Dylewski hat - wie oben schon ausgeführt - eingeräumt, dass er von Grabner zum Sicherungs- und Abschirmdienst für eventl. Widerstands- und Aufstandshandlungen der Häftlinge eingeteilt worden ist. Bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Broad ist ausgeführt worden, dass auch Broad diesen Sicherungs- und Abschirmdienst zu versehen hatte. Es wäre kaum zu verstehen, wenn Grabner hierzu nur die Angeklagten Dylewski und Broad eingeteilt hätte. Denn beide allein wären einem verzweifelten Widerstand oder Aufstand der Häftlinge nicht gewachsen gewesen. Das Gericht ist daher überzeugt, dass sich auch der Angeklagte Schlage - ausser seinen sonstigen Aufgaben - für eventl. Aufstands- und Widerstandshandlungen bereit zu halten und gegebenenfalls diese niederzuschlagen hatte. Der Zeuge Pi. hat glaubhaft bestätigt, dass der Angeklagte Schlage mehrfach den Karabiner aus der Blockführerstube geholt und auf den Hof gebracht hat. Er hat auch bemerkt, dass Schlage wiederholt zu den Erschiessungen auf den Hof gegangen und dort geblieben ist. Über weitere Einzelheiten konnte er allerdings nicht berichten, da er selbst während der Erschiessungen nicht auf dem Hof war.
Über die Tätigkeit des Angeklagten Schlage während der Erschiessungen hat der Zeuge Gl. berichtet. Das Schwurgericht hat zwar in gewisser Hinsicht Bedenken an der Zuverlässigkeit der Aussage dieses Zeugen, wie oben bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Dylewski bereits ausgeführt worden ist. Vor allem erscheint es nicht sicher, dass Gl. noch zuverlässig weiss, wer eigenhändig die Häftlinge erschossen hat. Auch im Falle des Angeklagten Schlage wusste der Zeuge nicht mehr zu sagen, ob Schlage selbst Häftlinge erschossen hat. Der Zeuge gab jedoch mit Bestimmtheit an, dass Schlage auf dem Hof Häftlinge mit an die Schwarze Wand getrieben habe, wenn Stockungen eingetreten seien. Insoweit erscheint seine Aussage glaubhaft und zuverlässig. Denn die geschilderte Mitwirkung passt ganz in den Aufgabenbereich des Arrestaufsehers und die gegebene Situation. Sie wird auch zumindest unmittelbar durch die Aussage des Zeugen Pi. bestätigt, wonach Schlage tatsächlich während der Erschiessungen auf dem Hof gewesen ist.
Das Gericht hat daher keine Zweifel, dass der Angeklagte Schlage die geschilderten Tätigkeiten bei den Bunkerentleerungen und den Erschiessungen ausgeübt hat.
Darüber hinaus besteht ein erheblicher Verdacht, dass der Angeklagte Schlage auch eigenhändig Häftlinge nach Bunkerentleerungen erschossen hat. Denn der Angeklagte Broad hat in seinem im Jahre 1945 gemachten Aufzeichnungen bei der Beschreibung einer Erschiessung an der Schwarzen Wand ausgeführt, dass der "Arrestaufseher" diese vollzogen habe. Es steht jedoch nicht mit Sicherheit fest, dass auch der Angeklagte Schlage dies getan hat. Broad nennt den Namen des Angeklagten Schlage in seinem Bericht nicht. Zwar hat auch der Zeuge Wei. bekundet, dass Schlage Menschen eigenhändig an der Schwarzen Wand erschossen habe. Er konnte aber nicht angeben, ob die Opfer, die Schlage erschossen haben soll, nach Bunkerentleerungen zur Exekution gebracht worden sind oder ob es sich bei den Opfern um Personen gehandelt hat, die auf Grund von Sondergerichts- oder Standgerichtsurteilen zur Exekution nach Auschwitz eingeliefert worden waren. Die Erschiessung von solchen Personengruppen wird dem Angeklagten Schlage durch den Eröffnungsbeschluss nicht zur Last gelegt. Auf Grund der Aussage des Zeugen Wei. kann daher nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass Schlage eigenhändig Häftlinge, die nach Bunkerentleerungen zur Exekution gebracht worden sind, getötet hat.
Die genaue Anzahl der Bunkerentleerungen und Erschiessungen, an denen der Angeklagte Schlage in der geschilderten Weise beteiligt war, konnte nicht festgestellt werden. Sie ist unbestimmt. Auch konnte nicht geklärt werden, wieviel Opfer insgesamt unter Mitwirkung des Angeklagten Schlage den Tod fanden. Das Gericht musste sich daher auf die Feststellung von Mindestzahlen beschränken. Nach der eigenen Einlassung des Angeklagten Schlage war er mindestens acht Wochen im Arrestbunker als Arrestaufseher tätig. Die Bunkerentleerungen fanden nach den Aufzeichnungen des Angeklagten Broad (in dem sog. Broad-Bericht) mindestens einmal in der Woche statt. Auch nach der Aussage des Zeugen Se., der sich vom 21.1. bis 13.2.1943 im Arrestbunker befunden hat, war wöchentlich eine Bunkerentleerung. Einige Zeugen haben angegeben, dass zu anderen Zeiten noch häufiger als einmal in der Woche Bunkerentleerungen stattgefunden hätten. So z.B. die Zeugen Brei. und Wö. Die Erinnerung der Zeugen Wl. und Pi. an die Anzahl der Bunkerentleerungen war nicht mehr präzise.
Das Gericht ist daher von den Angaben des Angeklagten Broad in seinem bereits im Jahre 1945 geschriebenen Bericht ausgegangen, da seine Erinnerung damals noch frisch war, und zu der Feststellung gekommen, dass in der Zeit, während der der Angeklagte Schlage Arrestaufseher gewesen ist, mindestens je eine Bunkerentleerung pro Woche, somit insgesamt 8 Bunkerentleerungen gewesen sind.
Nach der Überzeugung des Gerichts sind nach diesen Bunkerentleerungen mindestens jeweils 10 Menschen erschossen worden. Denn bei Bunkerentleerungen wurde stets eine grössere Anzahl von Häftlingen für den Tod bestimmt, um Platz für weitere Arrestanten zu schaffen und anschliessend erschossen. Der Angeklagte Dylewski hat - wie bei der Erörterung seiner Straftaten ausgeführt - eingeräumt, dass in den Fällen, an denen er beteiligt war, mindestens je 10 Häftlinge erschossen worden seien. Es konnte daher - ebenso wie in den Fällen Dylewski und Broad - mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass in jedem Fall mindestens zehn Häftlinge, also insgesamt bei acht Bunkerentleerungen 80 Häftlinge erschossen worden sind.
Der Angeklagte Schlage hat nach der Überzeugung des Gerichts auf Grund der ganzen Situation auch erkannt, dass die Erschiessungen ohne Todesurteile und ohne Befehle höherer Dienststellen erfolgten. Hier gilt im wesentlichen das gleiche, was bereits unter E.III.3. bezüglich des Angeklagten Dylewski ausgeführt worden ist. Auch dem Angeklagten Schlage waren alle Umstände bekannt, aus denen sich ergibt, dass die Erschiessungen erst im Bunker angeordnet worden sind und nicht auf Grund von Todesurteilen oder Befehlen höherer Dienststellen erfolgt sein können. Er erlebte selbst mit, dass erst im Arrestbunker über das Schicksal der Häftlinge entschieden wurde. Demnach konnte er gar nicht auf die Idee kommen, dass es sich um Exekutionen auf Grund von Urteilen oder Befehlen höherer Dienststellen handelte. Das behauptet er auch selbst nicht.
Da Grabner nach den Aufzeichnungen des Angeklagten Broad stets vom "Ausstauben" des Bunkers sprach, hat das Gericht auch keinen Zweifel, dass der Angeklagte Schlage wusste, dass die Erschiessungen erfolgten, um Platz im Bunker für weitere Arrestanten zu schaffen.
Die gesamten Begleitumstände der Bunkerentleerungen und anschliessenden Erschiessungen musste der Angeklagte Schlage zwangsläufig wahrnehmen, da er sie von Anfang bis zu Ende miterlebt hat.
IV. Rechtliche Würdigung der unter II. getroffenen Feststellungen
Die Erschiessung der Häftlinge nach Bunkerentleerungen war Mord (vgl. oben C.V.3.). Der Angeklagte Schlage hat in den festgestellten Fällen diese Mordtaten durch die unter II. näher geschilderten Tätigkeiten gefördert, was keiner näheren Begründung bedarf, und somit einen kausalen Tatbeitrag zu diesen Taten geleistet. Das war ihm nach der gesamten Situation auch bewusst.
Schlage hat bei den Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen auf Befehl seiner Vorgesetzten mitgewirkt. Seine strafrechtliche Verantwortlichkeit ist daher, da er Angehöriger der Waffen-SS gewesen ist, nach §47 MStGB zu beurteilen. Der Angeklagte Schlage hat nach der Überzeugung des Gerichts erkannt, dass die von den SS-Angehörigen im Arrestbunker eigenmächtig angeordneten Tötungen verbrecherisch waren, und dass die ihm gegebenen Befehle, dabei in der geschilderten Art und Weise mitzuwirken, ein allgemeines Verbrechen bezweckten. Er selbst hat erklärt, dass er die in Auschwitz angewandten Methoden, also auch die Erschiessungen nach Bunkerentleerungen, als "verabscheuungswürdig" angesehen habe. Er hat nicht behauptet, dass er sie für rechtmässig gehalten habe. Entschuldigend hat er allerdings hinzugefügt, dass man in Auschwitz nicht mehr habe denken dürfen, das sei ihnen abgenommen worden. Damit hat er eingeräumt, sich darüber im klaren gewesen zu sein, dass die Erschiessungen nach Bunkerentleerungen unrechtmässig gewesen sind. Im übrigen gilt auch hier, da er nach den getroffenen Feststellungen wusste, dass weder Gerichtsurteile, noch irgendwelche Befehle höherer Dienststellen den Tötungen zugrunde lagen, das bezüglich des Angeklagten Dylewski unter E.IV.2. Ausgeführte.
Den Angeklagten Schlage trifft daher für seine Mitwirkung die Strafe des Teilnehmers.
Es konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass der Angeklagte Schlage die Tötungen innerlich bejaht und sie zu seiner eigenen Sache gemacht, somit mit Täterwillen gehandelt hat, wenn auch ein erheblicher Verdacht dafür besteht, Der Angeklagte Schlage war ein williger Befehlsempfänger. Häftlingen gegenüber war er brutal und grausam. Bei der Behandlung der Häftlinge zeigte er sich unbarmherzig und ohne Mitleid. Wenn Häftlinge zu nahe an den Block 11 herankamen, rief er sie zu sich, nahm sie mit auf den Block 11 und schlug sie dort. Nach der glaubhaften Bekundung des Zeugen Pi. hatte Schlage daher den Ruf eines brutalen und grausamen SS-Mannes. Einmal erschoss Schlage - wie der Zeuge Pi. ebenfalls glaubhaft bekundet hat - eine schwangere Frau im Waschraum mit dem Karabiner. Sie war als Polizeihäftling in den Block 11 eingeliefert worden. Eines Tages musste sie der Zeuge Pi. rufen. Er führte die Frau in den Waschraum. Sie war ahnungslos. Der Zeuge blieb auf dem Korridor. Kurz danach kam der Angeklagte Schlage mit dem Karabiner. Er ging in den Waschraum hinein und erschoss dort sofort die ahnungslose Frau. Nach der Erschiessung wurde die Leiche von dem Arzt aufgeschnitten. Der Arzt entnahm der Leiche - offenbar um irgendwelche Untersuchungen anzustellen - irgendwelche Organe oder Fleischteile. Die näheren Umstände konnten nicht aufgeklärt werden. Zu Gunsten des Angeklagten Schlage muss daher davon ausgegangen werden, dass ihm diese Erschiessung befohlen worden ist. Der Fall, der nicht angeklagt und nicht im Eröffnungsbeschluss enthalten ist und daher nicht zu einer Verurteilung des Angeklagten Schlage führen konnte, zeigt aber, dass der Angeklagte Schlage ungerührt und mitleidlos Erschiessungsbefehle ausgeführt hat.
Seine Einstellung Häftlingen gegenüber sowie die brutale Erschiessung der schwangeren Frau im Waschraum könnten als Beweisanzeichen dafür angesehen werden, dass Schlage auch die Erschiessungen der Häftlinge nach Bunkerentleerungen für richtig hielt, innerlich bejahte und zu seiner eigenen Sache gemacht hat. Wenn das Schwurgericht gleichwohl Zweifel an einer solchen inneren Einstellung des Angeklagten Schlage nicht überwinden konnte, so deswegen, weil er nach den getroffenen Feststellungen bei den Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen nicht durch besonderen Eifer auffiel, sich auch nicht zu den Erschiessungen selbst drängte und auch sonst keine Anzeichen erkennbar geworden sind, dass er Häftlinge, die im Bunker einsassen, den massgebenden SS-Führern unter irgendwelchen Vorwänden zur Tötung vorgeschlagen oder ihre Tötung als notwendig hingestellt hat. Nach der Persönlichkeit des Angeklagten Schlage, wie sie in der Hauptverhandlung erkennbar geworden ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er aus einer bereitwilligen Befehlsergebenheit heraus stur und genau die gegebenen Befehle, ohne nach Recht oder Unrecht zu fragen, ausgeführt hat.
Das Schwurgericht konnte daher nur feststellen, dass der Angeklagte Schlage, wenn auch bereitwillig, die Tötungen der Häftlinge als fremde Taten fördern und unterstützen wollte. Er konnte daher nur als Gehilfe im Sinne des §49 StGB angesehen werden.
Dieses Ergebnis wird auch nicht durch weitere Zeugenaussagen, die den Angeklagten Schlage belastet haben, in Frage gestellt.
Der Zeuge Philipp Mü. will den Angeklagten Schlage im Mai oder Juni auf dem Hof zwischen Block 10 und 11 dabei beobachtet haben, wie er Häftlinge auf den Pfahl gehängt und gequält habe, bis sie tot gewesen seien. Es ist jedoch möglich, dass sich der Zeuge Philipp Mü. insoweit in der Person des damaligen Täters irrt. Der Zeuge kannte damals den Angeklagten Schlage nicht. Er will ihn in der Hauptverhandlung wiedererkannt haben. Wahrscheinlich unterliegt der Zeuge jedoch einer Täuschung. Denn nach der glaubhaften Aussage des Zeugen Wl., der zu dieser Zeit Blockschreiber in Block 11 gewesen ist, kam Schlage erst im Spätherbst als Arrestaufseher auf den Block 11. Er hätte es wissen müssen, wenn Schlage bereits im Mai oder Juni auf Block 11 gewesen wäre. Er hätte auch von diesem Pfahlhängen durch den Angeklagten Schlage erfahren müssen. Mü. verwechselt wahrscheinlich den Angeklagten Schlage mit einem anderen SS-Mann.
Die russischen Zeugen Was., Pog. und Sten. haben behauptet, dass Schlage russische Kriegsgefangene brutal getötet habe. Das Gericht konnte sich jedoch nicht davon überzeugen, dass diese Zeugen den Angeklagten Schlage damals einwandfrei erkannt haben. Von keinem anderen Zeugen ist bestätigt worden, dass Schlage irgend etwas mit russischen Kriegsgefangenen zu tun gehabt hätte. Möglicherweise haben die Zeugen Vorfälle, die sie tatsächlich erlebt haben, irrtümlich auf den Angeklagten Schlage projiziert. Auf Grund ihrer Aussagen konnten daher bezüglich des Angeklagten Schlage keine sicheren Feststellungen getroffen werden.
Der Zeuge Fab. hat behauptet, dass der Angeklagte Schlage im Frühjahr 1944 einen Mann, eine Frau und ein Kind im Waschraum des Blockes 11 erschossen hätte. Ferner hat der Zeuge Fab. geschildert, dass der Angeklagte Schlage im Jahre 1943 und 1944 an Einzelerschiessungen teilgenommen habe. Er habe auch selbst geschossen. Nach den Erschiessungen habe Schlage Häftlinge, die trotz der Genickschüsse noch gelebt hätten, durch Gnadenschüsse getötet. So habe er einmal einen Zigeuner nach der Exekution erst durch mehrere Schüsse ins Herz von vorne und hinten, dann durch mehrere Schüsse in die beiden Schläfen und schliesslich durch einen Schuss in den Hals getötet. Danach habe er gesagt: "Er hat ein Leben wie eine Katze."
Dass gegen die Zuverlässigkeit des Zeugen Fab. Bedenken bestehen, ist bereits oben unter E.III.3. ausgeführt worden. Das Gericht konnte auch in diesen Fällen nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass der Zeuge Fab. den Angeklagten Schlage damals einwandfrei gekannt hat. Es war nicht mit Sicherheit auszuschliessen, dass der Zeuge tatsächlich erlebte Vorfälle irrtümlich mit dem Angeklagten Schlage in Verbindung gebracht hat, während ein anderer SS-Mann der Täter war. Bedenken bestehen auch deshalb, weil nicht mit Sicherheit feststeht, wann Schlage ausser den festgestellten acht Wochen sonst noch als Arrestaufseher im Block 11 gewesen ist. Der Zeuge Pi. hat lediglich angeben können, dass der Angeklagte Schlage mehrfach mit Unterbrechungen im Block 11 gewesen sei und dass er im Mai 1944 die Funktionen eines Hauptblockführers gehabt habe. Zu dieser Zeit fanden aber - wie oben schon ausgeführt worden ist - keine Erschiessungen mehr auf dem Hof zwischen Block 11 und 10 statt. Es muss auch noch einmal hervorgehoben werden, dass der Zeuge Fab. bei der Gegenüberstellung mit den Angeklagten zunächst den Angeklagten Boger als den Angeklagten Schlage bezeichnet hat.
Im übrigen ist die Erschiessung der Familie nicht vom Eröffnungsbeschluss erfasst. Bei den vom Zeugen Fab. beobachteten Erschiessungen an der Schwarzen Wand, war nicht zu klären, ob es Erschiessungen nach Bunkerentleerungen oder ob es Exekutionen auf Grund von Stand- oder Sondergerichtsurteilen oder auf Grund von Exekutionsbefehlen des RSHA gewesen sind. Schlage wird im Eröffnungsbeschluss nur die Teilnahme an Erschiessungen nach Bunkerentleerungen zur Last gelegt. Eine Verurteilung wegen dieser Fälle hätte daher nicht erfolgen können, auch wenn sie auf Grund der Aussage des Zeugen Fab. als erwiesen anzusehen wären.
Sie könnten aber auch keinen sicheren Aufschluss für die hier erörterte Frage, ob Schlage bei den Erschiessungen nach Bunkerentleerungen mit Täter- oder Gehilfenwillen gehandelt hat, geben. Denn auch in diesen Fällen muss angenommen werden, dass die Erschiessungen auf Grund von Befehlen höherer Vorgesetzter erfolgt sind, so dass für ihn das Verbrecherische seines Verhaltens nicht ohne weiteres zu erkennen war.
Der Angeklagte Schlage hat die kausalen Tatbeiträge vorsätzlich geleistet. Denn nach den getroffenen Feststellungen hat er das Bewusstsein gehabt, dass er die Erschiessungen durch die geschilderten Tätigkeiten förderte. Er kannte auch die Tatumstände, die die Beweggründe für die Tötungen als niedrig kennzeichnen; denn er wusste, dass die Tötungen erfolgten, um Platz für weitere Arrestanten zu schaffen. Schliesslich hat er auch die gesamten Aktionen von Anfang bis zum Ende selbst miterlebt und somit Kenntnis von den gesamten Tatumständen gehabt, die die Tötungen als grausam kennzeichnen.
Er hat auch nicht irrig angenommen, dass er die Befehle seiner Vorgesetzten trotz ihres verbrecherischen Zweckes als bindend befolgen müsse; denn er war darüber belehrt worden und wusste, dass kein SS-Angehöriger im KL Auschwitz eigenmächtig Häftlinge misshandeln und töten durfte. Ihm war auch klar, dass Aumeier und Grabner und die anderen an den Bunkerentleerungen beteiligten SS-Angehörigen nicht befugt waren und es daher auch nicht bindend befehlen konnten, Häftlinge ohne Gerichtsurteile oder Befehle höherer Dienststellen zu erschiessen bzw. daran mitzuwirken. Dem Angeklagten Schlage ist seine Mitwirkung an den Bunkerentleerungen und Erschiessungen nicht abgenötigt worden. Er selbst behauptet nicht, dass sein Wille gebeugt worden sei. Als williger und sturer Befehlsempfänger hat er blindlings alles getan, was ihm aufgetragen worden ist, ohne nach Recht oder Unrecht zu fragen. Schuldausschliessungsgründe im Sinne der §§52 und 54 StGB sind daher nicht gegeben. Auch sonstige Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich.
Der Angeklagte Schlage war daher wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in mindestens 80 Fällen (§§47, 49, 211, 74 StGB) zu bestrafen.
V. Strafzumessung
Dem Angeklagten konnte zugute gehalten werden, dass auch er durch ausserhalb seiner Person liegende Umstände in Situationen gestellt wurde, aus denen sich seine Straftaten entwickelten und dass auf ihn als Mann von 62 Jahren eine länger dauernde Freiheitsstrafe ungleich schwerer wirkt als auf einen jüngeren Täter. Der Angeklagte Schlage hat, auch das wirkte sich strafmildernd aus, vor und nach dem Kriege unauffällig gelebt und vorbildlich für seine Familie gesorgt. Andererseits aber hat der Angeklagte als williger Befehlsempfänger erhebliche Beiträge zum reibungslosen Ablauf der sog. Bunkerentleerungen geleistet und sich als blindlings gehorchender, abgestumpfter SS-Wächter bei der Behandlung der Häftlinge brutal, grausam und unbarmherzig gezeigt. Er hat sich, obgleich er nie Mitglied der allgemeinen SS gewesen war, in einem erschreckenden Umfange die schäbigsten Methoden zum Schikanieren wehrloser Häftlinge zu eigen gemacht. In jedem Falle der Beihilfe erschien daher eine Zuchthausstrafe von 4 Jahren als angemessene Sühne. Aus den 80 Einzelstrafen ist gem. §74 StGB unter Abwägung der für und gegen den Angeklagten sprechenden Umstände eine Gesamtstrafe von 6 Jahren Zuchthaus gebildet worden.
H. Die Straftaten des Angeklagten Hofmann
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Hofmann
Der Angeklagte Hofmann ist als Sohn eines Metzgers am 5.4.1906 in Hof an der Saale geboren. Er wuchs mit noch weiteren fünf Geschwistern im Elternhaus auf. Im Jahre 1915 verstarb seine Mutter. Sein Vater heiratete 1919 zum zweiten und im Jahre 1925 zum dritten Male.
Der Angeklagte Hofmann besuchte von 1912 bis 1920 die Volksschule. Nach der Schulentlassung erlernte er von April 1920 bis 1923 das Tapezierhandwerk. Die Lehre schloss er mit bestandener Gesellenprüfung ab. Einige Monate später wurde er arbeitslos. Er ging deswegen zu einem Bruder seines Vaters nach Emden, der dort ein Kolonialwarengeschäft betrieb. In diesem Geschäft arbeitete der Angeklagte bis zum Sommer 1925. Danach verzog er mit seinem Onkel nach Zwischenahn/Oldenburg. Dort eröffneten beide eine Pension und ein kleines Versandgeschäft mit Tee und Kaffee.
Als dieses Geschäft zurückging, arbeitete der Angeklagte als Kellner und Hoteldiener in verschiedenen Hotels. Im Jahre 1931 wurde er arbeitslos. Er ging deshalb wieder nach Hof/Saale zurück.
Im Juli oder August 1932 trat er in die NSDAP und die allgemeine SS ein. Von April bis Juni 1933 nahm er an einem Hilfspolizeikursus bei der Landpolizei in Hof teil und wurde am 1.7.1933 bei der Schutzpolizei in Hof als Hilfspolizist eingestellt. Ende September 1933 wurde er von dort zur Wachtruppe des KZ Dachau für 7 Wochen, nämlich bis zum 31.12.1933, abkommandiert und anschliessend von dem Wachsturmbann des KZ Dachau als Wachtposten-SS-Sturmmann übernommen. In dieser Eigenschaft war er bis September 1934 tätig. Danach wurde er als Telefonist in der Telefonzentrale der Kommandantur bis September 1937 eingesetzt. Während dieser Zeit wurde er zum Unterscharführer befördert (1936). Ab 1.September 1937 wurde er im Schutzhaftlager des KZ Dachau verwendet. Im Jahre 1937 wurde er dann zum SS-Oberscharführer und am 30.1.1939 zum SS-Hauptscharführer befördert. Weitere Beförderungen erfolgten am 30.1.1941 (SS-Untersturmführer) und am 20.4.1942 (SS-Obersturmführer).
Der Angeklagte Hofmann blieb bis zum 1.12.1942 im KZ Dachau. Zuletzt war er stellvertretender Schutzhaftlagerführer. Dann wurde er zum KZ Auschwitz versetzt. Hier wurde er zunächst als dritter Schutzhaftlagerführer des Stammlagers A I eingesetzt. Erster Schutzhaftlagerführer war damals der SS-Hauptsturmführer Aumeier, 2. Schutzhaftlagerführer war SS-Hauptsturmführer Schwarz. Im März oder April 1943 wurde der Angeklagte als Schutzhaftlagerführer in das Zigeunerlager in Birkenau versetzt. Diese Funktion übte er nur bis September 1943 aus. Dann wurde er wieder 3. Schutzhaftlagerführer im Stammlager. Nach der Trennung des Lagers in drei selbständige Lager (Stammlager, Lager Birkenau und Lager Monowitz) wurde der Angeklagte am 22.11.1943 erster Schutzhaftlagerführer im Stammlager. Zu gleicher Zeit wurde der bisherige Kommandant von Auschwitz - Höss - vom SS-Sturmbannführer Liebehenschel abgelöst. SS-Hauptsturmführer Schwarz wurde Kommandant von Monowitz, während im Lager Auschwitz-Birkenau der Sturmbannführer Hartjenstein als Kommandant eingesetzt wurde, der am 9.5.1944 von SS-Hauptsturmführer Kramer abgelöst wurde. Der Angeklagte Hofmann wurde schliesslich, nachdem er am 20.4.1944 zum SS-Hauptsturmführer befördert worden war, mit Wirkung vom 15.5.1944 zum KZ Natzweiler versetzt. Dort war er bis Februar 1945 in verschiedenen Nebenlagern als Lagerführer tätig.
Den Zusammenbruch erlebte der Angeklagte in Guttenbach/Neckar, wohin die Kommandantur des KZ Natzweiler verlegt worden war. Er besorgte sich Zivilkleider und setzte sich ab. Nach Kriegsende arbeitete er bis 1954 in verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben als Landwirt und Hilfsarbeiter. Auch als Heizer verdiente er sich in verschiedenen Orten Bayerns und Württembergs seinen Lebensunterhalt.
Der Angeklagte ist im Jahre 1948 oder 1949 von der Spruchkammer in Rothenberg o.T. entnazifiziert und dabei zu einer Geldbusse von 20.- DM verurteilt worden. In dem Spruchkammerverfahren hatte er angegeben, dass er erst 1937 Mitglied der NSDAP geworden sei. Seine Zugehörigkeit zur SS und seine Tätigkeit in den Konzentrationslagern hatte er verschwiegen.
Der Angeklagte hat im Dezember 1939 geheiratet. Aus seiner Ehe sind zwei Jungen, die bereits volljährig sind, und eine - jetzt volljährige - Tochter hervorgegangen. Der Angeklagte ist nach dem Kriege nicht mehr zu seiner Familie zurückgekehrt. Im Jahre 1954 hat er eine andere Frau kennengelernt, von der er zwei uneheliche Kinder hat und die er heiraten möchte. Schon im Jahre 1946 war ihm von einer anderen Frau ein uneheliches Kind geboren worden, dessen Amtsvormund das Jugendheim Kehlheim ist.
Wegen seiner Tätigkeit im KZ Dachau ist der Angeklagte Hofmann durch Urteil des Schwurgerichts in München II vom 19.12.1961 - 2 Ks 8/61 - wegen Mordes in 2 Fällen zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt worden. Das Urteil ist seit dem 28.5.1962 rechtskräftig. Hofmann verbüsst z.Zt. diese Strafe. Der Angeklagte Hofmann hat jedoch die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Gegen den Angeklagten ist ferner ein Strafverfahren wegen seiner Tätigkeit im KZ Natzweiler vor dem Schwurgericht in Hechingen anhängig. In dieser Sache befand sich der Angeklagte vom 16.4.1959 bis zum Beginn der Verbüssung der durch das Schwurgericht in München verhängten Strafe in Untersuchungshaft.
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Mitwirkung des Angeklagten Hofmann an der Massentötung jüdischer Menschen in Auschwitz (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
Der Angeklagte Hofmann hat als dritter Schutzhaftlagerführer des Stammlagers und als erster Schutzhaftlagerführer des Lagers Birkenau bei der massenweisen Tötung der sog. RSHA-Juden (vgl. oben 2. Abschnitt VII.5.; 3. Abschnitt A.II.) mitgewirkt.
Er wurde wiederholt als "diensthabender Führer" zum Rampendienst eingeteilt. Er begab sich wiederholt in dieser Funktion zur Abwicklung der RSHA-Transporte zur Rampe. Dort leitete er und überwachte die Einteilung der aus den Eisenbahnwaggons ausgestiegenen jüdischen Menschen und den Abtransport der für die Vergasung bestimmten Menschen zu den Vergasungsräumen. Er selbst ging mehrfach auch zu den Gaskammern mit. Dort überwachte er als diensthabender Führer die Vernichtungsaktionen. Beim Hineinführen der Menschen in die Gaskammern half er mit, wenn Stockungen eintraten, indem er mit anderen SS-Männern die Menschen in den Vergasungsraum "hineinschob". Ferner beobachtete er auch das Einschütten des Zyklon B. Nach Abschluss der Aktionen teilte er an die daran beteiligten SS-Männer die Gutscheine für Zusatzverpflegung und Genussmittel aus.
Es konnte nicht festgestellt werden, wie oft der Angeklagte Hofmann Rampendienst versehen hat. Mit Sicherheit war er jedoch bei der Abwicklung von mindestens drei verschiedenen RSHA-Transporten in der geschilderten Art und Weise tätig. In jedem dieser drei Fälle sind jeweils mindestens 750 jüdische Menschen durch Gas getötet worden.
Der Angeklagte Hofmann wusste, dass die Vernichtungsaktionen unter Beobachtung strengster Geheimhaltungsvorschriften und unter Verwendung von Tarnbezeichnungen erfolgten, und dass die jüdischen Menschen in der oben unter A.II. geschilderten Weise über ihr bevorstehendes Schicksal bis zuletzt getäuscht wurden. Ihm war auch - wie allen anderen SS-Angehörigen - bekannt, dass die jüdischen Menschen nur wegen ihrer Abstammung getötet wurden. Den Todeskampf der in der Gaskammer eingeschlossenen Opfer nach dem Einschütten des Zyklon B nahm er selbst unmittelbar wahr, wenn er sich zu der Gaskammer begeben und dort die Aufsicht geführt hat.
2. Die Mitwirkung des Angeklagten Hofmann bei den sog. Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen von Häftlingen an der Schwarzen Wand auf dem Hof zwischen Block 10 und 11 (Eröffnungsbeschluss 2)
Der Angeklagte Hofmann hat als dritter Schutzhaftlagerführer des Stammlagers auch mehrfach an den sog. Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen der für den Tod ausgesuchten Häftlinge (vgl. oben C.II.3.) teilgenommen. In mindestens drei Fällen ging er zusammen mit anderen SS-Angehörigen, dem ersten oder zweiten Schutzhaftlagerführer, dem Untersturmführer Grabner und anderen, in den Arrestbunker. In einem Fall führte er die Liste der im Bunker inhaftierten Häftlinge. Wenn nach der Meldung der einzelnen in den Zellen einsitzenden Häftlinge kurz über die zu treffende Entscheidung gesprochen wurde, beriet er mit und stimmte zu, wenn Häftlinge zum Erschiessen ausgewählt wurden. In dem einen Fall, in welchem er die Liste der Häftlinge führte, machte er jeweils ein Kreuz hinter den Namen bzw. die Nummer der Häftlinge, deren Tod beschlossen wurde. In allen drei Fällen ging er nach Beendigung der Bunkerentleerungen und, nachdem die erforderlichen Vorbereitungen für die Erschiessungen getroffen worden waren, mit den anderen SS-Angehörigen auf den Hof und beobachtete die anschliessenden Erschiessungen der Häftlinge. Dass er auch eigenhändig Häftlinge nach solchen Bunkerentleerungen an der Schwarzen Wand getötet hätte, konnte nicht festgestellt werden.
Bei diesen Bunkerentleerungen wurden mindestens je 10 Häftlinge, also insgesamt 30 Häftlinge, für den Tod ausgesucht und anschliessend an der Schwarzen Wand in Anwesenheit des Angeklagten Hofmann durch Genickschüsse getötet. Der genaue Zeitpunkt dieser Taten konnte nicht mehr festgestellt werden. Mit Sicherheit hat sich der Angeklagte Hofmann an Bunkerentleerungen und den geschilderten Erschiessungen erst nach seiner Versetzung zum KL Auschwitz, also nach dem 1.12.1942, beteiligt.
Der Angeklagte Hofmann wusste, dass die Erschiessungen ohne Gerichtsurteile und ohne Exekutionsbefehle höherer SS-Dienststellen erfolgten, damit Platz für weitere Arrestanten im Bunker geschaffen werde. Die gesamten Umstände, unter denen die Erschiessungsaktionen durchgeführt wurden, nahm er unmittelbar selbst wahr.
3. Die Tötung eines Häftlings durch einen Flaschenwurf (Eröffnungsbeschluss 6)
Der Angeklagte Hofmann war - wie schon ausgeführt - von März oder April 1943 bis September 1943 als erster Schutzhaftlagerführer im Lager Birkenau eingesetzt. Insbesondere unterstand ihm das Zigeunerlager (B II e). Sein Rapportführer war der Oberscharführer Palitzsch. Während dieser Zeit, der genaue Zeitpunkt konnte nicht mehr festgestellt werden, wurden drei Häftlinge, die in der Kantine des Zigeunerlagers beschäftigt waren, von dem Angeklagten Broad aus nicht mehr näher festzustellenden Gründen verhaftet. Wahrscheinlich hatten sie Lebensmittel oder sonstige Dingeverschoben. Zur Strafe wurden sie in die Strafkompanie eingewiesen. Der Angeklagte Hofmann ärgerte sich darüber sehr.
Offenbar fürchtete er Rügen vorgesetzter Stellen, wenn es bekannt würde. Kurz nach diesem Vorfall entdeckte Hofmann bei der Kantine des Zigeunerlagers eine herumliegende Flasche. Auch hierüber ärgerte er sich, da er stets Wert auf peinliche Ordnung und Sauberkeit im Lagerabschnitt legte. Er schimpfte deswegen auf die Häftlinge. Er hob die Flasche auf, während gerade ein Häftling, ein Zigeuner, an ihm vorbeiging. Hofmann nahm dem Häftling mit der freien Hand die Mütze vom Kopf und warf sie auf die Erde. Der Zigeuner bückte sich nach der Mütze, um sie wieder aufzuheben. Da warf Hofmann dem Häftling, während sich dieser gerade bückte, mit voller Wucht die Flasche aus kurzer Entfernung an den Kopf. Dabei rief er: "Ihr Handwerksburschen!" Der Häftling brach bewusstlos zusammen. Er wurde von anderen Häftlingen in den HKB gebracht. Kurz danach starb er. Sein Tod trat infolge der durch den Flaschenwurf erlittenen Verletzungen ein.
Der Angeklagte Hofmann wollte mit dem Flaschenwurf den Häftling aus Verärgerung über die herumliegende Flasche töten.
4. Weitere Taten des Angeklagten Hofmann, die nicht angeklagt und nicht im Eröffnungsbeschluss enthalten sind
Hofmann griff als erster Schutzhaftlagerführer mit eiserner Härte durch. Wie bereits gesagt, legte er Wert auf Ordnung und Sauberkeit im Lager. Besonderen Wert legte er darauf, dass die Baracken, in denen die Häftlinge untergebracht waren, stets sauber seien. Die Blockältesten erklärten ihm einmal, dass die Baracken nicht zu jeder Zeit sauber gehalten werden könnten, weil die Häftlinge von der Arbeit verdreckt, verschmutzt, übermüdet und hungrig zurückkämen und dann zunächst erst einmal Feuer in den Baracken machen wollten, um sich aufzuwärmen und sich etwas zu kochen. Hofmann erwiderte auf diese Vorstellungen hin jedoch nur, dann müssten eben die Häftlinge die ganze Nacht im Freien bleiben, wenn sie die Baracken nach dem Einrücken nicht sauber halten könnten. Im übrigen befahl er den Kapos und Blockältesten ständig, die Häftlinge anzutreiben und dazu anzuhalten, für die SS zu arbeiten. Einmal rief er die Blockältesten zusammen und rügte sie, dass sie die Häftlinge nicht genügend antrieben. Zur Strafe verabreichte er persönlich jedem Blockältesten 10 Schläge mit einem Stock auf das Gesäss. Täglich mussten die Blockältesten antreten und ihm besondere Vorkommnisse in ihrem Block melden. Dabei berichteten sie ihm auch über die Anzahl der an einem Tag in ihrem Block gestorbenen Häftlinge.
Als der Lagerabschnitt B I b noch mit Männern belegt war, diente der Block 7 als "Krankenblock". Die Häftlinge wurden in diesem Block aber überhaupt nicht ärztlich versorgt. Man sperrte die "Muselmänner" und die arbeitsunfähigen Häftlinge in den Block 7 ein, damit sie hier sterben sollten. (Das galt jedoch nicht für deutsche Häftlinge, die einen besonderen Krankenblock hatten.) Verpflegung bekamen die im Block 7 eingesperrten Häftlinge überhaupt nicht mehr. Das war auch so, als der Angeklagte Hofmann Schutzhaftlagerführer in Birkenau war. Jeden Tag starben etwa 300 bis 400 Menschen im Block 7. Der Blockälteste des Blockes 7 meldete dem Angeklagten Hofmann täglich die Zahl der Toten. Einmal starben an einem Tag 1184 Menschen. Hofmann rührte das jedoch nicht. Im Lager Birkenau wusste man genau, dass der Block 7 ein Todesblock war. Kranke Häftlinge meldeten sich daher nicht mehr krank. Sie versteckten sich in ihren Blocks, um dem Tod im Block 7 zu entgehen. Um das Lager von diesen Kranken und arbeitsunfähigen Häftlingen zu "säubern", ordnete Hofmann wiederholt Lagerausräumungen an. Er liess durch SS-Männer die Baracken durchkämmen und versteckte Häftlinge heraustreiben. Dann liess er die Arbeitstauglichkeit dieser Häftlinge - meist durch einen Funktionshäftling - überprüfen. Wer arbeitsunfähig erschien - hierzu gehörten vor allem die sog. Muselmänner - wurde zur Vergasung ausgesondert. Die Ausgesonderten kamen zunächst unter strenger Bewachung auf den Block 7, wo sie isoliert und ohne Verpflegung eingesperrt wurden. Dann wurden sie mit LKWs zu den Gaskammern transportiert, wo sie durch Zyklon B getötet wurden. Hofmann führte stets bei diesen Lagerausräumungen die Aufsicht. Häufig fuhr er auch hinter den LKWs, die die Opfer zu den Gaskammern brachten her und beaufsichtigte das Hineinführen der Häftlinge in die Gaskammern und das Einwerfen des Zyklon B. Wiederholt äusserte Hofmann zu anderen SS-Männern, wenn ihm auffiel, dass zuviel "Muselmänner" im Lager in Erscheinung traten: "Wir müssen wieder einmal das Lager ausräumen!" Dann ordnete er eine Lagerselektion an, bei der die Schwachen und Arbeitsunfähigen für den Gastod ausgesondert und anschliessend in den Gaskammern getötet wurden.
Wieviel Häftlinge auf Anordnung des Angeklagten Hofmann und unter seiner Verantwortlichkeit getötet worden sind, konnte nicht mehr festgestellt werden. Auf jeden Fall waren es mehrere Tausend.
III. Einlassung des Angeklagten Hofmann, Beweismittel, Beweiswürdigung
1.
Die Feststellungen über den Lebenslauf des Angeklagten Hofmann beruhen auf seiner Einlassung und dem Kommandanturbefehl Nr.4/44 vom 18.5.1944 des KL Natzweiler, der in der Hauptverhandlung verlesen worden ist.
2. Zu II.1.
Die Feststellungen unter Ziff.II.1. beruhen auf dem Geständnis des Angeklagten Hofmann. Der Angeklagte hat nach anfänglichem Leugnen zugegeben, dass er als diensthabender Führer Rampendienst in der geschilderten Weise versehen habe und auch mit zur Gaskammer gefahren sei, wo er Überwachungsfunktionen ausgeübt und auch geholfen habe, Häftlinge in den Vergasungsraum "hineinzuschieben". Er selbst wusste allerdings nicht mehr, wie oft er an solchen Vernichtungsaktionen teilgenommen hat. Er hat jedoch eingeräumt, dass er mindestens an drei solcher Aktionen beteiligt gewesen sei. Die Zeugen, die den Angeklagten Hofmann bei solchen Aktionen gesehen haben, konnten ebenfalls keine Zahlenangaben mehr machen. Das Gericht konnte daher nur von der vom Angeklagten Hofmann selbst angegebenen Mindestzahl ausgehen, wenn auch anzunehmen ist, dass er viel häufiger zum Rampendienst eingeteilt gewesen ist. Denn die tatsächlichen Feststellungen konnten nicht auf unsichere Schätzungen gestützt werden.
Da während der Tätigkeit des Angeklagten Hofmann nicht nur grosse Transporte angekommen sind, sondern auch kleinere, deren Stärke zwischen 1000 und 3000 Personen schwankte, ist das Gericht davon ausgegangen, dass in den drei Fällen die Transporte nur 1000 Menschen umfasst haben. Hiervon mussten die "Arbeitsfähigen" abgezogen werden, die in das Lager aufgenommen worden sind. Es können höchstens 25% = 250 Menschen gewesen sein. So ergibt sich die Feststellung, dass von jedem Transport mindestens 750 Menschen getötet worden sind.
Die Feststellungen zur inneren Tatseite ergeben sich aus der Tatsache, dass der Angeklagte Hofmann wie alle anderen SS-Angehörigen über die Geheimhaltungsvorschriften belehrt worden ist und im übrigen die ganzen Vernichtungsaktionen von Anfang bis zum Ende miterlebt und alles mit angesehen hat. Er war auch - wie alle anderen SS-Angehörigen - darüber informiert, dass die jüdischen Menschen nur wegen ihrer Abstammung getötet wurden.
3. Zu II.2.
Der Angeklagte Hofmann räumt ein, zwei- bis dreimal bei Bunkerentleerungen und den anschliessenden Erschiessungen an der Schwarzen Wand anwesend gewesen zu sein. Der erste Schutzhaftlagerführer habe ihn - so hat er sich eingelassen - aufgefordert, daran teilzunehmen, damit er das auch einmal sehe. Bei den Bunkerentleerungen habe er nichts zu tun gehabt. Aumeier und Grabner hätten bestimmt, wer erschossen werden sollte. Während der Erschiessung sei er nur auf dem Hof herumgelaufen. Geschossen habe er nicht.
Diese Einlassung des Angeklagten Hofmann ist schon an sich unglaubhaft. Es erscheint unwahrscheinlich, dass er, der den Rang eines SS-Obersturmführers hatte, nur als Zuschauer die Bunkerentleerungen und Erschiessungen mit angesehen haben soll.
Seine Einlassung ist aber auch durch die Beweisaufnahme widerlegt worden. Nach der glaubhaften Aussage des Zeugen G. hat der Angeklagte Hofmann in einem Fall die Liste, auf der die Namen und Nummern der Arrestanten verzeichnet waren, geführt und jeweils ein Kreuz hinter die Namen bzw. Nummern der Häftlinge gemacht, die zum Tode bestimmt worden sind. Auch der Zeuge La. hat bekundet, dass der Angeklagte Hofmann zu der "Kommission" gehört habe, die über das Schicksal der Häftlinge beraten und entschieden habe. Der Angeklagte Broad hat in seinem mehrfach erwähnten Bericht bei der Schilderung des damaligen Strafverfahrens gegen den Untersturmführer Grabner die SS-Führer aufgezählt, die "massgeblich" an den Bunkeraktionen beteiligt gewesen seien. Dabei hat er neben Aumeier und Schwarz auch den Obersturmführer Hofmann aufgeführt. Aus diesem Bericht hat das Gericht in Verbindung mit den glaubhaften Aussagen der Zeugen G. und La. die Überzeugung gewonnen, dass Hofmann nicht nur Zuschauer bei den Bunkerentleerungen gewesen ist, sondern zusammen mit den anderen SS-Führern über die einzelnen Häftlinge beraten und jeweils zugestimmt hat, wenn man übereinkam, die Häftlinge zu erschiessen.
Der Angeklagte Hofmann ist mindestens dreimal an solchen Bunkerentleerungen beteiligt gewesen, auch wenn er selbst nur einräumt, dass es zwei- bis dreimal gewesen sei. Dass es mehr als zweimal gewesen sein muss, dafür spricht schon der Broad-Bericht, wonach er massgeblich an den Bunkerentleerungen beteiligt gewesen ist. Es steht aber auch auf Grund der Aussagen der Zeugen G. und F. fest. Denn der Zeuge G. hat nach seiner glaubhaften Aussage den Angeklagten Hofmann in der Zeit zwischen dem 12.9. und 21.9.1943 bei einer Bunkerentleerung erlebt. Der Zeuge F., der vom 24.9.1943 bis zum 11.10.1943 im Arrestbunker eingesessen hat, hat den Angeklagten Hofmann - wie er glaubhaft bekundet hat - bei zwei weiteren Bunkerentleerungen gesehen. Daraus ergibt sich bereits, dass Hofmann mindestens dreimal an solchen Aktionen beteiligt gewesen ist.
Dass der Angeklagte Hofmann gewusst hat, dass die Erschiessungen erst im Arrestbunker von den dort versammelten SS-Angehörigen beschlossen wurden und ihnen weder Todesurteile noch Befehle höherer Dienststellen zugrunde gelegen haben, kann nach der gesamten Sachlage nicht zweifelhaft sein. Er behauptet auch selbst nicht, dass er angenommen habe, die Erschiessungen erfolgten auf Grund von Urteilen oder sonstigen Befehlen. Vielmehr hat er eingeräumt, dass er bereits damals die Erschiessungen als unrechtmässig angesehen habe. Da er selbst zusammen mit den anderen SS-Führern an diesen Aktionen beteiligt war, kann auch kein Zweifel bestehen, dass er das Motiv für die Erschiessungen der Häftlinge, nämlich Platz für weitere Arrestanten zu schaffen, gekannt habe.
4. Zu II.3.
Der Angeklagte Hofmann bestreitet, einen Häftling durch einen Flaschenwurf getötet zu haben. Er gibt allerdings zu, dass er einmal bei der Überprüfung der Sauberkeit des Lagers eine herumliegende Flasche gefunden habe. Er habe - so hat er sich eingelassen - die Flasche aufgehoben und sie einer Gruppe von Häftlingen, bei denen ein SS-Mann gestanden habe, zugeworfen. Dabei habe er gerufen, sie sollten die Flasche wegschaffen. Die Häftlinge und der SS-Mann hätten jedoch seinen Zuruf überhört. Die Flasche sei deshalb dem SS-Mann an den Kopf geflogen. Dieser habe deswegen in das Lazarett eingeliefert werden müssen. Er sei jedoch wieder gesund geworden. Ein Häftling sei von der Flasche nicht getötet worden.
Der Angeklagte Hofmann wird jedoch durch die glaubhafte Aussage des Zeugen van V. überführt, einem Häftling in der geschilderten Weise eine Flasche an den Kopf geworfen zu haben.
Der Zeuge van V. ist glaubwürdig. Er hat - wie oben bereits erwähnt - auf das Gericht einen ausgezeichneten Eindruck gemacht. Das Gericht hält es für ausgeschlossen, dass der Zeuge den Vorfall erfunden hat. Er hat bereits im Jahre 1945 in einem schriftlichen Bericht geschildert, dass der Angeklagte Hofmann im Jahre 1943 einen Zigeuner tödlich verwundet habe, indem er ihm eine Flasche an den Kopf geworfen und dadurch einen Schädelbruch verursacht habe. Da er nach seiner glaubhaften Bekundung den Vorfall selbst als Augenzeuge miterlebt hat, hat das Gericht auch keinen Zweifel, dass sich der Vorfall so - wie es der Zeuge geschildert hat - abgespielt hat. Es besteht kein Anlass für die Annahme, dass der Zeuge den Angeklagten Hofmann mit einem anderen SS-Mann verwechselt haben könnte. Denn der Zeuge kannte als Blockältester den Angeklagten Hofmann, da er ihm täglich Bericht erstatten musste, genau.
Das Gericht ist auch überzeugt, dass der Angeklagte Hofmann den Häftling mit dem Flaschenwurf töten wollte. Hierfür spricht eindeutig, dass er zunächst - wie der Zeuge van V. glaubhaft geschildert hat - dem Häftling die Mütze abnahm und sie zu Boden warf. Dies geschah in der sicheren Erwartung, dass sich der Häftling nach der Mütze bücken und sie wieder aufheben werde. Denn es war strenge Vorschrift im KL Auschwitz, dass kein Häftling ohne Mütze herumlaufen durfte. Der Angeklagte Hofmann wollte nach der gesamten Sachlage den Häftling ablenken und verhindern, dass der Häftling dem beabsichtigten Wurf ausweichen könne. Für sich selbst schaffte Hofmann durch dieses Manöver eine Situation, in der er den Häftling mit Sicherheit treffen konnte. Für seine Tötungsabsicht spricht ferner, dass er die Flasche aus kurzer Entfernung mit voller Wucht gegen den Kopf des Häftlings geschleudert hat. Dass der Häftling bewusstlos zusammengebrochen und anschliessend in den HKB eingeliefert worden ist, hat der Zeuge van V. ebenfalls glaubhaft geschildert. In der Hauptverhandlung konnte er sich allerdings nicht mehr daran erinnern, was mit dem Häftling nach der Einlieferung in den HKB geschehen ist.
Darüber hat jedoch der Zeuge Bra. Auskunft gegeben. Dieser Zeuge hat ebenfalls geschildert, dass der Angeklagte Hofmann einen Häftling aus kurzer Entfernung eine Flasche an den Kopf geworfen habe. Das habe er selbst beobachtet. Der Häftling sei daraufhin in das Revier getragen worden. Kurz danach sei er gestorben. Er selbst habe die Leiche gesehen. Wenn der Zeuge angegeben hat, der Flaschenwurf sei vor der Küche des Zigeunerlagers erfolgt, während der Zeuge van V. als Tatort den Platz vor der Kantine genannt hat, so ist das nach Auffassung des Gerichts nur eine unwesentliche Differenz, da man Küche und Kantine leicht verwechseln kann und sich möglicherweise der Zeuge Bra. in einem für ihn nebensächlichen Punkt geirrt bzw. die Kantine irrtümlich als Küche bezeichnet hat. Beide Zeugen meinen aber ersichtlich den gleichen Vorfall, da ihre Angaben über die Tat selbst übereinstimmen. Die Verteidigung hat gegen die Glaubwürdigkeit des Zeugen Bra. Bedenken erhoben. Das Schwurgericht teilt diese Bedenken jedoch nicht. Zwar konnte der Zeuge nicht mehr in der Hauptverhandlung vernommen werden, da er inzwischen verstorben ist. In der Hauptverhandlung wurde nur das Protokoll über seine frühere richterliche Vernehmung vom 28.12.1962 verlesen. Gleichwohl hat das Gericht keine Zweifel, dass die Angaben des Zeugen bei dieser Vernehmung, wie sie durch das verlesene Protokoll ausgewiesen werden, bezüglich des Flaschenwurfes richtig sind, da seine Darstellung mit der des Zeugen van V. übereinstimmt. Das Gericht glaubt daher auch dem Zeugen, dass der Häftling kurz nach dem Flaschenwurf gestorben ist und dass er selbst die Leiche des Häftlings gesehen hat. Da der verletzte Häftling vor dem Flaschenwurf gesund war und unmittelbar danach gestorben ist, ist das Gericht auch überzeugt, dass der Tod dieses Häftlings infolge der Verletzung, die er durch den Aufprall der mit Wucht geworfenen Flasche erlitten hat, gestorben ist.
Die Verteidigung hat die Glaubwürdigkeit des Zeugen vor allem auch deswegen in Zweifel gezogen, weil der Zeuge bei seiner Vernehmung behauptet hat, er habe infolge von Schlägen, die er vom Angeklagten Hofmann auf den Kopf erhalten habe, einen Hornhautriss am linken Auge davongetragen. Diese Angaben seien, so hat die Verteidigung vorgetragen, unwahr. Denn der Zeuge könne keinen Hornhautriss gehabt haben, weil ein Hornhautriss stets zur Erblindung auf dem betreffenden Auge führe. Der Zeuge habe aber nichts davon erwähnt, dass er an dem betreffenden Auge erblindet sei. Die Verteidigung hat für den Fall, dass das Gericht dem Zeugen trotzdem Glauben schenken sollte, hilfsweise beantragt, einen Sachverständigen darüber zu hören, dass ein Riss in der Hornhaut stets zur Erblindung führt. Dieser Hilfsbeweisantrag war gemäss §244 StPO abzulehnen, da es als wahr unterstellt werden kann, dass ein Hornhautriss zur Erblindung führt. Trotz dieser Wahrunterstellung wird die Glaubwürdigkeit des Zeugen jedoch nicht erschüttert. Denn es ist durchaus möglich, dass der Zeuge auf Grund einer falschen Diagnose im Lager irrig angenommen hat, er habe infolge der Schläge Hofmanns einen Hornhautriss erlitten, während er in Wirklichkeit vielleicht nur eine sonstige Augenverletzung gehabt hat. Seine Behauptung über den Hornhautriss bei seiner richterlichen Vernehmung kann er, auch wenn sie nicht den Tatsachen entsprechen sollte, guten Glaubens aufgestellt haben, ohne dass deswegen seine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt wäre.
Im übrigen steht keineswegs fest, dass der Zeuge nicht am linken Auge erblindet gewesen ist. Dies lässt sich, da der Zeuge inzwischen verstorben ist, nachträglich auch nicht mehr feststellen. Aus der Tatsache allein, dass der Zeuge nicht von einer Erblindung auf einem Auge gesprochen hat, kann noch nicht der sichere Schluss gezogen werden, dass der Zeuge noch mit beiden Augen hat sehen können. Es ist denkbar, dass der Zeuge tatsächlich einen Hornhautriss erlitten hat und anschliessend auf dem linken Auge auch erblindet ist.
Auch der weitere bezüglich der Zuverlässigkeit des Zeugen Bra. gestellte Hilfsbeweisantrag, Seite 94 des Auschwitzheftes Nr.2 zu verlesen, war abzulehnen.
Dort soll sich eine Eintragung des Inhalts befinden, dass am 29.8.1940 100 Häftlinge aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen nach dem Konzentrationslager Auschwitz verlegt wurden und die Häftlingsnummern 3188-3287 erhielten. Es kann nämlich zu Gunsten des Angeklagten Hofmann davon ausgegangen werden, dass diese Eintragung zutreffend ist und demzufolge der Zeuge Bra., der die Häftlings-Nr. 3287 trug, bereits am 29.8.1940 nach Auschwitz verlegt wurde, nicht aber erst im Frühjahr 1941, wie er in seiner Vernehmung durch den Untersuchungsrichter gesagt hat. Gleichwohl lässt sich hieraus nichts gegen die Zuverlässigkeit des Gedächtnisses des Zeugen herleiten. Denn es ist leicht erklärlich, dass ehemalige Häftlinge nicht mehr auf den Monat genau wissen, wann sie von dem einen in das andere Konzentrationslager verlegt wurden, weil wesentliche Veränderungen für sie mit einer solchen Verlegung grundsätzlich nicht verbunden waren. Aus einer solchen Unsicherheit in der Erinnerung kann aber auch nicht der Schluss gezogen werden, der Zeuge Bra. hätte auch kein zuverlässiges Wissen mehr über ganz bestimmte, gravierende Vorkommnisse im Konzentrationslager Auschwitz, wie er sie geschildert hat.
Die Verteidigung hat ferner geltend gemacht, dass es unglaubhaft sei, dass der Zeuge Bra. - wie er bei seiner richterlichen Vernehmung angegeben hat - als Arrestant im Block 11 aus dem Arrestbunker heraus Erschiessungen an der Schwarzen Wand hätte beobachten können und dass er als Todesschützen den Rapportführer Palitzsch gesehen habe. Denn nach Auffassung der Verteidigung hätte eine solche Beobachtungsmöglichkeit nicht bestanden.
Zwar wurden in der Regel bei Erschiessungen an der Schwarzen Wand Decken vor die Zellenfenster gehängt. Das haben viele Zeugen bekundet. Es erscheint jedoch möglich, dass das Fenster der Zelle, in der der Zeuge Bra. eingesessen hat, aus irgendwelchen Gründen nicht immer verhängt worden ist. Vielleicht ist es vergessen worden oder man hat sich nicht immer die Zeit genommen, die Zellenfenster zu verhängen. Es erscheint daher durchaus möglich, dass der Zeuge bei gewissen Erschiessungen einen Teil des Hofes überblicken konnte. Die Fenster der Arrestzellen lagen zu ebener Erde und gaben den Insassen der Zellen, wenn diese sich einen günstigen Standpunkt wählten, die Möglichkeit, einen Teil des Hofes zu überblicken. Dass solche Beobachtungsmöglichkeiten bestanden haben, ergibt sich allein schon aus der Tatsache, dass die Fenster in der Regel mit Decken verhängt worden sind. Hätte keine Sicht- oder Beobachtungsmöglichkeit durch die Zellenfenster bestanden, so hätte es dieser Massnahme nicht bedurft.
5. Zu II.4.
Die Feststellungen unter II.4. beruhen auf der glaubhaften Aussage des Zeugen van V. Der Angeklagte Hofmann bestreitet, dass solche Lagerausräumungen unter seiner Verantwortung und Leitung stattgefunden hätten. Er wird jedoch durch die glaubhafte Bekundung des Zeugen van V., der als Blockältester sämtliche Lagerausräumungen und Selektionen mitmachen musste und als Funktionshäftling einen Überblick über die Lagerverhältnisse gehabt hat, überführt. Das Gericht hat keine Zweifel an der Richtigkeit der Angaben dieses Zeugen.
IV. Rechtliche Würdigung
1. Zu II.1.
Es bedarf keiner näheren Begründung, dass der Angeklagte Hofmann im Rahmen seines Rampendienstes durch die geschilderten Tätigkeiten einen kausalen Tatbeitrag zu den Massentötungen jüdischer Menschen geleistet hat. Als diensthabender SS-Führer hat er eine wichtige Funktion im gesamten Vernichtungsapparat ausgeübt.
Auch er hat den Rampendienst auf Befehl seiner Vorgesetzten geleistet. Seine strafrechtliche Verantwortlichkeit ist daher ebenfalls, da er Angehöriger der Waffen-SS gewesen ist, im Rahmen des §47 MStGB zu prüfen.
Er hat - wie alle anderen SS-Angehörigen - klar erkannt, dass die Tötungen der unschuldigen jüdischen Menschen verbrecherisch waren und die auf diese Tötungen hinzielenden Befehle der Übergeordneten Dienststellen bis hinauf zum "Führer" allgemeine Verbrechen zum Gegenstand hatten. Er hat bei seiner Vernehmung zur Sache selbst eingeräumt, dass er bereits damals die Vergasungen als Unrecht angesehen habe. Im übrigen gilt auch für den Angeklagten Hofmann, was bereits unter A.V.2. ausgeführt worden ist. Ihn trifft daher die Strafe des Teilnehmers.
Nach der Überzeugung des Gerichts hat der Angeklagte Hofmann die Massentötung der jüdischen Menschen innerlich bejaht und sie zu seiner eigenen Sache gemacht. Er hat die Vernichtung der Juden in Übereinstimmung mit den Zielen der NS-Machthaber für notwendig gehalten und hat, indem er alle rechtlichen, sittlichen und moralischen Bedenken unterdrückt und sein Gewissen zum Schweigen gebracht hat, hierbei bereitwillig mitgewirkt. Er wollte nicht nur die Taten der Haupttäter fördern, sondern im Zusammenwirken mit den NS-Machthabern und anderen SS-Führern, -Unterführern und -Männern selbst die Juden vernichten, weil er
es im Interesse des NS-Staates für erforderlich hielt. Er hat somit nach der Überzeugung des Gerichts mit Täterwillen gehandelt.
Diese Überzeugung des Gerichts stützt sich auf folgendes: Der Angeklagte Hofmann war ein überzeugter und fanatischer Nationalsozialist und ein eifriger SS-Mann, der sich ganz dem in der SS herrschenden Geist verschrieben hatte. Dies zeigt sich nicht nur darin, dass er bereits vor der sog. Machtergreifung in die NSDAP und die SS eingetreten ist, sondern folgt vor allem daraus, dass er bereits im Jahre 1933 als Bewacher im KL Dachau eingesetzt wurde und in den folgenden Jahren bis zum Kriegsende stets nur im KZ-Dienst Verwendung fand. Im Jahre 1933 nahm man zu solchen Aufgaben nur "bewährte Kämpfer" und überzeugte Anhänger der NS-Weltanschauung.
Im KZ-Dienst hat sich der Angeklagte Hofmann von 1933 bis 1945 bewährt. Er stieg von Stufe zu Stufe, bis er stellvertretender Schutzhaftlagerführer im KL Dachau wurde. Seit 1936 wurde er laufend jeweils nach relativ kurzer Zeit befördert. Das zeigt, dass er sich im Sinne Eickes durch Härte und Brutalität gegen die sog. Staatsfeinde ausgezeichnet und diese ganz im Sinne des in der SS herrschenden Geistes behandelt haben muss. Es spricht eindeutig dafür, dass er sich ganz der NS-Weltanschauung verschrieben und mit ihren Grundsätzen übereingestimmt haben muss. Dass auch die höhere KL-Führung ihn als einen pflichteifrigen und zuverlässigen SS-Führer, der besonders geeignet für die Durchführung des NS-Vernichtungsprogrammes im Rahmen der sog. Endlösung der Judenfrage erschien, angesehen hat, zeigt sich dahin, dass man ihn am 1.12.1942 zum KL Auschwitz, das als die grösste Vernichtungsstätte für die europäischen Juden ausersehen war, versetzt hat.
Auch im KL Auschwitz hat er sich bewährt. Im Frühjahr 1943 wurde er bereits erster Schutzhaftlagerführer in Birkenau. Nach der glaubhaften Aussage des Zeugen van V. erschien der bisherige Lagerführer Schwarzhuber der höheren SS-Führung zu weich. Aus diesem Grunde wurde er durch den härteren SS-Führer, nämlich den Angeklagten Hofmann abgelöst, dem man den im ganzen Lager gefürchteten und berüchtigten Rapportführer Palitzsch zur Seite gab. In der Funktion als erster Schutzhaftlagerführer hat sich Hofmann rücksichtslos mit dem Vernichtungsprogramm der NS-Machthaber identifiziert und erbarmungslos alle Menschen vernichtet, die im Sinne der NS-Führung nicht mehr nützlich erschienen, indem er - wie oben unter II.4. festgestellt worden ist - Tausende von Häftlingen, die schwach und arbeitsunfähig waren, töten liess. Vor allem seine Tätigkeit in Birkenau gibt nach Auffassung des Schwurgerichts klaren Aufschluss darüber, dass er nicht nur befehlsgemäss handelte, sondern aus eigenem Antrieb danach trachtete, alle sog. Staatsfeinde, die nicht mehr nützlich erschienen, auszurotten. Denn er hätte es als erster Schutzhaftlagerführer in der Hand gehabt, für die ärztliche Betreuung der kranken und schwachen Häftlinge zu sorgen. Er hätte den in Block 7 untergebrachten Kranken Verpflegung zukommen lassen können und er hätte die Lagerausräumungen, die er anordnete, unterlassen können. Wenn er aber im Lager die arbeitsunfähigen und schwachen Häftlinge, die zum grössten Teil aus Juden bestanden, aus eigenem Antrieb vernichtete, so spricht das eindeutig dafür, dass er auch in innerer Übereinstimmung mit der Rassenlehre und den Zielen der NS-Machthaber bezüglich der Vernichtung der mit RSHA-Transporten angekommenen Juden war und deren Tötung aus eigenem inneren Antrieb wollte.
Das Schwurgericht hat daher keinen Zweifel, dass der Angeklagte Hofmann die Tötung der jüdischen Menschen in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken mit den Haupttätern und einer Vielzahl anderer SS-Männer als eigene Taten wollte, weil er ihnen wegen ihrer Zugehörigkeit zur jüdischen Rasse kein Lebensrecht mehr zuerkannte.
Daraus folgt, dass er selbst - wie die Haupttäter - auch aus niedrigen Beweggründen handelte. Im übrigen kannte er die Beweggründe der Haupttäter, da er nach den getroffenen Feststellungen wusste, dass die RSHA-Juden nur wegen ihrer Abstammung getötet wurden.
Der Angeklagte Hofmann kannte die gesamten Umstände, die die Tötung der Juden als heimtückisch und grausam kennzeichnen. Denn - wie oben festgestellt - wusste er, dass die gesamten Vernichtungsaktionen unter strengster Geheimhaltung und unter Tarnbezeichnungen erfolgten und dass die jüdischen Menschen bis zuletzt über ihr bevorstehendes Schicksal getäuscht wurden. Auch erlebte er, da er selbst dabei war, die Art ihrer Tötung und ihren Todeskampf, nahm somit Kenntnis von allen Umständen, die die Tötung als grausam erscheinen lassen. Er handelte somit vorsätzlich.
Der Angeklagte Hofmann hatte auch das Bewusstsein, Unrecht zu tun. Er hat - wie oben ausgeführt - erkannt, dass die massenweise Tötung jüdischer unschuldiger Menschen ein allgemeines Verbrechen war. Er selbst hat nicht behauptet, dass er die Tötung der Juden für rechtmässig gehalten hätte. Vielmehr hat er eingeräumt, bereits damals die Vergasung der Juden als Unrecht angesehen zu haben. Im übrigen kann hierzu auf die Ausführung unter A.V.2., die auch für den Angeklagten Hofmann gelten, Bezug genommen werden.
Irgendwelche Rechtfertigungs- oder Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich.
Der Angeklagte Hofmann war daher wegen seiner Mitwirkung an der Massenvernichtung jüdischer Menschen, wegen gemeinschaftlichen Mordes in mindestens drei Fällen (§§47, 211, 74 StGB) jeweils begangen in gleichartiger Tateinheit (§73 StGB) an jeweils mindestens 750 Menschen zu dreimal lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen.
2. Zu II.2.
Der Angeklagte Hofmann hat in den festgestellten mindestens drei Fällen, in denen jeweils zehn Häftlinge, insgesamt also 30 Häftlinge, getötet wurden, einen kausalen Tatbeitrag zu dem Tode dieser Häftlinge geleistet, indem er zu den Bunkerentleerungen mit in den Arrestbunker ging und dort bei der Auswahl der zu erschiessenden Häftlinge mitberaten und sein Einverständnis zu der Tötung der ausgewählten Häftlinge gegeben hat. Er hat ferner, da er SS-Führer war, durch seine Anwesenheit bei den Bunkerentleerungen und während der Erschiessungen auf dem Hof zumindest einige SS-Unterführer und SS-Männer psychisch gestärkt, an den Tötungsaktionen mitzuwirken, und dazu beigetragen, dass diese ihre rechtlichen, sittlichen und moralischen Hemmungen verdrängten und ihr Gewissen zum Schweigen brachten. Auch hat er durch seine Anwesenheit im Zusammenwirken mit den anderen SS-Angehörigen den zum Tode bestimmten Häftlingen vor Augen geführt, dass ein Widerstand gegen ihr Schicksal sinnlos sei. Das war dem Angeklagten Hofmann nach der Überzeugung des Gerichts auch bewusst. Denn es ergibt sich aus der gesamten Situation.
Im Falle des Angeklagten Hofmann ist nach Auffassung des Gerichts für die Anwendung des §47 MStGB kein Raum. Nach der gesamten Sachlage ist seine Mitwirkung nicht auf Grund des Befehls eines Vorgesetzten erfolgt. Er hatte selbst den Rang eines SS-Obersturmführers. Dem SS-Untersturmführer Grabner, der massgeblichen Anteil an den Aktionen hatte, unterstand er nicht. Noch weniger brauchte er sich Befehlen des Angeklagten Boger zu beugen, der ebenfalls entscheidenden Einfluss auf die Auswahl der zu erschiessenden Häftlinge nahm. Zwar unterstand er rangmässig und in seiner Funktion als dritter Schutzhaftlagerführer dem ersten Schutzhaftlagerführer, Hauptsturmführer Aumeier. Zwischen beiden bestand aber nach der gesamten Sachlage und der inneren Einstellung des Angeklagten Hofmann zu den sog. Staatsfeinden im Lager, wie sie oben unter IV.1. dargestellt ist und wie sie insbesondere bei Lagerausräumungen in Birkenau offenbar geworden ist, das Einverständnis von Komplizen, die sich aus freien Stücken zu Verbrechen zusammenfinden und diese gemeinsam ausführen. Eines Befehls des ersten Schutzhaftlagerführers bedurfte es daher nicht.
Der Angeklagte Hofmann hat nach der Überzeugung des Gerichts aus freien Stücken die Tötung der Häftlinge innerlich bejaht und als eigene Taten gewollt. Hierfür spricht nicht nur, dass der Angeklagte Broad bereits im Jahre 1945 in seinen Aufzeichnungen ausgeführt hat, dass der Obersturmführer Hofmann "massgeblich" an den Aktionen im Arrestbunker beteiligt gewesen sei, sondern es gelten auch alle oben unter IV.1. angeführten Gesichtspunkte für seinen Täterwillen bei den Judenvernichtungen. Dass für den Angeklagten Hofmann das Leben eines Häftlings kaum einen Wert besass und er kaltblütig das Leben von Häftlingen vernichtete, wenn er es für zweckmässig hielt, ergibt sich weiter daraus, dass er in Birkenau einen Zigeuner aus nichtigem Anlass durch einen Flaschenwurf getötet hat.
Der Angeklagte Hofmann hat somit nicht auf Befehl, sondern in bewussten und gewollten Zusammenwirken mit anderen SS-Führern und Unterführern an den Bunkerentleerungen und nachfolgenden Erschiessungen mitgewirkt und den Tod der 30 Häftlinge als eigene Taten gewollt, um im Arrestbunker Platz für weitere Arrestanten zu schaffen. Er hat somit auch selbst aus niedrigen Beweggründen gehandelt.
Er kannte nach den getroffenen Feststellungen auch die gesamten Umstände, die die Tötungen als grausam kennzeichnen, da er selbst die gesamten Aktionen von Anfang bis zum Ende miterlebt hat.
Dem Angeklagten Hofmann fehlte auch nicht das Bewusstsein, Unrecht zu tun. Er hat sich selbst nicht darauf berufen, dass er die Erschiessungen für rechtmässig gehalten hätte. Vielmehr hat er eingeräumt, dass er sie schon damals als unrechtmässig angesehen habe. Daran könnten, auch wenn er dies nicht zugegeben hätte, auch gar keine Zweifel bestehen. Denn selbstherrlich angeordnete Erschiessungen der Häftlinge waren - wie schon ausgeführt - auch nach der damaligen Auffassung der SS-Führung nicht erlaubt. Alle SS-Angehörigen waren darüber belehrt worden, dass es im KL Auschwitz verboten war, eigenmächtig Häftlinge zu misshandeln oder gar zu töten. Auch der Angeklagte Hofmann kannte dieses Verbot. Irgendwelche Rechtfertigungs- oder Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich.
Der Angeklagte Hofmann war daher wegen gemeinschaftlichen Mordes in mindestens dreissig Fällen (§§47, 211, 74 StGB) zu dreissigmal lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen. Dass die Erschiessung eines jeden Häftlings, an der der Angeklagte Hofmann beteiligt war, eine selbständige Handlung im Sinne des §74 StGB darstellt, ist oben bereits ausgeführt worden.
3. Zu II.3.
Die Tötung des Zigeuners erfüllt den Tatbestand des §211 StGB. Denn der Angeklagte Hofmann hat den Tod des Häftlings vorsätzlich und heimtückisch herbeigeführt. Nach den getroffenen Feststellungen hat er dem Zigeuner in Tötungsabsicht die Flasche an den Kopf geworfen, und der Tod des Zigeuners ist infolge der durch den Aufprall der Flasche erlittenen Verletzungen eingetreten.
Die Tötung erfolgte heimtückisch. Denn der Zigeuner war, als er sich nach der Mütze bückte, arg- und wehrlos. Er brauchte in diesem Moment nicht mit einem tödlichen Angriff des Angeklagten Hofmann zu rechnen. Damit hat er auch nicht gerechnet, sonst hätte er den Angeklagten Hofmann beobachtet und wäre dem Wurf ausgewichen oder schnell weggelaufen. In seiner Arglosigkeit war er auch gleichzeitig wehrlos, da er keine Möglichkeit hatte, sich gegen den unerwarteten Angriff zu wehren.
Der Angeklagte Hofmann hat diese Arg- und Wehrlosigkeit bewusst ausgenutzt. Denn, wie sich aus dem gesamten Ablauf des Geschehens ergibt, hat er auch durch das Manöver mit der Mütze bewusst die Situation herbeigeführt, in der er ungehindert den tödlichen Wurf anbringen konnte und hat die Flasche genau in dem Augenblick geworfen, in dem der Häftling infolge des Bückens dem Angriff nicht ausweichen konnte. Dass dem Angeklagten Hofmann dabei auch nicht das Unrechtsbewusstsein gefehlt hat, bedarf kaum einer näheren Begründung. Jedermann ist das in §211 enthaltene Tötungsverbot bekannt. Es galt auch im KL Auschwitz gegenüber sog. "Staatsfeinden". Nicht einmal die NS-Machthaber und die höhere SS-Führung hatten den SS-Führern und Unterführern im KL Auschwitz die Befugnis eingeräumt (wozu sie allerdings auch gar nicht berechtigt gewesen wären), eigenmächtig Häftlinge zu töten. Das war dem Angeklagten Hofmann bekannt. Denn er war wie alle anderen SS-Angehörigen darüber belehrt worden. Misshandlungen und eigenmächtige Tötungen von Häftlingen waren nach diesen Belehrungen streng verboten.
Er war daher wegen der Tötung des Zigeuners nach §211 StGB wegen Mordes zu lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen.
4. Zu II.4.
Wegen der unter II.4. getroffenen Feststellungen ist der Angeklagte Hofmann nicht angeklagt. Die dort aufgeführten Taten werden ihm in dem Eröffnungsbeschluss nicht zur Last gelegt.
Der Einbeziehung der von der Staatsanwaltschaft erhobenen Nachtragsanklage hat der Angeklagte Hofmann nicht zugestimmt. Sie ist daher in das Hauptverfahren nicht einbezogen worden. Einer rechtlichen Beurteilung der unter II.4. getroffenen Feststellungen bedurfte es daher nicht, da der Angeklagte Hofmann insoweit nicht verurteilt werden konnte. Sein Verhalten im Lager Birkenau als erster Schutzhaftlagerführer gibt aber - wie schon ausgeführt - Aufschluss über seine innere Einstellung zu den Massentötungen der jüdischen Menschen und den Tötungen von Häftlingen nach sog. Bunkerentleerungen.
V. Hilfsbeweisanträge
1. Die Verteidigung des Angeklagten Hofmann beantragt hilfsweise die Verlesung von Blatt 56 des Auschwitzheftes Nr.6, woraus sich ergeben soll, dass der erste Schutzhaftlagerführer, SS-Hauptsturmführer Aumeier, am 16.8.1943 durch den SS-Hauptsturmführer Schwarz ersetzt worden ist.
Diese Tatsache kann zu Gunsten des Angeklagten als wahr unterstellt werden, der Antrag war daher abzulehnen.
2. Zurückzuweisen waren auch die Anträge auf Verlesung von Blatt 93 des Auschwitzheftes Nr.7 und Blatt 22 des Auschwitzheftes Nr.1.
Mit der Verlesung der ersten Eintragung soll bewiesen werden, dass der Lagerkommandant Liebehenschel am 11.5.1944 abgelöst wurde, während auf Blatt 22 des Auschwitzheftes Nr.1 geschildert sein soll, dass Ende 1943 mit dem Wechsel des Lagerkommandanten die Massenerschiessungen auf Block 11 aufgehört hätten und die Todeswand auseinandergenommen worden sei.
Diese Tatsachen hat das Gericht bereits als erwiesen angesehen.
3. Die Verteidigung beantragt weiterhin die Verlesung des Kalendariums der Ereignisse in Auschwitz vom 23.11.1943 (Bl.79 des Auschwitzheftes Nr.6), aus dem sich ergeben soll, dass der neue Lagerkommandant Liebehenschel an diesem Tage den Bunker von Block 11 besichtigte und 56 Häftlinge in das Lager entliess.
Der Antrag war abzulehnen, da diese unter Beweis gestellten Tatsachen für die Würdigung des Verhaltens des Angeklagten Hofmann im Konzentrationslager Auschwitz ohne Bedeutung sind; er hat selbst nicht behauptet, auf diese Entscheidung von Liebehenschel irgendeinen Einfluss genommen zu haben.
4. Aus den gleichen Gründen war der Hilfsantrag auf Beiziehung der Akten 2 Ks 8/61 der StA München, auf Verlesung des dort gefassten Beschlusses vom 11.3.1964 über die Zulassung der Wiederaufnahme des Verfahrens und auf Verlesung der Aussage eines Zeugen Lippold zurückzuweisen. Die Tatsache der Verurteilung des Angeklagten Hofmann durch das Schwurgericht in München ist für die Entscheidung in dieser Sache ohne Bedeutung; damit ist auch ebenso ohne Bedeutung, was in der dortigen Sache ein Zeuge Lippold gesagt und ob mit Beschluss vom 11.3.1964 die Wiederaufnahme des Verfahrens zugelassen worden ist.
5. Die weiteren Hilfsbeweisanträge, Bl.52 des Auschwitzheftes Nr.3, Bl.82-87 des Heftes Nr.6, Bl.72-93 des Heftes Nr.7 und Bl.75 des Auschwitzheftes Nr.7 zu verlesen, waren nicht zu bescheiden, da sie nur für den Fall gestellt waren, dass das Schwurgericht in den Punkten 7 und 9 des Eröffnungsbeschlusses nicht auf Freispruch erkennen würde.
6. Abzulehnen waren die hilfsweise gestellten Anträge auf Verlesung von Bl.85 des Auschwitzheftes Nr.4 und des Kalendariums vom 1.3.1943 - 30.9.1943 in den Auschwitzheften Nr.4 und 6. Durch die beantragte Verlesung soll bewiesen werden, dass im Zigeunerlager in der Zeit vom 1.3. bis 30.9.1943 keine der üblichen Lagerselektionen stattgefunden haben; hiervon geht das Gericht nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme bereits aus; die unter Beweis gestellten Tatsachen sind erwiesen.
7. Zurückzuweisen war weiterhin der Antrag auf Verlesung von Seite 73 und 120 der Aufzeichnungen von Höss "Kommandant in Auschwitz".
Mit dem Antrag wird unter Beweis gestellt, dass in den ersten Kriegstagen ein SS-Führer und Gestapo-Beamter auf Befehl des Reichsführers-SS erschossen worden ist, weil er nach Erzählungen des Begleitkommandos einem kommunistischen Funktionär bei seiner Festnahme aus Gutmütigkeit die Flucht ermöglicht hatte und dass eine Aufseherin in einem Frauenkonzentrationslager, die sich mit männlichen Häftlingen in geschlechtliche Beziehungen eingelassen und dafür mit wertvollem Schmuck hatte bezahlen lassen, ihrerseits auf Befehl des Reichsführers-SS auf Lebenszeit in ein Konzentrationslager eingewiesen worden ist.
Diese Tatsachen sind für die Entscheidung in dieser Sache ohne Bedeutung.
8. Schliesslich war auch noch der Antrag auf Vernehmung der Ehefrau des Angeklagten Hofmann abzulehnen.
In deren Wissen wird gestellt,
a. dass der Angeklagte Hofmann im Jahre 1941/1942 um Frontversetzung bat, sein Gesuch in Berlin aber mit der Begründung schriftlich abgelehnt wurde, er habe seinen Dienst dort zu tun, wo er hingestellt sei, und
b. dass sie nach Kriegsende mehrere Schreiben ehemaliger Häftlinge erhalten hat, die sich für anständige Behandlung durch den Angeklagten bedankten.
Die unter Beweis gestellten Tatsachen können so behandelt werden, als wären sie wahr.
Die innere Einstellung des Angeklagten zu dem Geschehen in Auschwitz und zu seinen Taten wird durch diese Tatsache nicht berührt; es hat sich in der Beweisaufnahme im übrigen immer wieder ergeben, dass praktisch jeder SS-Mann in Auschwitz gleichsam im Schatten der von ihm begangenen Verbrechen dem einen oder anderen Häftling aus irgendwelchen Gründen Vorteile verschaffte, die für diesen oft lebensentscheidend waren.
J. Die Straftaten des Angeklagten Kaduk
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Kaduk
Der Angeklagte wurde am 26.8.1906 als Sohn eines Schmiedes in Königshütte/Oberschlesien geboren. Er hatte noch fünf Brüder. Diese sind während des zweiten Weltkrieges gefallen. Vom 6. bis zum 14. Lebensjahr besuchte der Angeklagte die Volksschule in Königshütte. Er wurde regelmässig versetzt. Nach der Schulentlassung erlernte er drei Jahre das Fleischerhandwerk. Im Herbst 1924 legte er die Gesellenprüfung ab. Anschliessend arbeitete er etwa 1 1/2 Jahre als Metzger im Städtischen Schlachthof in Königshütte. Nachdem er kurze Zeit arbeitslos gewesen war, wurde er 1927 in die Städtische Berufsfeuerwehr in Königshütte übernommen. Nach 5 bis 6 Dienstjahren nahm er an einem Sonderlehrgang teil und wurde dann in die Betriebsfeuerwehr der Stickstoff-Werke in Königshütte überstellt.
Der Angeklagte trat Ende 1939 freiwillig in die allgemeine SS ein. Dann meldete er sich freiwillig zur Waffen-SS. Er wurde im Frühjahr 1940 zur 15. Totenkopfstandarte nach Oranienburg bei Berlin eingezogen. Dort blieb er nur wenige Tage. Dann wurde er nach Plock versetzt. Hier erhielt er seine militärische Grundausbildung. Im Herbst 1940 nahm er an einem Unterführerlehrgang in Lublinitz in Oberschlesien teil. Im Frühjahr 1941 wurde er zum SS-Sturmmann (Gefreiter) befördert. Er kehrte nun wieder nach Plock zurück. Als seine Einheit nach Finnland verlegt wurde, bekam er eine Blinddarm- und Bauchfellentzündung. Nach längerem Lazarettaufenthalt in Danzig und Glatz/Schlesien wurde er von Plock nach Debica zum 9. SS-Regiment versetzt. Von dort kam er 1941 nach Auschwitz, und zwar zunächst zur 4. Kompanie des Wachsturmbannes. Angeblich hat er bei seiner Versetzung nach Auschwitz seinen Chef gebeten, ihn zu seiner Einheit zu schicken, da er - wie er sich einlässt - gern den Osteinsatz hätte mitmachen wollen. Sein Chef habe ihm seinen Wunsch jedoch abgeschlagen, mit der Bemerkung, er - Kaduk - habe dahin zu fahren, wohin er versetzt werde. Er habe damals - so behauptet der Angeklagte weiter - nichts von Auschwitz gewusst. Ihm sei nicht einmal die geographische Lage von Auschwitz bekannt gewesen.
Nachdem der Angeklagte Kaduk einige Zeit in der 4. Wachkompanie Dienst getan hatte, wurde er zum Kommandanturstab versetzt. Er wurde zunächst als Blockführer, später auch als Rapportführer eingesetzt. Im Februar 1943 wurde er zum Unterscharführer befördert. Eine weitere Beförderung (zum Oberscharführer) bestreitet der Angeklagte. Er will bis zuletzt Unterscharführer geblieben sein.
Der Angeklagte behauptet ferner, er habe vom 28.10.1942 bis zum 21.8.1943 im Krankenhaus Glatz wegen Malaria gelegen. Von Mitte August 1943 bis zum 28.9.1943 will er wegen eines Nervenzusammenbruchs von Auschwitz abwesend gewesen sein. Nach der schriftlichen Auskunft der Wehrmachtsauskunftsstelle (WASt.) vom 29.1.1963 war er jedoch nur vom 25.10.1942 bis zum 20.11.1942 wegen Magenbeschwerden und vom 21.8.1943 bis zum 28.9.1943 wegen einer Malariaerkrankung im Lazarett Königshütte. Kaduk blieb in Auschwitz bis zur Auflösung des Lagers im Januar 1945.
Nach dem Zusammenbruch arbeitete der Angeklagte in Löbau in einer Zuckerfabrik. Am 8.Dezember 1945 wurde er von einer sowjetischen Militärstreife festgenommen. Er war von einem ehemaligen Häftling des Konzentrationslagers Auschwitz wiedererkannt worden.
Am 25.8.1947 wurde der Angeklagte durch das "Militärtribunal der Sowjetischen Militärverwaltung des Landes Sachsen" in Bautzen gemäss Artikel 319, 320 der Strafprozessordnung und Art.4 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderativen Sowjetrepublik wegen seiner Tätigkeit als Blockführer und Rapportführer im KZ Auschwitz, unter anderem wegen aktiver Teilnahme an der Vernichtung der Häftlinge, wegen Teilnahme an einer Massenerschiessung in der Nacht zum 1.1.1942, wegen einer von ihm befohlenen Erhängung von 6 Häftlingen, wegen persönlicher Teilnahme an Selektionen von Häftlingen, von denen 1500 zur Vernichtung in die Gaskammern ausgewählt wurden, wegen Erschiessung von ungefähr 8000 Personen auf dem Evakuierungsmarsch "zur Inhaftierung in den Besserungs-Arbeitslagern auf die Dauer von 25 Jahren unter Beschlagnahme der bei seiner Verhaftung abgenommenen Wertgegenstände" verurteilt.
Der Beginn der Strafe wurde vom Militärtribunal auf den 29.4.1947 festgesetzt. Die Strafverbüssung wurde von diesem Datum an gerechnet. Das Urteil unterlag keinem Rechtsmittel.
Der Angeklagte Kaduk verbüsste einen Teil seiner Strafe in der Strafanstalt Bautzen. Dann wurde er begnadigt und am 26.4.1956 aus der Haft entlassen. Von Bautzen ging er nach Westberlin, wo er zuletzt Krankenpfleger war. Während der Strafverbüssung in Bautzen hatte sich der Angeklagte eine Tbc-Erkrankung zugezogen. Die erkrankten Teile der Lunge sind heute verkapselt.
Der Angeklagte Kaduk hat im Jahre 1931 geheiratet. Aus der Ehe ist ein Sohn, der bereits volljährig ist, hervorgegangen. Die Familie des Angeklagten kam im Jahre 1957 im Wege der Familienzusammenführung nach Westberlin. Der Angeklagte befindet sich seit dem 21.7.1959 wegen dieser Sache in Untersuchungshaft.
II. Tatsächliche Feststellungen
Der Angeklagte Kaduk war einer der grausamsten, brutalsten und ordinärsten SS-Männer im KL Auschwitz. Fast alle Häftlinge hatten Angst vor ihm. Wo er im Lager oder bei Arbeitskommandos auftauchte, verbreitete er Furcht und Schrecken. Wer ihn von weitem ins Lager kommen sah, flüchtete mit dem Ruf: "Kaduk kommt!" Dieser Ruf verbreitete sich jeweils in Windeseile. Alle Häftlinge, die ihn hörten, flüchteten in ihre Blocks und versteckten sich, um von Kaduk nicht gesehen zu werden. Für die Häftlinge war es gefährlich, dem Angeklagten Kaduk zu begegnen. Jeder musste damit rechnen, von ihm geschlagen, misshandelt oder aus nichtigem Anlass getötet zu werden. Oft erschien Kaduk angetrunken oder betrunken im Lager. Dann war er völlig unberechenbar. Er schrie Häftlinge, die ihm begegneten, an, fuchtelte wild mit den Armen umher und schoss mit einer Pistole in der Gegend herum.
Bei den Appellen misshandelte der Angeklagte Kaduk die Häftlinge oft aus den geringsten Anlässen (z.B. wenn ein Häftling vergessen hatte, seinen obersten Knopf an der Jacke zu schliessen) schwer. Er schlug und trat sie, bis sie zu Boden fielen. Oft waren sie bewusstlos und mussten weggetragen werden. Wiederholt wurden Häftlinge mit inneren Verletzungen, die sie durch Stiefeltritte des Angeklagten Kaduk erlitten hatten, bewusstlos in den HKB eingeliefert. Inwieweit solche Häftlinge gestorben sind, konnte nicht festgestellt werden mit Ausnahme der noch zu schildernden Fälle. Besondere Freude bereitete es dem Angeklagten Kaduk, die Häftlinge beim Einrücken in das Lager nach der Arbeit zu kontrollieren. Er durchsuchte die Häftlinge nach Lebens- und Genussmitteln. Fand er etwas bei einem Häftling, so schlug er diesen häufig bis zur Bewusstlosigkeit.
Oft durchsuchte der Angeklagte Kaduk auch die Blocks nach zurückgebliebenen Häftlingen. Wenn er einen Häftling erwischte, der nicht mit seinem Arbeitskommando ausgerückt war, schlug er wie wild auf ihn ein.
Am 18.8.1843 fand eine Selektion auf Block 19 statt. Der Lagerarzt sonderte einen grossen Teil der Häftlinge für den Gastod aus. Am nächsten Tag sollten die Ausgesonderten von SS-Männern zu den LKWs gebracht werden. Kaduk führte die SS-Männer an. Ein junger 17-18jähriger Häftling, ein Franzose, warf sich im Mittelgang des Blockes 19 dem Angeklagten Kaduk zu Füssen und flehte um sein Leben. Kaduk trat ihm jedoch mit seinem Stiefel ins Gesicht und in andere Körperteile. Der junge Häftling brach zusammen. Er wurde in einer Decke weggetragen. Ob er gestorben ist, konnte nicht festgestellt werden.
Folgende Straftaten des Angeklagten Kaduk sind erwiesen:
1. Die Auswahl kranker und arbeitsunfähiger Häftlinge im Stammlager zur Vergasung durch den Angeklagten Kaduk (Eröffnungsbeschluss 1 a)
Wie im zweiten Abschnitt unter VII.4.d. ausgeführt worden ist, fanden im KL Auschwitz von Zeit zu Zeit sog. Lagerselektionen statt, bei denen die Häftlinge durch die Lagerärzte, aber auch ohne Anwesenheit von Ärzten, durch andere SS-Angehörige auf ihre Arbeitstauglichkeit geprüft und arbeitsunfähige Häftlinge zur Vergasung ausgesondert und anschliessend in den Gaskammern durch Zyklon B getötet wurden. Der Angeklagte Kaduk nahm in einer unbestimmten Anzahl von Fällen als Block- und Rapportführer an solchen Lagerselektionen teil. Darüber hinaus führte er solche Ausmusterungen auch ohne Anwesenheit eines Lagerarztes durch:
a. Eines Abends - der genaue Zeitpunkt konnte nicht festgestellt werden, es war entweder im Jahre 1943 oder im Jahre 1944 - wurde nach Einbruch der Dunkelheit der Befehl im Stammlager durchgegeben: "Alle Juden antreten! Alle Juden raus!" Die jüdischen Häftlinge traten daraufhin auf der Lagerstrasse an. Sie mussten sich völlig entkleiden und dann hintereinander durch das Badehaus zwischen Block 1 und 2 hindurchgehen. Im Badehaus sass der Angeklagte Kaduk auf einem Schemel. Bei ihm war noch ein anderer SS-Angehöriger, dessen Name nicht bekannt ist. Neben Kaduk stand ferner ein Häftlingsschreiber. Kaduk musterte die an ihm vorbeigehenden Häftlinge. Die nach seiner Meinung schwachen und arbeitsunfähigen Häftlinge nahm er beiseite. Dann liess er ihre Nummern von dem Häftlingsschreiber notieren. Nach der Musterung durften die Häftlinge wieder in ihre Blocks zurückgehen. Noch in der gleichen Nacht wurden die Häftlinge, deren Nummern notiert worden waren, aufgerufen. Sie wurden aus ihren Blocks herausgeholt. Am nächsten Morgen kamen LKWs, mit denen die ausgesuchten Häftlinge zu einer der Gaskammern gebracht wurden. Dort wurden sie mit Zyklon B getötet. Der Angeklagte Kaduk hat im Badehaus eine unbestimmte Anzahl von Häftlingen für den Tod ausgewählt. Die genaue Anzahl konnte nicht festgestellt werden. Mit Sicherheit hat er zwei Häftlinge, nämlich einen Juden namens Hess und einen jüdischen Häftling namens Grünfeld oder Grünberg selektiert. Beide sind anschliessend durch Zyklon B in einer Gaskammer getötet worden.
Der Angeklagte Kaduk wusste, dass er im Badehaus die Häftlinge für den Gastod aussonderte, und dass die Tötung der schwachen und arbeitsunfähigen Häftlinge in der Gaskammer nur deswegen erfolgte, weil sie als überflüssige Esser und unnötige Belastung des Lagers angesehen wurden. Die Art und Weise, wie die Opfer in der Gaskammer den Tod erlitten, war ihm ebenfalls bekannt.
b. Im Spätherbst 1944 war die Anzahl der sog. "Muselmänner" im Stammlager sehr hoch. Von Berlin kam daher der Befehl, dass die Arbeitsunfähigen auszusondern und zu töten seien, da ihr Bestand zu hoch sei. Der Lagerführer Hössler gab den Befehl weiter mit der Devise: "Die Muselmänner müssen weg!" Die Häftlinge des Lagers mussten daher eines Tages vor der alten Wäscherei antreten. Dort wurden sie von den drei Rapportführern auf ihre Arbeitstauglichkeit gemustert. Einer der drei Rapportführer war der Angeklagte Kaduk. Er sonderte zusammen mit den anderen beiden Rapportführern mindestens 1000 Häftlinge aus, die nach ihrer Meinung nicht mehr arbeitstauglich waren. Kaduk war dabei sehr eifrig. Anschliessend wurden die ausgesonderten Häftlinge mit LKWs zu einer der vier Gaskammern nach Birkenau gefahren. Dort wurden sie durch Zyklon B getötet.
Auch in diesem Falle wusste der Angeklagte Kaduk, dass die Häftlinge als "unnütze Esser" zur Tötung ausgesucht und anschliessend in der Gaskammer vergast worden sind.
2. Die Tötung eines Häftlings durch den Angeklagten Kaduk (Eröffnungsbeschluss 7)
Im Spätsommer 1944 fehlte bei einem Abendappell ein Häftling. Die angetretenen Häftlinge mussten daher stehen bleiben. Die Blockführer durchsuchten die Blocks nach dem fehlenden Mann. Sie fanden ihn im Block 15 und schleppten ihn zum Appellplatz. Dort schlugen der Angeklagte Kaduk und der Rapportführer Clausen auf den Häftling ein. Der Häftling fiel mehrfach zu Boden. Kaduk schüttete immer wieder Wasser über den Häftling. Jedesmal, wenn sich der Häftling erhob, schlugen beide erneut auf ihn ein. Schliesslich blieb der Häftling auf dem Rücken liegen. Er lebte noch. Kaduk und Clausen stellten sich rechts und links von dem liegenden Mann hin und traten mit voller Kraft mit ihren Stiefelabsätzen auf den Brustkorb des Häftlings ein, so dass die Rippen desselben krachten. Sie hörten mit dem Treten erst auf, als der Häftling kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Der Häftling starb infolge dieser Misshandlungen auf der Stelle.
3. Die Tötung eines Häftlings im September oder Oktober 1943 (Eröffnungsbeschluss 18)
Ende September oder in der ersten Hälfte des Oktober 1943 kontrollierte der Angeklagte Kaduk ein Häftlingskommando, das Steine von der Eisenbahnstation zum Lager auf einem Weg von etwa 2 km Länge schleppen musste. Die Häftlinge des Kommandos hatten zum grössten Teil kein Schuhwerk. Sie mussten barfuss gehen. Infolgedessen hatten viele Häftlinge erhebliche Fussbeschwerden und konnten sich nur noch mühsam fortbewegen. Als der Angeklagte Kaduk dies sah, schimpfte er mit ihnen und warf ihnen vor, dass sie zu langsam arbeiteten. Er verlangte, dass sie die Steine im Laufschritt tragen sollten. Als viele Häftlinge dieser Aufforderung aus Erschöpfung und wegen ihrer Fussbeschwerden nicht nachkommen konnten, machte der Angeklagte Kaduk "Sport" mit ihnen. Die Häftlinge mussten auf Kaduks Befehl im Kreise im Laufschritt herumlaufen, springen, hüpfen, sich niederfallen lassen und wieder aufstehen, wie Frösche springen usw., bis schliesslich drei Häftlinge aus Erschöpfung den "Sport" nicht mehr mitmachen konnten. Kaduk schlug nun auf die erschöpften drei Häftlinge längere Zeit ein und trat sie mit seinen Stiefeln wahllos in den Körper. Einer der drei Häftlinge war im Alter von etwa 50 Jahren. Er war krank und schwach. Er starb kurz danach an den Folgen der von Kaduk erhaltenen Schläge und Fusstritte. Der Angeklagte Kaduk rechnete während der Misshandlungen dieses schwachen und kranken Häftlings damit, dass dieser durch die Misshandlung oder an deren Folgen sterben könnte. Er nahm dies jedoch bewusst in Kauf und billigte es.
4. Die Tötung von drei Häftlingen im September oder Oktober 1943 im Quarantänelager in Birkenau (Eröffnungsbeschluss Ziffer 19)
Um die gleiche Zeit fehlte bei einem Mittagsappell im Quarantänelager (B II a) in Birkenau ein Häftling aus Block 4. Die Blockführer durchsuchten deswegen das Quarantänelager, ohne den Häftling zu finden. Daraufhin wurden weitere SS-Angehörige von ausserhalb des Quarantänelagers zu der Suchaktion hinzugezogen. Auch der Angeklagte Kaduk war unter ihnen. Aus jedem Block - es waren insgesamt sechs Blocks - wurden nun je drei Häftlinge als sog. "Geiseln" ausgesondert und neben ihren Blocks gesondert aufgestellt. Man sagte ihnen, dass sie erschossen würden, wenn der fehlende Häftling nicht gefunden würde. Nach einer Suchaktion von etwa zwei bis drei Stunden fand man den fehlenden Häftling tot in einem Holzhaufen. Er hatte sich in den Holzhaufen verkrochen und war in seinem Versteck verstorben.
Obwohl der Häftling gefunden worden war, ging der Angeklagte Kaduk zu den drei aus dem Block vier ausgewählten "Geiseln" hin, zog seine Pistole und erschoss sie nacheinander. Zu einem Blockältesten sagte er sinngemäss: "Verrecken kann man im Lager nur bei der Arbeit und nicht wie ein Schwein in der Ecke."
5. Die Tötung eines Häftlings im Spätsommer oder Herbst 1943 (Eröffnungsbeschluss Ziffer 20)
Im Spätsommer oder Herbst 1943, der genaue Zeitpunkt war nicht mehr festzustellen, mussten die Häftlinge im Quarantänelager in Birkenau (B II a) einmal aus irgend einem Grunde einen ganzen Tag über Appell stehen. Niemand durfte die Reihe, in der er stand, verlassen. Ein Häftling, der seine Notdurft nicht mehr halten konnte, schlich sich trotzdem aus seiner Reihe und lief hinter eine Baracke. Dort wurde er, während er seine Notdurft verrichtete, von einem Blockältesten des Blockes 5 erwischt. Der Blockälteste führte ihn vor die angetretenen Häftlinge und schlug ihn. Während des Schlagens kamen zufällig der Angeklagte Kaduk und der SS-Mann Kurpanek am Lager vorbei. Sie kamen in das Lager herein und fragten den Blockältesten, was los sei. Der Blockälteste erklärte ihnen irgend etwas. Daraufhin gab Kurpanek dem Häftling eine Ohrfeige. Der Häftling schwankte etwas und berührte dabei wahrscheinlich den Angeklagten Kaduk. Nun fing dieser an, den Häftling zu schlagen und mit seinen Stiefeln zu treten. Er schlug und trat ihn eine ganze Zeit. Dann riss er plötzlich dem Häftling die Mütze vom Kopf und warf sie in Richtung des Stacheldrahtes und zwar über die Linie hinaus, die kein Häftling überschreiten durfte. Der Häftling lief, um sich die Mütze wiederzuholen. Dabei geriet er in die Zone, deren Betreten für die Häftlinge verboten war. Ein Wachtposten, der in der Nähe in der kleinen Postenkette Wachdienst verrichtete, erschoss den Häftling. Der Angeklagte Kaduk hatte die Mütze des Häftlings nur deswegen in die Verbotszone geworfen, damit der Häftling beim Holen der Mütze in diese Zone geriete und von dem Wachtposten erschossen würde. Er wusste, dass die Wachtposten angewiesen waren, alle Häftlinge nach dem Überschreiten der Grenzlinie und dem Betreten der verbotenen Zone zu erschiessen. Der Häftling, der erst kurz zuvor in das Lager gekommen war, und mit den Gepflogenheiten im Lager, insbesondere dem sog. "Mützenwerfen" nicht vertraut war, ahnte nicht, dass er beim Holen der Mütze erschossen werden könnte.
6. Die Tötung eines Zigeuners im Sommer 1944 im Stammlager (Eröffnungsbeschluss Ziffer 21)
Im Sommer 1944 wurden kurz vor der Vernichtung der Insassen des Zigeunerlagers (B II e) ein Teil der Zigeuner in das Stammlager verbracht. Sie wurden in einem Block untergebracht, der durch einen besonderen Drahtzaun gesichert und besonders bewacht wurde.
An einem Sonntagnachmittag gingen die Häftlinge des Lagers auf der Lagerstrasse auf und ab. Plötzlich gab es Unruhe. Es hiess, dass der Angeklagte Kaduk komme. Alle Häftlinge flüchteten in ihre Blocks, weil sie Angst vor dem unberechenbaren Kaduk hatten. Kaduk begab sich von dem Lagereingang zum Block, in dem die Zigeuner untergebracht waren, zog seine Pistole aus der Pistolentasche und gab beim Zigeunerblock mehrere Schüsse auf die dort befindlichen Zigeuner ab. Durch einen oder mehrere Schüsse wurde ein Zigeuner tödlich getroffen, was der Angeklagte Kaduk beabsichtigt hatte. Die Leiche wurde von anderen Häftlingen zum HKB geschleift und dort bei den Leichen der an diesem Tag verstorbenen Häftlingen abgelegt.
7. Die Tötung von drei Häftlingen auf dem Evakuierungsmarsch (Eröffnungsbeschluss Ziffer 24)
Am 18.1.1945 wurde das KL Auschwitz evakuiert. Die Häftlinge wurden unter strenger Bewachung durch SS-Angehörige des Lagers zu Fuss tagelang vom Lager weggeführt. Viele waren infolge der schlechten Ernährung den Strapazen des Fussmarsches nicht gewachsen. Sie waren bald so erschöpft, dass sie nicht mehr weitermarschieren konnten. Wer zurückblieb, wurde von den begleitenden SS-Posten erschossen.
Der Angeklagte Kaduk begleitete die Häftlinge auf dem Evakuierungsmarsch ebenfalls ein Stück. Er erschoss eigenhändig mehrere Häftlinge, die den Anschluss an die marschierende Kolonne nicht mehr hatten halten können und zurückgeblieben waren. Die Anzahl der von ihm getöteten Häftlinge konnte nicht mehr festgestellt werden. Mit Sicherheit hat er mindestens drei erschöpfte Häftlinge getötet.
Nach einem Befehl aus Berlin war es verboten, Häftlinge auf dem Evakuierungsmarsch, die aus Erschöpfung nicht mehr weiter marschieren konnten und zurückblieben, zu töten.
III. Einlassung des Angeklagten Kaduk, Beweismittel, Beweiswürdigung
Die Feststellungen über das allgemeine Verhalten und die Persönlichkeit des Angeklagten Kaduk im KL Auschwitz und seinen Ruf bei den Häftlingen im Lager beruhen auf den glaubhaften Bekundungen der Zeuginnen Dr. Lin., Her. und Cou. sowie den glaubhaften Aussagen der Zeugen Law., Kl., F., Dr. D., Kru., Kor., Lak., E., Sk., Ch. und Kle. Der Angeklagte Kaduk hat zunächst jede Einlassung zur Sache verweigert. Im Verlaufe der Hauptverhandlung hat er sich zu einzelnen Belastungen und auch zu allgemeinen Fragen geäussert. Er hat eingeräumt; dass er Häftlinge geschlagen habe. Er hat ferner zugegeben, dass das Schlagen von Häftlingen auf Grund einer Anordnung des Reichsführers SS verboten gewesen sei. Ihnen sei das auch öfters gesagt worden. Er habe aber schon damals die Auffassung vertreten, dass es ohne Schlagen der Häftlinge nicht ginge.
Die Feststellungen über die Misshandlung des jungen Häftlings in Block 19 beruhen auf der glaubhaften Aussage des Zeugen Led. Der Angeklagte Kaduk hat zu diesem Fall keine Stellung genommen.
Im übrigen hat sich der Angeklagte wie folgt eingelassen:
1. Zu II.1.
Er hat eingeräumt, dass er bei Lagerselektionen dabeigewesen sei. Er habe aber bei den Selektionen - so hat er behauptet - keine "Entscheidungsfreiheit" und keine "Tatherrschaft" gehabt. Die Ärzte hätten die Häftlinge in die Gaskammern geschickt. Auch andere SS-Führer hätten das getan. Er hätte als kleiner SS-Unterführer hierzu keine Befugnis gehabt. Der Angeklagte Kaduk ist jedoch durch die glaubhafte Aussage des Zeugen Lak. überführt worden, dass er in dem unter II.1.a. geschilderten Fall die schwachen und arbeitsunfähigen Häftlinge selbst ausgemustert hat. Dieser Zeuge hat den Angeklagten Kaduk gekannt. Er hat glaubhaft geschildert, dass Kaduk auf einem Schemel sitzend die schwachen Häftlinge ausgesondert habe und durch den Häftlingsschreiber habe notieren lassen. Die Zahl der ausgesonderten Häftlinge konnte der Zeuge nicht mehr angeben. Der Zeuge wusste aber noch mit Bestimmtheit, dass zwei ihm dem Namen nach bekannte Häftlinge, nämlich ein Jude namens Hess und ein anderer Jude namens Grünfeld oder Grünberg auf Veranlassung des Angeklagten Kaduk notiert worden sind. Der Zeuge hat auch gesehen, dass die Häftlinge am nächsten Morgen nach Birkenau mit LKWs abtransportiert worden sind.
Aus der Tatsache, dass nur Juden auf ihre Arbeitstauglichkeit gemustert worden sind und dass Kaduk nur schwache und arbeitsunfähige Häftlinge mit ihren Nummern hat aufschreiben lassen und dass diese am nächsten Morgen nach Birkenau transportiert worden sind, hat das Gericht den Schluss gezogen, dass diese Häftlinge nicht etwa zu einem Transport in ein anderes Lager, sondern zur Vergasung ausgesucht und anschliessend auch durch Zyklon B getötet worden sind. Es bestehen auch keine Zweifel, dass Kaduk genau gewusst hat, dass die von ihm ausgemusterten Häftlinge getötet werden sollten, weil sie als unnütze Esser nicht mehr nützlich erschienen. Das ergibt sich schon daraus, dass ihm - wie er selbst eingeräumt hat - Lagerselektionen geläufig waren und dass er nach seiner eigenen Einlassung wusste, dass die SS-Ärzte bei Selektionen Häftlinge ins Gas schickten und dass er in diesem Fall zielstrebig nur kranke und schwache Häftlinge aussuchte.
Der Angeklagte Kaduk wusste auch genau, auf welche Weise die Häftlinge umkamen. Denn er ist selbst wiederholt bei den Gaskammern gewesen, wenn Menschen darin durch Zyklon B getötet wurden und hat selbst den Todeskampf der Opfer miterlebt. Er war nämlich oft bei der Ankunft von RSHA-Transporten auf der Rampe und war auch wiederholt bei den anschliessenden Vergasungen der jüdischen Menschen dabei. Deswegen ist er allerdings nicht angeklagt worden, auch wird ihm dies im Eröffnungsbeschluss nicht zur Last gelegt. Hieraus folgt aber, dass er die Tötungsart genau gekannt hat.
Dass der Angeklagte Kaduk bei der Abwicklung von RSHA-Transporten dabeigewesen ist, hat er selbst eingeräumt. Bei den Gaskammern ist er von dem Zeugen Buk. gesehen worden. Der Zeuge hat glaubhaft geschildert, dass Kaduk oft bei den Gaskammern in den umgebauten Bauernhäusern bei Vergasungen von jüdischen Menschen gewesen sei. Er habe dort die SS-Männer kommandiert. Alte und kranke Leute, die sich nicht mehr hätten selbst ausziehen können, habe er unauffällig erschossen. Der Zeuge Buk. hat einen glaubwürdigen Eindruck hinterlassen. Das Gericht hat keinen Zweifel, dass er den Angeklagten Kaduk gekannt und seine Tätigkeit bei den Gaskammern zutreffend geschildert hat. In der Hauptverhandlung hat der Zeuge den Angeklagten wiedererkannt, jedoch hinzugefügt, dass Kaduk damals schmaler gewesen sei, was richtig ist.
Die Aussage des Zeugen Buk. wird zumindest mittelbar durch die Aussage des Zeugen Dr. Sk. bestätigt. Der Zeuge hat einmal - wie er glaubhaft bekundet hat - ein Gespräch zwischen dem Angeklagten Kaduk und dem Rapportführer Hartwig im Badehaus, in dem Zigeunerfrauen gebadet und neu eingekleidet wurden, mit angehört. Der Zeuge war zu der damaligen Zeit in der Bekleidungskammer tätig und musste in dieser Funktion bei der Einkleidung der Frauen dabeisein, um ihnen die Kleider auszuhändigen. Kaduk und Hartwig, die dem Duschen der Frauen zusahen, unterhielten sich anzüglich über die Figur einer Frau, die ihren Büstenhalter nicht ausziehen wollte, von Kaduk und Hartwig hierzu jedoch gezwungen wurde. Bei diesem Gespräch erzählte Kaduk dem Hartwig unter anderem, wie angenehm es sei, wenn man nackte Frauen in die Gaskammern hineinschieben könne. Auch aus dieser Bemerkung, die der Zeuge Dr. Sk. selbst mitangehört hat, hat das Schwurgericht gefolgert, dass der Angeklagte Kaduk die Opfer mit in die Gaskammern hineingeführt und anschliessend ihren Todeskampf miterlebt hat.
Aus diesem Grund ist das Gericht überzeugt, dass der Angeklagte Kaduk die gesamten Umstände, unter denen die von ihm im Badehaus ausgesonderten Häftlinge den Tod erleiden mussten, genau gekannt hat, wenn er auch in diesem Fall nicht selbst bei der Tötung der von ihm für den Tod bestimmten Häftlinge dabeigewesen ist.
Über den unter II.1.b. geschilderten Fall hat der Zeuge Dr. D. berichtet. Der Zeuge, der von Beruf Rechtsanwalt in Wien ist, war damals Lagerältester im Stammlager. Das Gericht hat dem Zeugen, der einen glaubwürdigen Eindruck gemacht hat, vollen Glauben geschenkt. Als Lagerältester konnte der Zeuge auch die Anzahl der zum Tode ausgesonderten Häftlinge feststellen. Für ihn war es auch nicht schwer, auf Grund seiner Beziehungen festzustellen, dass die ausgesonderten Häftlinge in der Gaskammer tatsächlich auch getötet worden sind.
Daran kann im übrigen auf Grund des von Berlin gegebenen Befehls und auf Grund der Tatsache, dass nur "Muselmänner" selektiert worden sind, kein Zweifel bestehen.
Auch hier musste dem Angeklagten nach den gesamten Umständen, nämlich, dass von Berlin der Befehl gegeben worden war, die "Muselmänner" zu beseitigen, und dass bei der Selektion nur Arbeitsunfähige ausgesondert worden sind, klar sein und war ihm nach der Überzeugung des Gerichts auch klar, dass die Häftlinge als überflüssige Esser getötet werden sollten und dass sie anschliessend auch in der Gaskammer getötet worden sind.
Die Zeugen Heinz Her., Stein., Fri., Wö., Kl., Sew., Toc. und Kru. und andere haben ebenfalls von Selektionen durch den Angeklagten Kaduk berichtet. Insoweit konnte jedoch, soweit es sich um andere als die unter II.1.a. und b. geschilderten Selektionen handelt, nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass die ausgesonderten Häftlinge anschliessend auch tatsächlich vergast worden sind. So hat der Zeuge Heinz Her. eine Selektion geschildert, die im Winter 1943/1944 in der alten Wäscherei stattgefunden hat. Der Zeuge wusste jedoch nicht, ob die Selektierten anschliessend auch tatsächlich getötet worden sind. Er gab an, dass damals ein Gerücht umgegangen sei, dass diese Leute nicht vergast worden seien. Die Ausgesonderten seien noch drei oder vier Tage im Lager geblieben. Was dann mit ihnen geschehen sei, wisse er nicht. Auch der Zeuge Stei. hat von einer Selektion durch den Angeklagten Kaduk in der alten Wäscherei berichtet. Er wusste jedoch nicht, ob die ausgesonderten Häftlinge auch getötet worden sind. Nach seiner Darstellung liefen damals widersprechende Gerüchte im Lager herum. Einmal hiess es, dass der Lagerkommandant Liebehenschel die Vergasung verhindert habe, ein anderes Mal, es sei nur ein Teil der Selektierten vergast worden, andere Häftlinge wiederum hätten behauptet, dass alle ausgesonderten Häftlinge vergast worden seien.
Der Zeuge Fri. hat ebenfalls eine Selektion in der alten Wäscherei geschildert, bei der der Angeklagte Kaduk mit einem Stöckchen auf bestimmte Häftlinge gezeigt habe, die dann mit ihren Nummern aufgeschrieben worden seien. Kaduk habe schwache, aber auch kräftige Männer ausgesucht. Der Zeuge meint zwar, dass die ausgesonderten Häftlinge getötet worden seien, weil sehr viele "Muselmänner" unter ihnen gewesen seien. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist die Auffassung des Zeugen auch zutreffend. Da jedoch auch kräftige Männer unter den Selektierten gewesen sind, konnte das Gericht nicht mit letzter Sicherheit die Überzeugung davon gewinnen. Im Hinblick auf die Tatsache, dass auch kräftige Männer ausgesucht worden sind, besteht immerhin die geringe Möglichkeit, dass ein Transport zusammengestellt werden musste und Kaduk diese Gelegenheit benutzt hat, um zusammen mit anderen SS-Männern einen Teil der schwächsten Häftlinge aus dem Lager abzuschieben.
Bei den von den weiteren Zeugen geschilderten Selektionen durch Kaduk konnte nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass sie entweder mit der unter II.1.a. oder mit der unter II.1.b. festgestellten Selektionen identisch sind.
Über die unter II.1.a. und b. getroffenen Feststellungen hinaus konnte dem Angeklagten Kaduk daher nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden, dass er noch in weiteren Fällen selbst die Auswahl von kranken und arbeitsunfähigen Häftlingen vorgenommen hat.
Soweit der Angeklagte Kaduk eingeräumt hat, bei Selektionen durch Ärzte dabeigewesen zu sein, konnten keine sicheren, konkreten Feststellungen getroffen werden. Kaduk hat nach der Aussage verschiedener Zeugen (z.B. P. und Led.) insbesondere auch nach den Selektionen durch die Lagerärzte mitgeholfen, die ausgesonderten Menschen auf LKWs zu verladen. Diese - wenn auch strafbare - Tätigkeit wird von dem Eröffnungsbeschluss jedoch nicht erfasst. Denn dem Angeklagten Kaduk wird unter Ziffer 1 des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegt, an den Selektionen durch Hinweise auf einzelne Häftlinge teilgenommen und mit anderen SS-Angehörigen oder allein eigenmächtig Selektionen durchgeführt zu haben.
Dem Urteil konnte daher nur die unter Ziffer I.1.a. und b. geschilderten Selektionen durch Kaduk zugrunde gelegt werden, wenn auch ein erheblicher Verdacht besteht, dass der Angeklagte Kaduk in einer Vielzahl von Fällen durch Hinweise auf einzelne Häftlinge an Selektionen teilgenommen und darüber hinaus auch noch selbst eigenmächtig Selektionen durchgeführt hat.
Im Falle 1.a. hat der Angeklagte Kaduk eine unbestimmte Anzahl von Häftlingen für den Tod ausgesucht. Da die Feststellung der Anzahl der auf Grund dieser Selektion getöteten Menschen nicht auf unsichere Schätzungen gestützt werden konnte, hat sich das Schwurgericht darauf beschränkt, in diesem Falle nur eine Mindestzahl festzustellen. Nach der Aussage des Zeugen Lak. sind auf jeden Fall zwei Häftlinge, nämlich Hess und Grünfeld oder Grünberg von Kaduk ausgesondert und anschliessend getötet worden. Es konnte daher mit Sicherheit festgestellt werden, dass Kaduk bei dieser Selektion mindestens zwei Häftlinge für den Tod ausgesucht hat, die anschliessend durch Zyklon B getötet worden sind.
Im Falle 1.b. ergibt sich die Mindestzahl der von Kaduk im Zusammenwirken mit anderen SS-Unterführern ausgesonderten und anschliessend getöteten Häftlingen aus der glaubhaften Aussage des Zeugen Dr. D.
2. Zu II.2.
Der Angeklagte Kaduk hat in Abrede gestellt, einen Häftling beim Appell zusammen mit Clausen totgetrampelt zu haben. Er ist jedoch durch die glaubhafte Aussage des Zeugen Dr. Sk. überführt worden, der den Fall so wie er unter II.2. dargestellt worden ist, geschildert hat.
Der Zeuge Dr. Sk., Rechtsanwalt von Beruf, hat einen glaubwürdigen Eindruck gemacht. Er hat den Fall klar, ruhig, sachlich und leidenschaftslos geschildert. Bei seiner früheren Vernehmung hat er den Fall schon genau so dargestellt wie in der Hauptverhandlung. Der Zeuge hat erklärt, dass dieser Fall eine der schrecklichsten Erinnerungen an das KL Auschwitz sei. Er hat den Angeklagten Kaduk gut gekannt. Irgendeine Verwechslungsmöglichkeit scheidet aus.
3. Zu II.3., 4. und 5.
Der Angeklagte Kaduk hat in Abrede gestellt, jemals Häftlinge in Auschwitz getötet zu haben. Im Quarantänelager in Birkenau habe er - so hat er sich eingelassen - nie dienstlich etwas zu tun gehabt. Er sei nur im Stammlager eingesetzt gewesen. Im übrigen sei er um die fragliche Zeit malariakrank gewesen.
Der Angeklagte Kaduk ist jedoch durch die glaubhafte Aussage des Zeugen Dö. überführt worden, in den unter II.3., 4. und 5. geschilderten Fällen
namentlich nicht bekannte Häftlinge getötet zu haben. Das Gericht hat dem Zeugen, der einen ausgezeichneten Eindruck gemacht und die einzelnen Fälle so wie sie oben nach der äusseren Tatseite hin geschildert worden sind, klar, ruhig und widerspruchsfrei dargestellt hat, vollen Glauben geschenkt. Der Zeuge war vom 25.8.1943 bis etwa Mitte Oktober 1943 im Quarantänelager untergebracht. Tagsüber musste er mit den anderen Häftlingen zur Arbeit ausrücken. Er kannte - wie er glaubhaft versichert hat - den Angeklagten Kaduk. Daran zu zweifeln, hatte das Gericht keinen Anlass. Denn der Angeklagte Kaduk war den meisten Häftlingen im KL Auschwitz wegen seiner Brutalität und Grausamkeit bekannt. Sie warnten sich gegenseitig vor ihm. Wie oben schon ausgeführt, gingen ihm die Häftlinge wegen seines schlechten Rufes, soweit möglich, aus dem Wege.
Der Angeklagte Kaduk war nach der schriftlichen Auskunft der Wehrmachtsauskunftsstelle (WASt.) vom 29.1.1963, die in der Hauptverhandlung verlesen worden ist, im Jahre 1943 nur vom 21.8.1943 bis 28.9.1943 erkrankt und befand sich während dieser Zeit im Lazarett. Am 28.9.1943 wurde er wieder als k.v. zum SS-Kommandanturstab in Auschwitz entlassen. Da der Zeuge Dö. bis etwa Mitte Oktober 1943 im Quarantänelager gewesen ist, können sich die Vorfälle in der Zeit zwischen dem 28.9.1943 und Mitte Oktober 1943 abgespielt haben. Der Zeuge Dö. konnte einen genauen Zeitpunkt für die geschilderten Taten nicht mehr angeben. Er wusste nur noch, dass sie während seines Aufenthaltes im Quarantänelager, also in der Zeit zwischen dem 25.8. und etwa Mitte Oktober geschehen sind. Der Zeuge Dö. hat nie behauptet, dass Kaduk im Quarantänelager dienstlich eingesetzt gewesen sei. Im Fälle II.4. wurde Kaduk nach der Aussage des Zeugen erst, nachdem das Fehlen des Häftlings festgestellt worden war, mit anderen SS-Männern von ausserhalb herbeigeholt. Im Falle II.5. kam der Angeklagte nach der Darstellung des Zeugen zufällig am Lager vorbei.
Der Zeuge Sz. hat glaubhaft bekundet, dass der Angeklagte Kaduk auch in das Lager Birkenau gekommen sei. Er habe dort bei einem Oberkapo Arnold eine geheime Küche gehabt, wo ein Koch aus Warschau für Kaduk und andere gutes Essen zubereitet habe. Es erscheint daher durchaus möglich, dass Kaduk, auch wenn er nicht in Birkenau dienstlich eingesetzt war, zufällig an dem Quarantänelager vorbeigekommen oder in dem unter II.4. geschilderten Fall als Verstärkung zur Suche eines Häftlings herangezogen worden ist. Da Kaduk es liebte, den Häftlingen Angst und Schrecken einzujagen und die Häftlinge bei jedem geringsten Anlass schlug und misshandelte, erscheint es keineswegs unwahrscheinlich, dass er die Gelegenheit, die sich ihm zufällig im Quarantänelager bot, ausnutzte, um sich "auszutoben", auch wenn er dienstlich nicht zuständig war.
Im Falle II.5. erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass ein Wachtposten den Häftling erschossen hat. Zwar wurde in der Regel tagsüber die kleine Postenkette eingezogen, nachdem die grosse Postenkette aufmarschiert war. Die Grenzzäune des Lagers waren somit tagsüber in der Regel nicht besetzt. Hiervon gab es jedoch Ausnahmen (vgl. 2. Abschnitt II.2.). Bei schlechtem Wetter, Nebel oder starkem Regen, wenn die Arbeitskommandos nicht ausrückten, blieb die kleine Postenkette stehen. Auch aus sonstigen besonderen Anlässen konnte tagsüber die Bewachung des Lagers durch die kleine Postenkette befohlen werden. Hier deutet der Umstand, dass die Häftlinge stundenlang Appell stehen mussten daraufhin, dass ein solcher besonderer Anlass gegeben war. Die Überzeugung des Gerichts, dass Kaduk im Falle II.5. die Mütze des Häftlings nur deswegen in die verbotene Zone geworfen hat, damit dieser erschossen werde, beruht auf der Tatsache, dass es im KL Auschwitz ein "beliebtes Spiel" war, Häftlinge durch das sog. Mützewerfen zu Tode zu bringen (vgl. oben 2. Abschnitt V.8.). Der Angeklagte Kaduk, der bereits im Dezember 1941 nach Auschwitz gekommen war, kannte dieses "Spiel" im Jahre 1943 sehr gut. Als ehemaligem Angehörigen des Wachsturmbannes waren ihm auch die Anweisungen für die Posten auf Wache geläufig. Er wusste daher, dass der Posten schiessen musste, wenn der Häftling die verbotene Zone betreten würde. Welchen anderen Grund das Werfen der Mütze in die Verbotszone sonst gehabt haben sollte, ist nicht ersichtlich.
Dass der Häftling sich auch die Mütze holen würde, damit konnte der Angeklagte Kaduk rechnen. Denn im KL Auschwitz durfte kein Häftling ohne Kopfbedeckung herumlaufen. Nach der Überzeugung des Gerichts ist der Angeklagte Kaduk davon ausgegangen, dass der Häftling als Neuling im Quarantänelager das "Mützewerfen" nicht kannte und zum Holen der Mütze die verbotene Zone betreten würde.
Die Überzeugung des Gerichts, dass der Häftling die Gepflogenheit des "Mützewerfens" nicht kannte und beim Holen der Mütze nicht ahnte, dass er erschossen werden könnte, beruht darauf, dass der Häftling noch ein Neuling im Lager war, was sich daraus ergibt, dass er noch im Quarantänelager untergebracht war. Sie stützt sich ferner auf die Tatsache, dass der Häftling überhaupt nach der Mütze lief, obwohl diese in der verbotenen Zone lag. Denn ältere Häftlinge, die das "Mützewerfen" kannten, liessen ihre Mützen eher liegen, ehe sie ihr Leben riskierten. Sie besorgten sich lieber eine andere Mütze von einem Verstorbenen, was bei der Vielzahl der Todesfälle oft sehr schnell möglich war.
4. Zu II.6.
In diesem Fall hat es der Angeklagte Kaduk abgelehnt, eine Erklärung abzugeben. Die Feststellungen des Gerichts beruhen auf der glaubhaften Aussage des Zeugen E. Der Zeuge war zunächst Soldat in der deutschen Wehrmacht von 1939 bis 1940. Im Juli 1943 wurde er verhaftet, weil man annahm, er sei "Mischling ersten Grades". Im September oder Oktober 1943 kam er nach Auschwitz. Dort blieb er bis zur Evakuierung des Lagers im Januar 1945. Der Zeuge war im Stammlager im Block 16 untergebracht. Er arbeitete im Kommando "Trecker/Garagen" und wurde später Unterkapo und Kommandoschreiber. Es ist daher glaubhaft, dass er den Angeklagten Kaduk, der 1944 Rapportführer war, gut gekannt hat. Der Zeuge, der einen guten und glaubwürdigen Eindruck gemacht hat, verdient vollen Glauben. Er hat nach seiner Bekundung selbst miterlebt, wie der Angeklagte Kaduk an dem betreffenden Tag in das Lager hereinkam und Unruhe im Lager verbreitete. Er hat auch gesehen, wie Kaduk seine Pistole aus der Tasche gezogen und geschossen hat. Er hat auch den Schuss gehört. Dann hat er gesehen, wie ein Häftling zum HKB geschleift worden ist. Von anderen Häftlingen hat der Zeuge dann erfahren, dass der Häftling von Kaduk totgeschossen worden sei. Daraus und aus der Tatsache, dass der Häftling beim HKB bei den Toten abgelegt worden ist, was der Zeuge E. noch gesehen hat, hat das Gericht die sichere Überzeugung gewonnen, dass Kaduk den Häftling durch den Pistolenschuss getötet hat.
Die Aussage des Zeugen E. wird zudem noch mittelbar durch die Bekundung des glaubwürdigen Zeugen Dr. Sk. bestätigt. Dieser Zeuge hat den Vorfall zwar nicht selbst miterlebt, er hat aber bereits im Sommer 1944 von anderen Häftlingen erfahren, dass der Angeklagte Kaduk in der Zeit, in der die Zigeuner kurze Zeit im Stammlager untergebracht gewesen sind, in dem für die Zigeuner abgegrenzten Teil des Stammlagers mit der Pistole geschossen und einen Zigeuner in den Bauch getroffen habe.
5. Zu II.7.
Der Angeklagte Kaduk bestreitet, auf dem Evakuierungsmarsch Menschen getötet zu haben. Er hat sich dahin eingelassen, dass er den Evakuierungsmarsch überhaupt nicht mitgemacht habe. Bereits am 17.1.1945 hätten die SS-Führer ihre Frauen weggebracht. Er habe an diesem Tag den Lagerführer Hössler um Urlaub gebeten, den dieser auch bewilligt habe. Er sei dann nach Hause gefahren. Erst am 19.1.1945 sei er nach Auschwitz zurückgekommen. Da sei das Lager bereits leer gewesen. Es mag sein, dass Kaduk kurz vor der Evakuierung des Lagers noch Urlaub bekommen hat und auch noch nach Hause gefahren ist. Auch wenn er erst am 19.1.1945 nach Auschwitz zurückkam, kann er die Häftlinge auf dem Evakuierungsmarsch begleitet haben. Denn die Häftlinge sind erst am 18.1.1945 von dem Lager losmarschiert. Sie konnten an einem Tage, da sie zum grössten Teil ausgezehrt und geschwächt waren, nur relativ kurze Strecken zurücklegen. Der Angeklagte Kaduk konnte daher mit einem Motorrad oder PKW die Marschkolonne innerhalb kurzer Zeit einholen. Der Zeuge Her. hat glaubhaft bekundet, dass der Angeklagte Kaduk mit einem Motorrad oder Wagen hinter der Marschkolonne hergefahren sei. Der Zeuge hat jedoch nicht behauptet, dass Kaduk die ganze Zeit den Evakuierungsmarsch begleitet habe.
Er hat nach seiner glaubhaften Bekundung mit eigenen Augen gesehen, dass Kaduk Häftlinge, die nicht mehr weiter marschieren konnten und zurückgeblieben waren, erschossen hat. Der Zeuge ist in der letzten Kolonne marschiert. Er war nach seinen Angaben in guter körperlicher Verfassung. Das erscheint glaubhaft. Denn er war bis zur Evakuierung des Lagers im Installationskommando und bei verschiedenen Bauarbeiten eingesetzt. So hatte er die Möglichkeit, sich zusätzlich Lebensmittel zu besorgen, zumal er die Funktionen eines Unterkapos und Kommandoschreibers gehabt hat. Somit war der Zeuge in der Lage, die Vorgänge hinter der Marschkolonne gut zu beobachten. Der Zeuge hat mit Bestimmtheit ausgesagt, dass Kaduk mehr als zwei Häftlinge erschossen habe. Somit hat Kaduk mindestens drei Opfer getötet. Das Gericht hat keinen Zweifel, dass die Angaben des glaubwürdigen Zeugen der Wahrheit entsprechen.
Der Zeuge Dr. C., der Leiter der landwirtschaftlichen Betriebe in Auschwitz gewesen war und zuletzt (seit Januar 1944) den Rang eines Obersturmbannführers gehabt hatte, hat mit aller Bestimmtheit erklärt, dass es laut eines Befehls von Berlin verboten gewesen sei, Häftlinge auf dem Evakuierungsmarsch zu töten. Höss sei aus Berlin gekommen und er - der Zeuge - habe zu ihm gesagt, er solle sich endlich darum kümmern, dass die Häftlinge, die zurückblieben, lt. dem Befehl von Berlin nicht erschossen würden.
IV. Rechtliche Würdigung
1. Zu II.1.a. und b.
Die Tötung der arbeitsunfähigen und schwachen Häftlinge, die der Angeklagte Kaduk für den Gastod ausgesucht hatte, war Mord (§211 StGB). Denn sie erfolgte aus niedrigen Beweggründen. Die Häftlinge, die der besonderen Pflege und Fürsorge bedurft hätten, wurden beseitigt, weil sie als Arbeitskräfte ausfielen und daher nicht mehr nützlich erschienen. Sie galten als unnütze Esser und wurden als Belastung für das Lager angesehen. Irgendein anderer Grund für ihre Tötung bestand nicht. Sie wurden somit aus reinen Zweckmässigkeitsgründen und Nützlichkeitserwägungen getötet. Ein solches Motiv ist sittlich verachtenswert und steht auf tiefster Stufe. Ausserdem sind die Häftlinge auch grausam getötet worden. Die Opfer wussten auf Grund der Selektion, dass ihnen der Gastod bevorstand. Das hat ihnen während der Nacht und in den Stunden vor dem Tod, vor allem auch in der Gaskammer selbst, erhebliche seelische Qualen bereitet.
Der Angeklagte Kaduk hat durch die Auswahl der zu tötenden Opfer einen entscheidenden Tatbeitrag zu deren Tod geleistet. Das bedarf keiner näheren Begründung.
Er hat auch die Selektionen - wie das Schwurgericht zu seinen Gunsten angenommen hat - auf Befehl eines Vorgesetzten durchgeführt. Da er Angehöriger der Waffen-SS war, kommt §47 MStGB zur Anwendung. Der Angeklagte Kaduk hat erkannt, dass der gegebene Befehl ein allgemeines Verbrechen, nämlich die Tötung unschuldiger Menschen, bezweckte. Die Tötung unschuldiger Menschen aus dem angegebenen Motiv ist ein so krasser Verstoss gegen die auch dem primitivsten Menschen bewussten Grundsätze über das Recht eines jeden Menschen auf sein Leben, dass der Angeklagte Kaduk keine Zweifel daran haben konnte, dass die befohlenen Tötungen arbeitsunfähiger und schwacher Häftlinge verbrecherisch seien. Er hat diese Zweifel nach der Überzeugung des Gerichts auch nicht gehabt. Er selbst hat auch nie behauptet, dass er Zweifel an dem verbrecherischen Charakter dieser Vernichtungsaktionen gehabt habe.
Der Angeklagte Kaduk ist als Mittäter zu bestrafen. Er hat die Tötung der Opfer innerlich bejaht und zu seiner eigenen Sache gemacht, somit mit Täterwillen gehandelt. Wenn er auch die Selektionen auf Befehl durchgeführt hat, so hatte er im Falle 1.a. doch die letzte Entscheidung über Leben und Tod der an ihm vorbeimarschierenden Häftlinge. Er war es, der im Falle 1.a. die ihm als arbeitsuntauglich erscheinenden Häftlinge aussonderte und damit ihren Tod besiegelte. Niemand hatte ihm befohlen, bestimmte Häftlinge auszumustern. Ihm blieb vielmehr ein erheblicher Ermessensspielraum. Er beherrschte somit im wesentlichen das ganze Geschehen. Wenn er nun seinen Ermessensspielraum und seine Tatherrschaft dahin ausnutzte, um eine unbestimmte Vielzahl von Häftlingen auszumustern, so ist das bereits ein starkes Beweisanzeichen dafür, dass er mit Täterwillen gehandelt hat. Auch im Falle 1.b. hat er zusammen mit den anderen Rapportführern einen Ermessensspielraum und Tatherrschaft gehabt. Bei dem Aussuchen der Opfer war er nach den getroffenen Feststellungen besonders eifrig. Auch das ist ein Indiz über seinen Täterwillen in diesem Fall. Vor allem aber sprechen sein sonstiges Verhalten im KL Auschwitz gegenüber den Häftlingen, wie es eingangs geschildert worden ist, ferner die Tatsache, dass er den Häftlingen im Lager Furcht und Schrecken einflösste und bei diesen zu den gefürchtetsten SS-Männern zählte und schliesslich die unter II.2.-6. geschilderten Taten, die zeigen, dass der Angeklagte Kaduk bedenken- und hemmungslos Häftlinge aus nichtigen Anlässen tötete, was ihm - wie sich aus diesen Taten ergibt - offensichtlich Freude bereitete, eindeutig dafür, dass er in den Fällen 1.a. und b. aus Hass gegen die Häftlinge und aus innerer Freude an der Vernichtung von Menschenleben die Opfer ausgesucht und zum Tode bestimmt hat und die Tötung dieser Opfer als eigene Taten gewollt hat.
Dass der Angeklagte Kaduk auch vorsätzlich gehandelt hat, bedarf kaum einer näheren Begründung. Er hat den Tod der ausgesonderten Opfer bewusst gewollt und kannte nach den getroffenen Feststellungen die gesamten Umstände, die den Beweggrund für diese Tötungen als niedrig und die Art ihrer Tötung als grausam kennzeichnen. Dass er selbst auch das Bewusstsein gehabt hat, durch seine Tätigkeit bei den Selektionen einen kausalen Tatbeitrag für den Tod der Opfer zu leisten, liegt auf der Hand. Irgendwelche Rechtfertigungs- oder Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich. Die beiden festgestellten Aktionen, an denen Kaduk in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken mit anderen SS-Angehörigen mitgewirkt hat, sind jeweils als eine selbständige Handlung anzusehen, durch die jeweils mehrere Menschen getötet worden sind, da letztlich durch eine einzige Willensbetätigung, nämlich das Einwerfen des Zyklon B, eine Gruppe von Menschen gleichzeitig getötet worden ist.
Der Angeklagte Kaduk war daher wegen gemeinschaftlichen Mordes in zwei Fällen (§§47, 211, 74 StGB) jeweils begangen in gleichartiger Tateinheit (§73 StGB), einmal an mindestens zwei und im zweiten Fall an mindestens tausend Menschen zu zweimal lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen.
2. Zu II.2.
Die Tötung des Häftlings war Mord. Die Art, wie der Häftling von Kaduk und Clausen getötet worden ist, war grausam. Der Häftling hat vor seinem Tod durch die länger dauernden und wiederholten Misshandlungen und das Eintreten des Brustkorbes ohne Zweifel erhebliche körperliche Schmerzen erlitten. Kaduk und Clausen haben dem Häftling - wie die ganze Art der Behandlung des Häftlings zeigt - aus einer gefühllosen und unbarmherzigen Gesinnung heraus diese Schmerzen zugefügt und ihn aus dieser Gesinnung heraus zu Tode gebracht. Dem Häftling hat es darüberhinaus nach der Überzeugung des Gerichts erhebliche seelische Qualen bereitet, dass er auf diese entwürdigende Art und Weise umgebracht worden ist. Kaduk hat ausserdem aus Mordlust gehandelt. Ihm hat es unnatürliche Freude bereitet, ein Menschenleben zu vernichten. Das zeigt nicht nur dieser Fall, in dem er den Häftling aus nichtigem Anlass zusammen mit Clausen getötet hat, sondern es geht auch aus den unter II.4. - 6. geschilderten Fällen hervor. In allen diesen Fällen war kein Grund für die Handlungsweise des Angeklagten Kaduk gegeben. In den Fällen II.4. und II.6. fehlte jeder äussere Anlass für die Tötung der Häftlinge. Die herausgestellten sog. "Geiseln" waren völlig unschuldig. Sie hatten dem Angeklagten Kaduk nicht den geringsten, auch nicht einen scheinbaren, Anlass für eine Verärgerung gegeben. Auch der äussere Grund für ihre Absonderung als "Geiseln" und für ihre evtl. Erschiessung war weggefallen. Denn der fehlende Häftling war gefunden worden. Damit war sogar nach den in Auschwitz herrschenden Gepflogenheiten der Grund für ihre Geiselhaftung entfallen. Wenn Kaduk sie trotzdem getötet hat, so kann der Grund hierfür nach der Überzeugung des Gerichts nur darin liegen, dass es ihm unnatürliche Freude bereitet hat, Menschenleben zu vernichten.
Das gleiche gilt für die Tötung des Zigeuners, den der Angeklagte Kaduk ohne jeden äusseren Anlass erschossen hat.
Im Falle II.5. war zwar möglicherweise insofern, ein äusserer Anlass gegeben, als der Häftling wahrscheinlich den Angeklagten Kaduk unabsichtlich berührt hat. Dem Angeklagten Kaduk musste aber klar sein, und nach der Überzeugung des Gerichts wusste er auch genau, dass der Häftling ihn nur auf Grund der Schläge des Kurpanek unabsichtlich berührt haben konnte. Wenn er dies trotzdem als Anlass nahm, um den Häftling zu schlagen und zu misshandeln und schliesslich durch das "Mützewerfen" zu Tode zu bringen, so diente der scheinbare Grund nur als Vorwand, um seine niederen Instinkte beim Quälen eines Menschen zu befriedigen und sich durch die Tötung dieses Menschen eine unnatürliche Freude zu bereiten.
Der Angeklagte Kaduk wollte den Häftling - wie die gesamten Umstände der Tat zeigen - in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken mit dem Rapportführer Clausen töten. Dass er auch diese Umstände, die die Tat als grausam kennzeichnen, in sein Bewusstsein aufgenommen hat, versteht sich von selbst. Nicht erforderlich ist, dass er selbst die Art der Tötung als grausam gewertet hat.
Der Angeklagte Kaduk hat somit vorsätzlich in Kenntnis der gesamten Tatumstände, die die Tat als grausam kennzeichnen gehandelt.
Er war daher in diesem Falle wegen gemeinschaftlichen Mordes (§§47, 211 StGB) zu lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen.
3. Zu II.3.
Dieser Fall erfüllt ebenfalls den Tatbestand des Mordes. Der Tod des Häftlings ist infolge der Misshandlung durch den Angeklagten Kaduk eingetreten. Der Angeklagte Kaduk hat den Häftling grausam getötet. Der erschöpfte Häftling wurde zunächst durch das "Sportmachen" gequält. Dann bereitete ihm Kaduk durch die Schläge und Tritte mit den Stiefeln erhebliche Schmerzen während eines längeren Zeitraums. Der Häftling musste auf Grund dieser Behandlung bis zu seinem Tode, der nicht sofort eintrat, starke körperliche Schmerzen erdulden. Der erschöpfte und kranke Häftling hat auch seelische Qualen erleiden müssen. Denn die langdauernden und intensiven Misshandlungen durch den Angeklagten Kaduk mussten in ihm die Befürchtung hervorrufen, dass er zu Tode gebracht werden sollte, zumal in Auschwitz ein Menschenleben nichts galt. Er schwebte somit auch längere Zeit in Todesangst.
Auch hier kann nach der gesamten Sachlage kein Zweifel bestehen, dass Kaduk aus einer gefühllosen und unbarmherzigen Gesinnung heraus dem Häftling diese besonderen Schmerzen zugefügt und ihn zu Tode gebracht hat.
Der Angeklagte Kaduk hat mit bedingtem Vorsatz gehandelt. Denn nach den getroffenen Feststellungen hat er damit gerechnet, dass der Tod des Häftlings infolge der schweren Misshandlungen eintreten könnte und hat dies billigend in seinen Willen aufgenommen. Dies genügt.
Dass er auch die gesamten Umstände gekannt hat, die die Tötung als grausam kennzeichnen, liegt auf der Hand.
Der Angeklagte Kaduk war daher in diesem Falle wegen Mordes (§211 StGB) zu lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen.
4. Zu II.4.
Die Tötung eines jeden der drei Häftlinge war ebenfalls Mord. Der Angeklagte Kaduk hat alle drei Häftlinge bewusst und gewollt erschossen. Das Motiv für seine Tat war Mordlust. Hierzu kann auf die obigen Ausführungen unter IV.2. verwiesen werden. Dessen war sich der Angeklagte Kaduk nach der Überzeugung des Gerichts bewusst. Er hat somit vorsätzlich gehandelt.
Die Tötung eines jeden der drei Häftlinge ist als eine selbständige Handlung im Sinne des §74 StGB anzusehen. Denn jede Tötung erforderte eine besondere Willensbetätigung des Angeklagten Kaduk, die sich jeweils gegen das Leben eines Menschen richtete.
Der Angeklagte Kaduk war daher wegen der Erschiessung der drei Häftlinge wegen Mordes in drei Fällen (§§211, 74 StGB) zu dreimal lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen.
5. Zu II.5.
Auch dieser Fall erfüllt den Tatbestand des Mordes. Der Angeklagte Kaduk hat den Tod des Häftlings bewusst herbeigeführt. Nach den getroffenen Feststellungen wusste er, dass der Wachtposten den Häftling erschiessen würde, wenn der Häftling die verbotene Zone betreten würde. Er hat die Mütze geworfen, um dieses Ergebnis herbeizuführen.
Kaduk hat somit den Häftling zwar nicht selbst getötet, er hat aber den Wachtposten als Werkzeug benutzt und den Häftling als mittelbarer Täter getötet.
Die Tötung erfolgte heimtückisch; denn der Häftling war ahnungslos. Nach den getroffenen Feststellungen rechnete er beim Holen der Mütze nicht mit einem tödlichen Angriff. Er war somit auch wehrlos.
Der Angeklagte Kaduk hat diese Ahnungslosigkeit und Wehrlosigkeit bewusst ausgenutzt. Gleichzeitig hat er durch dieses Manöver gegenüber seinen Vorgesetzten und der Aussenwelt einen scheinbaren Rechtfertigungsgrund für die Tötung eines Häftlings geschaffen, da dieser durch das Überschreiten der Grenzlinie nach der Auslegung der SS einen "Fluchtversuch" unternommen hatte. Auch in diesem Fall hat der Angeklagte Kaduk nach der Überzeugung des Gerichts aus Mordlust gehandelt. Hierzu kann auf die Ausführung unter IV.2. verwiesen werden.
Da der Angeklagte Kaduk den Tod des Häftlings bewusst gewollt und auch die gesamten Umstände, die die Tat als heimtückisch kennzeichnen, gekannt hat und sich auch seines Motivs (unnatürliche Freude an der Tötung des Häftlings) nach der Überzeugung des Gerichts bewusst gewesen ist, hat er auch vorsätzlich gehandelt.
Irgendwelche Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe sind nicht ersichtlich.
Der Angeklagte Kaduk war daher in diesem Fall ebenfalls wegen Mordes (§211 StGB) zu lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen.
6. Zu II.6.
Die Tötung des Zigeuners erfüllt ebenfalls den Tatbestand des Mordes.
Der Angeklagte Kaduk hat den Zigeuner nicht nur zufällig getroffen. Aus der Tatsache, dass er Schüsse auf die Zigeuner abgegeben hat, ergibt sich, dass er einen Zigeuner tödlich treffen wollte. Er hat aus Mordlust gehandelt. Denn irgendein Anlass für die Tötung des Zigeuners bestand nicht. Ihm hat es unnatürliche Freude bereitet, aus irgendeiner Laune heraus das Leben des Zigeuners zu vernichten. Hierzu kann im übrigen auf die Ausführungen unter IV.2. verwiesen werden.
Da der Angeklagte Kaduk bewusst und gewollt den Zigeuner getötet und sich auch seines Motivs für die Tötung (Mordlust) bewusst gewesen ist, war er in diesem Fall wegen Mordes zu lebenslangem Zuchthaus (§211 StGB) zu verurteilen.
7. Zu II.7.
Die Tötung jedes der drei Häftlinge auf dem Evakuierungsmarsch erfüllt ebenfalls den Tatbestand des Mordes. Der Angeklagte Kaduk hat die drei Häftlinge bewusst und gewollt getötet. Der Beweggrund für diese Erschiessungen war niedrig im Sinne des §211 StGB. Denn die drei der besonderen Hilfe und Fürsorge bedürftigen erschöpften Häftlinge, die mit der Marschkolonne der anderen nicht mehr Schritt halten konnten, wurden von Kaduk - ebenso wie andere erschöpfte Häftlinge von anderen SS-Männern - nur deswegen getötet, weil die SS-Begleitmannschaft die Willkür- und Machtherrschaft über die auf dem Evakuierungsmarsch befindlichen Häftlinge aufrecht erhalten wollte. Denn entweder hätte man die zurückbleibenden Häftlinge ihrem Schicksal überlassen und sie somit freigeben müssen, so dass sie die Chance gehabt hätten, von hilfsbereiten Menschen gerettet zu werden, oder man hätte immer mehr SS-Posten für die erschöpften Menschen abstellen müssen, da nicht genügend Fahrzeuge vorhanden waren, um sie mitnehmen zu können, so dass die Bewachung der noch marschfähigen Häftlinge immer schwächer geworden wäre mit der Gefahr, dass sie ihre Bewacher hätten überwältigen oder zumindestens leichter hätten fliehen können. Um dies zu verhindern, wurden die nicht mehr marschfähigen Häftlinge einfach erschossen. Nach der gesamten Sachlage war sich dessen der Angeklagte nach der Überzeugung des Gerichts auch bewusst. Das angegebene Motiv für die Tötung der erschöpften Häftlinge steht auf tiefster sittlicher Stufe und ist als verachtenswert anzusehen.
Die Tötung eines jeden der drei Häftlinge ist als eine selbständige Handlung im Sinne des §74 StGB anzusehen, da Kaduk jeden der drei Menschen durch besondere Willensbetätigungen nacheinander getötet hat.
Da der Angeklagte Kaduk die drei Häftlinge bewusst und gewollt erschossen hat und sich auch des Beweggrundes für die Tötungen bewusst gewesen ist, hat er auch vorsätzlich gehandelt. Er hat auch das Bewusstsein gehabt, Unrecht zu tun. Abgesehen davon, dass es jedem - auch dem primitivsten Menschen - klar sein muss und auch klar ist, dass die Tötung unschuldiger, erschöpfter Menschen, nur um sie loszuwerden, weil sie als Belastung empfunden werden, ein Verbrechen ist, war die Tötung von Häftlingen auf dem Evakuierungsmarsch durch Befehl von Berlin ausdrücklich verboten worden, was auch dem Angeklagten Kaduk nicht verborgen geblieben sein kann. Der Angeklagte hat somit bewusst gegen den Befehl der höheren SS-Führung verstossen und sich somit auch nach der Rechtsauffassung der SS-Führung strafbar gemacht.
Der Angeklagte Kaduk war daher wegen der Erschiessung der drei Häftlinge auf dem Evakuierungsmarsch wegen Mordes in drei Fällen (§§211, 74 StGB) zu dreimal lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen.
K. Die Straftaten des Angeklagten Baretzki
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Baretzki
Der Angeklagte Baretzki wurde am 24.3.1919 als Sohn eines Telefonmechanikers in Czernowitz/Rumänien geboren. Er hat noch eine Schwester und zwei Brüder. Der Vater starb im Jahre 1938. Über das Schicksal der übrigen Familienmitglieder nach Kriegsende ist dem Angeklagten Baretzki angeblich nichts bekannt. Während dieses Verfahrens hat er Kontakt mit einem Bruder aufgenommen.
Baretzki besuchte in Czernowitz 6 Jahre lang die Volksschule. Nach der Schulentlassung wollte der Angeklagte Wasserinstallateur werden. Der Vater erlaubte dies jedoch nicht. Der Angeklagte begann zunächst eine Friseurlehre, gab diese jedoch nach einer Woche wieder auf. Dann lernte er 2 1/2 Jahre lang als Nagelrichter und Strumpfwirker. Nach bestandener Prüfung arbeitete er bis zum Kriegsbeginn als Maschinenführer. Im November 1940 wurde er mit seiner Schwester nach Oberschlesien umgesiedelt. Er war in verschiedenen Umsiedlungslagern. Zuletzt arbeitete er bei einer Speditionsfirma, die im Auftrag der Reichsbahn tätig war. Der Angeklagte hatte bereits in Rumänien eine militärische Ausbildung gehabt und war zum Korporal ernannt worden. Im Frühjahr 1942 wurde er zusammen mit anderen Volksdeutschen aus Rumänien und Ungarn zur Waffen-SS nach Auschwitz eingezogen. Er kam zunächst als Wachmann zum Wachsturmbann. Dann wurde er Läufer im Lager und gehörte damit zur Kommandantur. Schliesslich wurde er als Blockführer in das Lager Birkenau versetzt. Dort blieb er bis zur Auflösung des Lagers im Januar 1945. Sein Dienstgrad in Auschwitz was SS-Sturmmann.
Nach der Evakuierung des Lagers kam der Angeklagte zur SS-Division "30.Januar", mit der er in der Gegend von Frankfurt/Oder an der Front eingesetzt wurde. Am 20.4.1945 wurde er zum SS-Rottenführer befördert. Am 25.4.1945 wurde er verwundet und kam in ein Lazarett. Gegen Kriegsende (6.5.1945) geriet er in sowjetische Kriegsgefangenschaft, wurde aber bereits am 17.8.1945 aus der Gefangenschaft nach Berlin entlassen. Er begab sich nach Plaidt. Dort arbeitete er bei verschiedenen Firmen der Kohlen- und Bimsbranche. Zuletzt war er bis zu seiner Verhaftung bei der Firma Marci, Kohlen- und Bimshandlung, als Arbeiter beschäftigt. Sein Tagesverdienst betrug bis zu 35.- DM.
Der Angeklagte ist ledig.
Er ist durch Urteil des Schöffengerichts in Mayen (7 Ms 50/55) vom 27.4.1955 wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt - Vergehen gegen §113 StGB - zu einer Geldstrafe von 75.- DM verurteilt worden. Am 27.6.1956 wurde er wegen gefährlicher Körperverletzung - Vergehen gegen §223a StGB - durch Urteil des Schöffengerichts in Mayen (2 Ds 97/56) zu einer Geldstrafe von 300.- DM verurteilt.
In dieser Sache befindet sich der Angeklagte seit dem 12.4.1960 in Untersuchungshaft.
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Mitwirkung des Angeklagten Baretzki an der Massentötung jüdischer Menschen in Auschwitz (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
Der Angeklagte Baretzki hat als Blockführer im Lager Birkenau bei der massenweisen Tötung der sog. RSHA-Juden (vgl. oben 2. Abschnitt VII.5.; 3. Abschnitt A.II.) mitgewirkt.
Er war etwa im August 1943 in das Lager B II e in Birkenau versetzt und dort als Blockführer eingesetzt worden. Wie alle anderen Blockführer wurde er ebenfalls zum sog. "Rampendienst" eingeteilt. Seine Aufgabe war, das Häftlingskommando (Kanada-Kommando) auf die Rampe zu führen, wenn ein RSHA-Transport angekündigt und der Einsatz der zum Rampendienst eingeteilten SS-Angehörigen befohlen war. Der Angeklagte Baretzki führte in einer unbestimmten Anzahl von Fällen das Kanada-Kommando zur Rampe, wenn RSHA-Transporte angekommen waren. Das Kommando übergab er einem SS-Angehörigen der Abteilung der Verwaltung, die für die Effekten der angekommenen Menschen zuständig war. Danach half er beim Aufstellen und der Einteilung der aus den Eisenbahnwaggons ausgestiegenen Menschen. Er sorgte in Zusammenarbeit mit anderen SS-Männern dafür, dass die Frauen mit Kindern unter 16 Jahren, alte Menschen, Krüppel, Kranke und Kinder unter 16 Jahren sofort getrennt von den anderen Männern und Frauen Aufstellung nahmen, da sie nicht mehr auf ihre Arbeitstauglichkeit geprüft, sondern ohne Selektion in die Gaskammern gebracht wurden. Meist hatte er einen Stock in der Hand, mit dem er gelegentlich auf Menschen einschlug, wenn sie seinen Anweisungen nicht nachkamen oder - nach seiner Meinung - keine Ordnung hielten.
Nach den Selektionen durch die Ärzte führte der Angeklagte Baretzki wiederholt zusammen mit anderen SS-Männern die für den Gastod bestimmten Menschen zu den Gaskammern.
Wie oft der Angeklagte Baretzki auf diese Weise Rampendienst versehen hat, konnte nicht festgestellt werden. Er war mit Sicherheit mindestens fünfmal zum Rampendienst eingeteilt. Er hat sich mindestens fünfmal in der geschilderten Weise nach der Ankunft von RSHA-Transporten betätigt.
Die Anzahl der aus diesen fünf verschiedenen RSHA-Transporten getöteten Menschen betrug mindestens je 1000, insgesamt also 5000.
Der Angeklagte Baretzki wusste, dass die jüdischen Menschen nur wegen ihrer Abstammung als Angehörige einer sog. "minderwertigen Rasse" ohne Gerichtsurteile unschuldig getötet wurden. Ihm war auch bekannt, dass diese Vernichtungsaktionen unter strengster Geheimhaltung und unter der Verwendung von Tarnbezeichnungen erfolgten und dass die deportierten Juden nichts von ihrem bevorstehenden Tode ahnten und bis zuletzt über ihr Schicksal getäuscht wurden. Er wusste auch, auf welche Weise sie in den Gaskammern umgebracht wurden. Ihm war ferner klar, dass er selbst ein Glied in dem Vernichtungsapparat war und die Vernichtungsaktionen durch seine - oben geschilderten - Tätigkeiten förderte.
2. Die Mitwirkung des Angeklagten Baretzki bei den sog. Lagerselektionen (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
Der Angeklagte Baretzki nahm als Blockführer in einer unbestimmten Anzahl von Fällen auch an sog. Lagerselektionen (vgl. oben 2. Abschnitt VII.4.) im Lager Birkenau teil. So fand z.B. am 15.4.1944 im Quarantänelager (B II a) eine Lagerselektion statt, die durch den Lagerarzt Dr. Thilo durchgeführt wurde. Bei dieser Selektion wurden durch Dr. Thilo schwache und arbeitsunfähige Häftlinge für den Gastod ausgesucht. Der Angeklagte Baretzki war bei dieser Selektion anwesend. Er hatte zuvor unter der Leitung seiner SS-Vorgesetzten zusammen mit anderen Blockführern die Häftlinge des Quarantänelagers antreten lassen. Nach der Selektion wurden die ausgesonderten Häftlinge in einen besonderen Block eingesperrt. Sie bekamen zwei Tage nichts zu essen. Dann kamen LKWs, mit denen sie zur Vergasung weggebracht werden sollten. Die Häftlinge wussten, was ihnen bevorstand. Sie verliessen aber nicht den Block, als die LKWs vorgefahren waren. Manche waren auch schon so schwach, dass sie nicht mehr laufen konnten. Da trieben die Blockführer, unter denen sich auch der Angeklagte Baretzki befand, die Menschen mit Stockhieben auf die LKWs. Baretzki und ein anderer SS-Mann namens Dragelis schrien die Opfer an und riefen ständig, indem sie auf sie einschlugen: "Geh! Geh! Geh!". Einige Häftlinge liefen in ihrer Todesangst weg. Dragelis und Baretzki schossen hinter ihnen her. Dabei wurde mindestens ein Häftling tödlich getroffen. Die anderen wurden auf die LKWs getrieben und anschliessend zur Gaskammer gefahren, wo sie durch Zyklon B getötet wurden. Es waren mindestens 50 Menschen.
Der Angeklagte Baretzki hat noch an weiteren Lagerselektionen teilgenommen. Dabei hat er jeweils mit anderen SS-Angehörigen die Häftlinge antreten lassen. Wenn der Lagerarzt die schwachen und arbeitsunfähigen Häftlinge aussonderte, machte er wiederholt den Arzt auf bestimmte Häftlinge, die nach seiner Meinung für den Gastod "reif" waren, aufmerksam. Die vom Arzt ausgesonderten Häftlinge stellte er dann mit anderen SS-Männern gesondert auf und achtete darauf, dass sie nicht mehr zur Gruppe der anderen zurückschlichen und so ihrem Tode entgingen.
Beim Verladen der Opfer auf die LKWs, die die ausgesonderten Häftlinge zu den Gaskammern bringen sollten, half er ebenfalls mit. Wenn Häftlinge nicht freiwillig auf die LKWs stiegen, trieb er sie mit Gewalt hinauf. Er hat - ausser dem bereits geschilderten Fall - noch in mindestens weiteren vier Fällen auf diese Weise an Lagerselektionen mitgewirkt. Auch in diesen vier Fällen wurden jeweils mindestens 50 Menschen für den Gastod ausgesucht und anschliessend in einer der Gaskammern durch Zyklon B getötet.
Der Angeklagte Baretzki wusste, dass die ausgemusterten Häftlinge unschuldig nur deswegen durch Gas getötet werden sollten, weil sie nicht mehr arbeitsfähig erschienen und damit - nach Auffassung der SS - als überflüssige Esser nur eine Belastung für das Lager bedeuteten. Ihm war auch klar, dass er durch die geschilderten Handlungen bei den Selektionen und dem Abtransport der ausgesonderten Häftlinge die Vernichtungsaktionen förderte. Er wusste ferner, dass die ausgesonderten Häftlinge nach ihrem Abtransport in einer der Gaskammern durch Zyklon B getötet wurden.
3. Die Tötung des Häftlings Lischka durch den Angeklagten Baretzki (Eröffnungsbeschluss Ziffer 6)
Am 19.4.1944 befand sich der Angeklagte Baretzki im Quarantänelager (B II a). Als er auf der Lagerstrasse ging, begegnete ihm ein Häftling namens Lischka. Dieser war ein sog. "Muselmann". Er bestand nur aus Haut und Knochen. Seine Bewegungen waren langsam. Plötzlich schlug Baretzki mit einem Knüppel auf Lischka ein. Er führte die Schläge nicht gegen einen bestimmten Körperteil des Häftlings, sondern schlug Lischka wahllos mit voller Wucht, wohin er ihn gerade traf. Der Häftling erhielt auch einige Schläge in die Nierengegend. Die Nieren wurden hierdurch verletzt. Sie bluteten. Das Blut wurde durch den Urin ausgeschieden. Der Häftling konnte sich nicht mehr aufrecht halten. Er musste in den HKB eingeliefert werden. Dort verstarb er am gleichen oder nächsten Tag an den Folgen der durch die Schläge erlittenen Verletzungen. Der Angeklagte Baretzki hat beim Schlagen des Häftlings damit gerechnet, dass dieser infolge der Misshandlungen sterben könnte. Das nahm er bewusst billigend in Kauf.
Warum der Angeklagte Baretzki den Häftling Lischka geschlagen hat, konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Wahrscheinlich hat er Anstoss daran genommen, dass sich der Häftling nur langsam bewegte und möglicherweise ihn nicht schnell genug durch Abnehmen der Mütze gegrüsst hat.
4. Die Beteiligung des Angeklagten Baretzki an der Vernichtung der im sog. Theresienstädter Lager (B II b) untergebrachten jüdischen Häftlinge im März 1944 (Eröffnungsbeschluss Ziffer 9)
Am 6. und 7.9.1943 wurden 5700 jüdische Menschen (Männer, Frauen und Kinder) aus dem KL Theresienstadt in das KL Auschwitz transportiert. Sie wurden im Lagerabschnitt B II b familienweise untergebracht.
Am 20.12.1943 kamen zwei weitere Transporte aus dem KL Theresienstadt nach Auschwitz mit insgesamt rund 5000 Menschen, die ebenfalls im Lagerabschnitt B II b untergebracht wurden. Die Juden waren im Ungewissen darüber, was mit ihnen geschehen solle. Viele glaubten, sie kämen mit dem Leben davon, weil sie nicht - wie die RSHA-Transporte, von denen sie alsbald erfuhren - unmittelbar nach der Ankunft in Auschwitz getötet worden waren.
Von der NS-Führung wurde jedoch zu einem nicht mehr festzustellenden Zeitpunkt beschlossen, die jüdischen Menschen ein halbes Jahr nach der Ankunft zu "liquidieren". Anfang März 1944 sickerte bei den Häftlingen durch, dass für die Juden im Theresienstädter Lager "SB" (Sonderbehandlung d.h. "Liquidierung") vorgesehen sei. Die Insassen des Theresienstädter Lagers wurden daher gewarnt. Eine Gruppe entschlossener Juden beschloss, sich gegen eine "Liquidierung" zu wehren und einen Aufstand zu wagen. Man besorgte sich Benzin, um für den Fall eines Abtransportes die Strohsäcke in den Baracken und diese selbst anzünden zu können.
Einige Tage vor der beschlossenen "Liquidierung" der ersten Transporte (vom 6. und 7.9.1943) erklärte der Lagerführer Schwarzhuber den jüdischen Menschen im Theresienstädter Lager, dass die ersten Transporte in ein neues Lager namens Heidebrock gebracht werden sollten. Am 6.3.1944 mussten die Insassen des Theresienstädter Lagers Karten an ihre Verwandten schreiben. Als Datum mussten sie den 25.3.1944 auf die Karten setzen. Die Karten wurden nach diesem Zeitpunkt auch abgeschickt. Am 7.3.1944 wurden alle Juden aus den ersten (September) Transporten anhand von Listen, die in der Schreibstube aufgestellt worden waren, aufgerufen. Der Angeklagte Boger kontrollierte anhand der Liste, dass alle Häftlinge der Septembertransporte antraten. Sie sollten alle, so wurde ihnen vom Lagerführer Schwarzhuber erneut versichert, in das Lager Heidebrock kommen. Auch die Blockführer, die beim Aufruf und dem Antreten der Menschen dabei waren, erklärten das gleiche. Die kranken jüdischen Menschen machten nun geltend, dass sie nicht arbeiten könnten. Der Lagerarzt Dr. Mengele erklärte ihnen daraufhin, sie könnten zurückbleiben, nach ihrer Genesung könnten sie ja nach Heidebrock nachkommen. Die Kranken und einige Kinder durften daraufhin in den mittleren Blocks des Theresienstädter Lagers zurückbleiben. Die übrigen jüdischen Menschen aus den ersten Septembertransporten - es waren noch mindestens 3000 - wurden dann aus dem Lager hinausgeführt. Man sagte ihnen, sie würden zunächst in der Sauna gebadet. Als sie in Richtung der neu gebauten Krematorien III und IV geführt wurden, glaubten viele, dass sie tatsächlich gebadet würden. Andere wieder, die von der beschlossenen "Sonderbehandlung" gehört hatten und insbesondere die Häftlinge, die schon länger im Lager waren und nicht zu den Theresienstädtertransporten gehörten, warnten jedoch vor einer "Liquidierung". Als die gesunden jüdischen Menschen dann aber tatsächlich in der Sauna gebadet und anschliessend in das Quarantänelager (B II a) geführt wurden, glaubten die meisten nicht mehr an eine "Liquidierung".
Am 8.3.1944 kamen gegen Abend einige SS-Männer in das Theresienstädter Lager und riefen die Namen und Nummern einiger zurückgebliebener Kranker aus den ersten Septembertransporten auf und führten diese in das Quarantänelager zu den anderen Juden. Gegen 20 Uhr wurde für das Theresienstädter Lager Lagersperre angeordnet. Die restlichen Insassen des Lagers durften ihre Blocks nicht mehr verlassen. Etwa um die gleiche Zeit fuhren LKWs in das Quarantänelager hinein. Ferner kam eine grosse Anzahl von SS-Führern, Unterführern und Männern, sowie Kapos und Blockältesten zum Quarantänelager. Der Angeklagte Baretzki war auch unter ihnen. Den jüdischen Menschen im Quarantänelager wurde nun befohlen, die LKWs zu besteigen. Viele kamen dieser Aufforderung auch ohne weiteres nach. Andere jedoch, die misstrauisch waren und befürchteten, sie könnten in das Gas gebracht werden, weigerten sich, die LKWs zu besteigen. Einige wurden auch von einem Blockältesten namens Bondi vor der bevorstehenden "Liquidierung" gewarnt. Bondi forderte sie auf, die LKWs nicht zu besteigen. Alle, die nicht freiwillig auf die LKWs gingen, wurden von den SS-Männern, den Kapos und Blockältesten - ausser Bondi - mit Gewalt auf die LKWs getrieben.
Der Angeklagte Baretzki half beim Antreten der jüdischen Menschen vor den LKWs mit. Er stellte zusammen mit anderen SS-Männern die einzelnen Menschengruppen für die LKWs zusammen. Wenn sich jüdische Häftlinge weigerten, auf die LKWs zu steigen, bedrohte er sie mit der Pistole und zwang sie so mit Gewalt, aufzusteigen. Anschliessend wurden die LKWs mit den jüdischen Menschen in Richtung der Rampe im Lager Birkenau gefahren. Man wollte damit den Zurückbleibenden vortäuschen, dass die auf den LKWs befindlichen Menschen auf Transport kämen. In Wirklichkeit fuhren die LKWs dann aber weiter zu den Gaskammern. Alle auf den LKWs befindlichen Menschen wurden dann in eine oder in mehrere Gaskammern geführt und dort durch Zyklon B getötet. Es waren mindestens 3000.
Der Angeklagte Baretzki, der auf Befehl seiner Vorgesetzten beim Abtransport der Juden mithalf, wusste, dass sie nur deswegen getötet werden sollten, weil sie Juden waren. Ihm war auch bekannt, dass sie nach dem Abtransport durch Zyklon B getötet wurden. Ihm war klar, dass er durch seine geschilderte Tätigkeit beim Abtransport der Opfer die Vernichtungsaktion förderte.
5. Die Ertränkung von vier Häftlingen durch den Angeklagten Baretzki in einem Feuerlöschteich (Nachtragsanklage)
Im Lager Birkenau bestand ein sog. "Kommando Zerlegerbetriebe". Zu ihm gehörten ca. 1300 Häftlinge, unter denen 200 russische Kriegsgefangene waren. Aufgabe des Kommandos war es, Flugzeugwracks zu zerlegen.
Im Sommer 1944 - der genaue Zeitpunkt konnte nicht festgestellt werden, es war jedenfalls nach dem 21.6.1944 - versteckte sich eines Tages ein russischer Kriegsgefangener dieses Kommandos während der Arbeit. Er schlief in seinem Versteck ein. Während der Mittagszeit musste sich das ganze Kommando auf einem Platz versammeln. Dabei wurde das Fehlen des russischen Kriegsgefangenen entdeckt. Während die Kapos den fehlenden Häftling suchten, wurde der russische Kriegsgefangene wach und lief zu den auf dem Platz angetretenen Häftlingen hin. Dort wurde er von drei Kapos in Empfang genommen, mit Stöcken geschlagen und zu Boden geworfen. Während die Kapos noch schlugen, fingen die russischen Kriegsgefangenen an zu schreien. Der Kommandoführer schlug daraufhin zusammen mit anderen Kapos auf die Kriegsgefangenen ein. Zur Begründung gab man an, dass die Kriegsgefangenen einen Aufstand gemacht hätten. Danach war die Sache erledigt und die Häftlinge gingen wieder zur Arbeit.
Nach Beendigung der Arbeitszeit wurden die Häftlinge - wie immer - zum Lagerabschnitt B II d zurückgeführt. Wegen des Vorfalls am Mittag wurden jedoch nicht alle in das Lager und ihre Blocks entlassen. Ein Teil musste zur Strafe bei der Küchenbaracke, die sich - vom Eingang des Lagers aus gesehen - vor den Blockreihen auf einem freien Platz befand, antreten und dort in strammer Haltung mehrere Stunden stehen. SS-Männer führten die Aufsicht und achteten darauf, dass die Häftlinge sich nicht bewegten. Auch der Angeklagte Baretzki gehörte zu dem Aufsichtspersonal. Nach etwa 2 Stunden konnten einige Häftlinge nicht mehr stehen. Sie setzten sich in Hockstellung, um sich etwas auszuruhen. Da schlugen der Angeklagte Baretzki und andere SS-Männer auf diese Häftlinge ein. Baretzki trieb dann einige Häftlinge zu einem in der Nähe befindlichen Feuerlöschteich und warf sie hinein. Der Teich befand sich in einem mit Beton ausgegossenen rechteckigen Bassin, das schräge Wände hatte. Die Häftlinge versuchten nun schwimmend aus dem Wasser herauszukommen. Sie krochen an den Wänden des Bassins hoch. Baretzki, der am Rande des Bassins stand, stiess sie jedoch einmal mit den Füssen zurück, wenn sie hochkamen, so dass sie wieder ins Wasser zurückfielen. Wenn sich die Häftlinge mit ihren Händen am Rande des Bassins festklammerten, trat Baretzki sie mit den Füssen auf die Hände, so dass sie vor Schmerzen den Beckenrand losliessen. Die Häftlinge schwammen längere Zeit im Wasser umher und versuchten immer wieder, herauszukommen. Doch jedesmal wurden sie von Baretzki zurückgestossen. Auch andere SS-Männer warfen die Häftlinge in das Wasser. Auch sie verhinderten auf die gleiche Weise, dass die Häftlinge herauskommen konnten. Die Kräfte der im Wasser herumschwimmenden Häftlinge erlahmten schliesslich. Die Häftlinge gingen unter und ertranken. Baretzki hat mindestens vier Häftlinge in das Wasser geworfen und hat bei ihnen verhindert, dass sie herauskommen konnten. Alle vier sind ertrunken.
Die Lagerfeuerwehr holte später die Leichen mit Haken aus dem Feuerlöschteich heraus.
6. Weitere Taten des Angeklagten Baretzki, die nicht angeklagt und nicht im Eröffnungsbeschluss enthalten sind
a. Der Angeklagte Baretzki liebte es, die Häftlinge, die aus dem Lagerabschnitt B II d zum Frauenlager jenseits der neuen Rampe hinüberwinkten - was verboten war -, mit "Sport" zu bestrafen (vgl. oben 2. Abschnitt V.8.). Oft machte er mit Häftlingen, die er beim Winken erwischte, "Sport", indem er sie in schnellem Tempo niederwerfen, aufstehen, hüpfen, laufen, wieder hinwerfen usw. liess, bis sie vor Erschöpfung zusammenbrachen. Wenn Häftlinge nach einem solchen "Sport" am Boden lagen, trampelte er auf ihnen herum und schrie sie an, sie sollten aufstehen. Wenn sie dann nicht dieser Aufforderung nachkamen, zog er seine Pistole und erschoss sie. Auf diese Weise hatte Baretzki mindestens fünf Häftlinge getötet.
b. Im Jahre 1944 durchsuchte der Angeklagte Baretzki eines Tages ein Häftlingskommando, das gerade von der Arbeit zurückgekehrt war. Bei einem Juden fand er ein paar Päckchen Zigaretten. Er nahm dem Juden die Zigaretten ab und rief: "Deinetwegen ist Krieg, durch Dich bin ich im Lager." Er warf die Zigaretten unter die anderen Häftlinge, wobei er ihnen zurief, sie sollten sich das nehmen. Den Juden schlug er bis zur Bewusstlosigkeit zusammen. Zum Appell wurde der jüdische Häftling bewusstlos bei seinem Block niedergelegt. Nach dem Appell wurde er von Kameraden in die Baracke getragen. Dort starb er an einem der nächsten Tage.
c. Ende Juni 1944 wurde eines Morgens nach dem Ausrücken der Arbeitskommandos eine Suchaktion nach versteckten Häftlingen, die im Sprachgebrauch der SS "Arbeitsscheue" genannt wurden, befohlen. Alle Häftlinge, die in den Baracken gefunden wurden, mussten auf einem bestimmten Platz antreten. Einen Häftling fand man auf der Latrine. Er wurde vom Blockältesten zu einer Gruppe von zwei bis drei SS-Männern gebracht, unter denen sich auch der Angeklagte Baretzki befand. Baretzki schlug dem Häftling mit einem Stock, den er meist bei sich hatte, mit voller Wucht auf den kahlen Kopf. Der Häftling brach zusammen und blieb liegen. Blut floss ihm vom Kopf herunter. Als der Häftling wieder zu sich kam und sich wieder etwas erholt hatte, sollte er 50 Stockschläge erhalten. Er musste selbst zählen. Nach einigen Schlägen, die er von namentlich nicht bekannten SS-Männern erhielt, wurde er jedoch wieder bewusstlos. Man liess ihn liegen. Später starb er.
d. Im Jahre 1944, der genaue Zeitpunkt konnte nicht festgestellt werden, begegnete eines Tages ein Häftling dem Angeklagten Baretzki auf der Lagerstrasse und zwar in der Nähe des Lebensmittelmagazins. Baretzki rief den Häftling zu sich und gab ihm eine Ohrfeige. Der Grund hierfür ist nicht bekannt. Der Häftling wollte sein Gesicht vor der Misshandlung mit seinen Händen schützen, indem er sie vor das Gesicht hielt. Baretzki sagte daraufhin zu ihm: "Was, Du willst einen SS-Mann schlagen?" Er schlug weiter auf den Häftling ein, bis Blut floss und der Häftling hinfiel. Dann trat der Angeklagte Baretzki auf den liegenden Häftling ein. Schliesslich legte er ihm einen Schaufelstiel auf den Hals und stellte sich auf die beiden Enden des Stiels, bis der Häftling tot war.
III. Einlassung des Angeklagten Baretzki, Beweismittel, Beweiswürdigung
1.
Die Feststellungen zum Lebenslauf des Angeklagten Baretzki beruhen auf seiner eigenen Einlassung.
2. Zu II.1.
Der Angeklagte Baretzki hat eingeräumt, als Blockführer zum Rampendienst eingeteilt worden zu sein. Er hat sich jedoch dahin eingelassen, dass er nur das Kanada-Kommando auf die Rampe geführt habe. Dort habe er es sofort einem Angehörigen der Abteilung Verwaltung (Effektenkammer) übergeben. Damit sei sein Dienst beendet gewesen. Mit den Vernichtungsaktionen habe er nichts zu tun gehabt. Insbesondere habe er die jüdischen Menschen nicht zu den Gaskammern begleitet. Wenn er nach der Übergabe des Häftlingskommandos noch länger auf der Rampe geblieben sei, dann nur deswegen, weil er sich Zigaretten und Lebensmittel "organisiert" habe. Nach den Selektionen habe er in der Regel auf Befehl des Arbeitsdienstführers die arbeitsfähigen Häftlinge zur Aufnahme in das Lager Kanada geführt. Dabei sei er auch an den Gaskammern vorbeigekommen. Diese Einlassung des Angeklagten Baretzki ist schon an sich unglaubhaft. Denn es gehörte zu den Aufgaben der Blockführer, die angekommenen jüdischen Menschen nach dem Aussteigen aus den Eisenbahnwaggons aufzustellen und schon vor der eigentlichen Selektion durch die Ärzte die Menschen nach bestimmten Gesichtspunkten zu trennen (vgl. oben A.II.).
Seine Einlassung ist aber auch durch die Beweisaufnahme widerlegt worden. Der Angeklagte Baretzki ist durch die Aussage einiger Zeugen überführt worden, in der oben geschilderten Weise an den Vernichtungsaktionen mitgewirkt zu haben.
So hat der Zeuge Dow K. glaubhaft bekundet, dass er im Frühjahr 1944 und im Juli und August 1944 den Angeklagten Baretzki wiederholt auf der Rampe in Birkenau gesehen habe, wenn er die angekommenen Menschen eingeteilt habe. Damals sei Hochbetrieb auf der Rampe gewesen. Baretzki habe einige Male einen Stock in der Hand gehabt. Der Zeuge Dow K. ist glaubwürdig. Er kannte den Angeklagten Baretzki bereits im Lager B II b, weil Baretzki als Blockführer öfters in dieses Lager B II b hineingekommen ist. Später hat der Zeuge den Angeklagten Baretzki im Lager B II d fast täglich gesehen. Der Zeuge kam nach der Vernichtung der ersten Theresienstädtertransporte (nach dem 8./9.3.1944) in den Lagerabschnitt B II d, wo Baretzki als Blockführer tätig war. Der intelligente Zeuge, der jetzt als wissenschaftlicher Assistent an der Universität in Jerusalem tätig ist, war damals erst 11 Jahre alt. Er hat alles mit wachen Augen beobachtet. In der Nähe der Rampe - nur durch den Drahtzaun getrennt - war im Lager B II d ein Kinderspielplatz. Von hier aus hat der Zeuge seine Beobachtungen gemacht und den Angeklagten Baretzki gesehen.
Die Aussage des Zeugen Dow K. wird durch die Aussage des Zeugen Erich K. bestätigt. Der bereits mehrfach erwähnte Zeuge Erich K. arbeitete - wie ebenfalls schon ausgeführt - als Schlosser in der Schlosserwerkstatt. Diese lag in unmittelbarer Nähe der Rampe in Birkenau. Der Zeuge konnte sich als Schlosser frei in den verschiedenen Lagerabschnitten, auch im FKL bewegen. Er hatte somit Gelegenheit, die Vorgänge auf der Rampe zu beobachten. Nach seiner glaubhaften Aussage hat er den Angeklagten Baretzki, den er gut kannte, wiederholt dabei beobachtet, wenn er beim Aufstellen und Einteilen der angekommenen jüdischen Menschen mithalf.
Schliesslich hat auch der Zeuge Bac. den Angeklagten Baretzki beim Rampendienst beobachtet. Dieser Zeuge war damals 15 Jahre alt. Er war im Dezember 1943 mit einem Transport jüdischer Menschen aus dem KL Theresienstadt nach Auschwitz gekommen und in dem Lagerabschnitt B II b untergebracht worden. Bei der Vernichtung dieser Transporte im Juli 1944 war er mit dem Leben davongekommen. Er war dann in den Lagerabschnitt B II d überführt worden. Hier lernte er den Angeklagten Baretzki als Blockführer kennen. Der Zeuge hat persönlich nur gute Erfahrungen mit dem Angeklagten Baretzki gemacht. Baretzki sei - so hat er erklärt - zu den Kindern sehr milde gewesen. Er habe mit ihnen sogar Ping-Pong und Fussball gespielt. Einmal habe er ihnen sogar Zahnbürsten besorgt. An Weihnachten 1944 habe Baretzki neun Jugendlichen, darunter auch ihm, je ein Stück Wurst geschenkt. Der Zeuge hat somit keinen Anlass, den Angeklagten Baretzki zu Unrecht zu belasten. Irgendwelche Hass- oder Rachegefühle scheiden aus. Seine Aussage verdient daher vollen Glauben. Der Zeuge hat einmal beobachtet, wie der Angeklagte Baretzki während seines Rampendienstes einem Häftling eine Flasche auf den Kopf schlug, so dass dieser zusammenbrach. Auch das spricht dafür, dass Baretzki nicht nur das Häftlingskommando zur Rampe geführt, sondern während der Vernichtungsaktion auch weitere Funktionen gehabt hat.
Die Feststellung, dass der Angeklagte Baretzki die für den Tod bestimmten jüdischen Menschen zusammen mit anderen SS-Männern zu den Gaskammern geführt hat, beruht auf den glaubhaften Aussagen der Zeugen Mir., Erich K. und der Zeugin Pal. Der Zeuge Mir. hat wiederholt persönlich gesehen, wie der Angeklagte Baretzki jüdische Menschen aus RSHA-Transporten zu den Krematorien geführt hat. Der Zeuge konnte sich noch erinnern, dass Baretzki meist, wenn er von den Gaskammern zurückkam, betrunken gewesen ist. Dann sei er, so hat der Zeuge ausgesagt, besonders gefährlich gewesen. Auch dieser Zeuge kannte den Angeklagten Baretzki, weil er in dem Lagerabschnitt B II d untergebracht war.
Die Zeugin Pal. hat von dem FKL aus beobachtet, wie der Angeklagte Baretzki RSHA-Transporte zu den Krematorien gebracht hat. Die glaubwürdige Zeugin, die oben bereits mehrfach erwähnt worden ist, kannte den Angeklagten Baretzki ebenfalls, weil er wiederholt in die Baracke, in der die Zeugin als Schreiberin tätig war, gekommen ist. Der Zeugin und anderen Frauen gegenüber hat sich der Angeklagte Baretzki anständig verhalten. Die Zeugin wusste mit Bestimmtheit, dass Baretzki die Menschen nicht etwa zur Sauna oder dem Lager Kanada - wie es der Angeklagte Baretzki behauptete -, sondern zu den Gaskammern geführt hat. Auch diese Zeugin hat keine Veranlassung, den Angeklagten Baretzki zu Unrecht zu belasten. Auch ihr hat das Gericht vollen Glauben geschenkt. Der Zeuge Mir. ist ebenfalls glaubwürdig. Er hat seine Aussage ruhig und sachlich gemacht. Er ist von dem Angeklagten Baretzki persönlich nicht misshandelt worden. Es liegen keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass er Baretzki zu Unrecht hätte belasten wollen. Zudem wird seine Bekundung durch die Aussage der Zeugin Pal. und des Zeugen Erich K. bestätigt.
Aus all diesen Zeugenaussagen ist zu entnehmen, dass Baretzki vor allem auch im Jahre 1944, nachdem die neue Rampe in Birkenau in Betrieb genommen worden war, am Rampendienst teilgenommen und bei den Vernichtungsaktionen in der geschilderten Weise mitgewirkt hat. Alle Zeugen haben den Angeklagten Baretzki unabhängig voneinander wiederholt beim Rampendienst gesehen und zwar in einem Zeitraum zwischen Frühjahr und August 1944. In der Zeit zwischen Mai und August 1944 kamen pausenlos die sog. Ungarn-Transporte an, die durchschnittlich 3000 Personen nach Auschwitz brachten. Das Schwurgericht ist daher überzeugt, dass der Angeklagte Baretzki laufend zum Rampendienst eingeteilt worden ist. Da aber unsichere Schätzungen dem Urteil nicht zugrunde gelegt werden durften, hat sich das Gericht darauf beschränkt - wie in anderen Fällen - Mindestzahlen festzustellen. Nach den Aussagen der Zeugen und der Einlassung des Angeklagten und den gesamten Umständen kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass der Angeklagte Baretzki mindestens fünfmal den Rampendienst in der geschilderten Weise versehen hat und dass in diesen fünf Fällen bei durchschnittlichen Transportstärken von 3000 Menschen, von denen höchstens 25% in das Lager aufgenommen worden sind, mindestens jeweils 1000 Menschen durch Zyklon B getötet worden sind.
Die Überzeugung des Gerichts, dass der Angeklagte Baretzki den Beweggrund für die Tötung der jüdischen Menschen gekannt hat, stützt sich auf seine eigene Einlassung. Ihm und allen anderen SS-Angehörigen im KL Auschwitz ist in Vorträgen und Schulungsabenden immer wieder klar gemacht worden, dass die Juden ausgerottet werden müssten. Jeder im KL Auschwitz wusste, dass die Juden nur deshalb verfolgt und vernichtet wurden, weil man sie als Angehörige einer sog. "minderwertigen Rasse", die das deutsche Volk "verseuche" und ihm als Feind Nr.1 schade, ansah.
Da der Angeklagte Baretzki an mehreren Vernichtungsaktionen teilnahm und vorher - wie alle SS-Angehörigen - zur strengsten Geheimhaltung und Verschwiegenheit verpflichtet wurde, erfuhr er auch zwangsläufig die gesamten Begleitumstände, unter denen die jüdischen Menschen getötet wurden, so dass kein Zweifel bestehen kann, dass er auch von der strengen Geheimhaltung, der Tarnung, der Täuschung der Opfer und der Art ihres Todes Kenntnis nahm.
Dass er dabei auch das Bewusstsein gehabt haben muss und nach der Überzeugung des Gerichts auch gehabt hat, selbst einen Beitrag zu diesen Vernichtungsaktionen zu leisten, liegt auf der Hand. Es ergibt sich schon allein aus der Art seiner Beteiligung, die ihm dieses Bewusstsein aufdrängen musste.
3. Zu II.2.
Der Angeklagte Baretzki hat zu der Frage, ob er auch an Lagerselektionen teilgenommen hat, nicht Stellung genommen. Er hat in Abrede gestellt, jemals Häftlinge zu den Gaskammern begleitet zu haben.
Die Feststellungen des Gerichts unter II.2. beruhen auf den glaubhaften Aussagen der bereits oben erwähnten Zeugen Dow K., Erich K. und des Zeugen Cor. Diese Zeugen haben den Angeklagten Baretzki dabei beobachtet, wie er bei sog. Lagerselektionen mitgeholfen hat. Der Zeuge Erich K. konnte sehen, dass der Angeklagte Baretzki auf bestimmte Häftlinge gezeigt und den selektierenden Lagerarzt auf sie aufmerksam gemacht hat. Darüber hinaus hat der Zeuge Ka. bekundet, dass der Angeklagte Baretzki beim "Verladen" der
ausgesonderten Häftlinge auf die LKWs dabeigewesen sei und hierbei mitgeholfen habe. Ferner hat der Zeuge Dr. Wo. über die Selektion am 15.4.1944 berichtet, wobei sich der Angeklagte Baretzki nach der glaubhaften Aussage des Zeugen in der geschilderten Weise betätigt hat. Der Zeuge Dr. Wo. ist glaubwürdig. Er war als Häftlingsarzt im Quarantänelager eingesetzt. In dieser Funktion hatte er einen guten Überblick über die gesamten Lagerverhältnisse und kannte auch viele der im Lager Birkenau tätigen Blockführer. Auch den Angeklagten Baretzki kannte er gut. Er hat ihn in der Hauptverhandlung sofort wiedererkannt. Die Gefahr irgendeiner Verwechslung besteht nicht.
Der Zeuge Ka. schätzt die Anzahl der Lagerselektionen im Lagerabschnitt B II d, die er selbst miterlebt hat, auf acht bis zehn. Er meint, dass Baretzki immer dabeigewesen sei. Da auch die Zeugen Dow und Erich K., sowie der Zeuge Cor. Baretzki mehrfach bei Lagerselektionen gesehen haben und die vom Zeugen Dr. Wo. geschilderten Selektionen im Quarantänelager stattfanden, ist das Gericht überzeugt, dass der Angeklagte Baretzki mindestens an fünf Lagerselektionen in der geschilderten Weise teilgenommen hat. Da in allen Fällen die ausgesonderten Häftlinge durch LKWs weggefahren und durch Zyklon B in einer der Gaskammern getötet worden sind, konnte auch mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass in jedem Fall mindestens fünfzig Häftlinge ausgesondert und anschliessend vergast worden sind. Denn bei Lagerselektionen wurde stets eine grössere Anzahl von Häftlingen ausgesondert und durch Gas in den Gaskammern wurden stets nur grössere Gruppen von Häftlingen getötet. Bei weniger als fünfzig Häftlingen "lohnte" sich nach damaliger Auffassung der Aufwand, der mit einer LKW-Verladung und Vergasung in einer Gaskammer verbunden war, nicht.
Dass der Angeklagte Baretzki auch den Grund für die Beseitigung der Häftlinge gekannt hat, liegt auf der Hand. Denn er war aus der Tatsache, dass nur arbeitsunfähige und schwache Häftlinge, gegen die sonst nichts vorlag, für den Gastod ausgesondert wurden, klar zu ersehen.
Dem Angeklagten Baretzki war nach der Überzeugung des Gerichts auch klar, dass er selbst die Vernichtungsaktionen förderte. Das ergibt sich auch aus der Art seiner Mitwirkung von selbst.
4. Zu II.3.
Der Angeklagte Baretzki hat in Abrede gestellt, jemals einen Häftling im KL Auschwitz totgeschlagen oder auf andere Weise getötet zu haben.
Im Falle Lischka wird er jedoch durch die glaubhafte Aussage Dr. Wo's überführt. Der Zeuge hat den Vorfall aus nächster Nähe beobachtet. Er hat den Häftling Lischka unmittelbar danach untersucht und festgestellt, dass seine Nieren verletzt waren. Nach der Bekundung des Zeugen, der als Arzt insoweit sachverständiger Zeuge ist, sind diese Nierenverletzungen durch die Stockschläge des Angeklagten Baretzki hervorgerufen worden und waren mit Sicherheit ursächlich für den Tod des Häftlings Lischka.
Aus der Tatsache, dass der Angeklagte Baretzki mit einem Stock wahllos mit voller Wucht auf den Häftling eingeschlagen hat, hat das Gericht die Überzeugung gewonnen, dass der Angeklagte Baretzki den Häftling nicht nur schlagen wollte, sondern zumindest damit gerechnet hat, dass der Tod des Häftlings infolge dieser Stockschläge eintreten könnte und dass er dies billigend in Kauf genommen hat. Denn jeder vernünftige Mensch weiss, dass wuchtig geführte Stockschläge auf empfindliche Körperteile eines Menschen, zu denen das Rückgrat und die Nierengegend gehören, dessen Tod zur Folge haben können. Hier kam hinzu, dass es sich bei dem Häftling Lischka um einen "Muselmann" gehandelt hat, der bereits so schwach und hinfällig war, dass er sich nur langsam bewegen konnte. Das sah auch der Angeklagte Baretzki. Im übrigen zeigen die unter II.5. und II.6. festgestellten Taten, dass der Angeklagte Baretzki das Leben eines Häftlings nur gering geachtet und sich nicht gescheut hat, einen Menschen aus nichtigen Anlässen zu töten. Sein Verhalten in diesen Fällen gibt Aufschluss über seine innere Einstellung zu den Häftlingen. Es unterstützt die Überzeugung des Gerichts, dass der Angeklagte Baretzki im Falle Lischka den Tod des Häftlings billigend in Kauf genommen hat.
5. Zu II.4.
Der Angeklagte Baretzki hat bestritten, an der "Liquidierung" des Theresienstädter Lagers beteiligt gewesen zu sein. Er wisse zwar - so hat er sich eingelassen - dass die jüdischen Menschen aus dem Lagerabschnitt B II b damals mit Autos weggefahren und anschliessend durch das Gas getötet worden seien. Er selbst habe aber in jener Nacht Nachtdienst im Lagerabschnitt B II d gehabt. Mit dem Lagerabschnitt B II b habe er nichts zu tun gehabt. In diesem Lager seien nur zwei Blockführer gewesen.
Auf Grund der glaubhaften Aussage des oben bereits mehrfach erwähnten Zeugen Dow K. steht jedoch fest, dass der Angeklagte Baretzki bei der Räumung des Quarantänelagers (B II a), in das die jüdischen Menschen aus dem Lagerabschnitt B II b zunächst gebracht worden waren, dabeigewesen ist und bei der "Verladung" der Opfer auf die LKWs in der geschilderten Weise mitgeholfen hat. Der Zeuge Dow K. wurde selbst mit zwei anderen jüdischen Häftlingen, nachdem man ihn zunächst im Lagerabschnitt B II b als Kranken zurückgelassen hatte, noch gegen 21 Uhr in das Quarantänelager gebracht. Er hat dort den ihm bereits bekannten Blockführer Baretzki gesehen. Er konnte beobachten, wie er die Opfer bei der "Verladung" auf die LKWs mit seiner Pistole bedroht hat. Auch der Zeuge Doe. hat den Angeklagten Baretzki bei dieser Räumung des Quarantänelagers gesehen. Der Zeuge war im Lagerabschnitt B II d und hat - nach seiner glaubhaften Bekundung - aus dem Block 5 heraus, soweit es möglich war, die Vorgänge im Quarantänelager beobachtet. Dabei hat er unter den SS-Männern den ihm bekannten Baretzki erkannt. Einzelheiten über die Tätigkeit des Angeklagten Baretzki konnte er allerdings wegen der Entfernung zwischen seinem Beobachtungsstand und dem Quarantänelager nicht berichten. Er hat ihn gesehen, als die Gruppen der Häftlinge für den Abtransport zusammengestellt wurden. Damit hat er die Aussage des Zeugen Dow K. zumindest insoweit bestätigt, dass der Angeklagte Baretzki zu der Vernichtungsaktion hinzugezogen worden ist.
Die Angaben des Zeugen Dow. K. sind daher glaubhaft.
Dass die jüdischen Menschen des Theresienstädter Lagers am 8.3.1944 aus dem Quarantänelager nach den geschilderten Täuschungsmanövern zu den Gaskammern abtransportiert und dort durch Zyklon B getötet worden sind, hat keiner der Angeklagten, die damals im KL Auschwitz waren, in Abrede gestellt. Die Einzelheiten über die Gesamtaktion und die Mindestzahl der Opfer hat das Gericht auf Grund der glaubhaften Aussagen des Zeugen Erich K., der damals die gesamten Vorbereitungen der Vernichtungsaktion beobachten konnte und auf Grund seiner Beziehungen zur Schreibstube die Anzahl der Opfer hat erfahren können, festgestellt. Dieser Zeuge hat auch nach der durchgeführten Aktion von Angehörigen des jüdischen Sonderkommandos erfahren, dass die jüdischen Menschen aus dem Theresienstädter Lager tatsächlich durch Gas getötet worden sind.
6. Zu II.5.
Der Angeklagte Baretzki hat bestritten, dass sich in Birkenau jemals ein solcher Vorfall abgespielt habe. Er hat behauptet, dass es gar nicht möglich gewesen sei, Häftlinge nicht zum Appell in das Lager zu führen. Wenn man einen Teil vor der Küchenbaracke hätte stehen lassen, dann hätte es beim Appell ein grosses Durcheinander gegeben. Dieser Einwand des Angeklagten Baretzki ist nicht überzeugend. Denn es bestand keine Schwierigkeit, die Gesamtzahl der vor der Küchenbaracke angetretenen Häftlinge zu der beim Appell im Lager festgestellten Stärke hinzuzuzählen, so dass sich ohne weiteres die Gesamtstärke der im Lager befindlichen Häftlinge errechnen liess.
Auf Grund der glaubhaften Aussage des Zeugen Doe. steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass der Angeklagte Baretzki tatsächlich damals mindestens vier Häftlinge ertränkt hat. Der Zeuge hat widerspruchsfrei und in sich glaubhaft die damaligen Geschehnisse, so wie sie unter II.5. dargestellt worden sind, geschildert. Er war selbst in dem Kommando Zerlegerbetriebe und hat an dem Strafappell teilnehmen müssen. Dabei hat er mit eigenen Augen gesehen, wie Baretzki mindestens vier Häftlinge in das Wasser hineingeworfen und am Herauskommen gehindert hat, bis die Häftlinge im Wasser liegen blieben. Erst nach insgesamt vier Stunden gelang es dem Zeugen, sich in seinen Block zu schleichen.
Seine Aussage wird bestätigt durch die Aussage des Zeugen Laz. Auch dieser Zeuge war im Kommando Zerlegerbetriebe. Er hat den gleichen Vorgang geschildert wie der Zeuge Doe. Seine Aussage weicht nur in nebensächlichen Punkten von der Darstellung des Zeugen Doe. ab. So hat der Zeuge gemeint, dass sich der fehlende Häftling - so weit er sich erinnere - erst am Abend nach Beendigung der Arbeit eingefunden habe. Der Zeuge wusste auch nicht mehr genau die Einzelheiten, die dem Strafappell vorausgegangen waren. Dies ist jedoch nicht verwunderlich. Denn diese Dinge waren für den Zeugen von nebensächlicher Bedeutung. Sie wurden durch das furchtbare Geschehen am Löschteich in den Hintergrund gedrängt. Wenn der Zeuge diese Nebensächlichkeiten nach über zwanzig Jahren nicht mehr genau in Erinnerung hat, so beeinträchtigt das den Wert seiner Aussage in den wesentlichen und entscheidenden Punkten nicht, dass nämlich Baretzki mehrere Häftlinge in den Löschteich getrieben und am Herauskommen gehindert hat, bis sie ertranken. Darin stimmt seine Aussage mit der des Zeugen Doe. völlig überein. Der Zeuge weiss allerdings nicht mehr, wie viele Häftlinge ertränkt worden sind. Er meinte, dass es insgesamt mehr als zehn gewesen seien. Auch die anderen SS-Männer hätten Häftlinge ertränkt. Insoweit liegt kein Widerspruch zu der Aussage des Zeugen Doe. vor. Denn dieser Zeuge konnte nach etwa vier Stunden in seinen Block entkommen, während der Zeuge Laz. erheblich länger, nämlich bis zum Schluss des Strafappells stehen blieb. Es ist durchaus denkbar und wahrscheinlich, dass nach dem Weggang des Zeugen Doe. noch weitere Häftlinge ertränkt worden sind. Das Schwurgericht hat gleichwohl nur die vom Zeugen Doe. angegebene Mindestzahl seiner Feststellung zugrunde gelegt, weil der Zeuge Laz. bezüglich der Anzahl der ertränkten Menschen nicht mehr ganz sicher war.
Schliesslich hat auch der Zeuge Mir. von dem gleichen Vorfall berichtet. Der Zeuge war damals in der Schreibstube des Blockes zwei beschäftigt und hat den Angeklagten Baretzki gut gekannt. Der Zeuge hat aus der Schreibstube beobachtet, wie Häftlinge des Zerlegerkommandos vor der Küchenbaracke stehenbleiben mussten. Er hat dabei auch den Angeklagten Baretzki gesehen. Dann hat er weiter beobachtet, wie Häftlinge in den Wasserteich hineingetrieben worden sind. Er konnte auch sehen, wie der Angeklagte Baretzki die Häftlinge, die aus dem Wasser herauskommen wollten, auf die Hände getreten hat. Der Zeuge konnte sich ferner erinnern, dass später ein Feuerlöschauto gekommen ist und mit Haken nach den Leichen gesucht hat. Zwei Leichen wurden nach der Beobachtung des Zeugen von der Feuerwehr aus dem Wasser herausgeholt. Diese Darstellung steht nicht im Widerspruch zu den Angaben der Zeugen Doe. und Laz. Denn der Zeuge konnte die Vorgänge nicht ununterbrochen aus dem Block 2 beobachten. Der Zeuge hat nur das berichtet was er mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Es ist durchaus möglich, dass die Bergung weiterer Leichen erfolgte, ohne dass dies der Zeuge beobachten konnte.
Das Schwurgericht ist der Darstellung des Zeugen Doe. auch in den nebensächlichen Punkten gefolgt, weil sich dieser Zeuge unmittelbar nach dem Lageraufenthalt Aufzeichnungen über die Geschehnisse in Auschwitz gemacht hat. Seine Angaben erscheinen daher in jeder Beziehung am zuverlässigsten. Als Tatzeit hat der Zeuge Doe. die Mitte des Jahres 1944 angegeben. Auch insoweit erscheint seine Angabe aus dem genannten Grunde am zuverlässigsten, zumal auch der Zeuge Mir. gemeint hat, die Ertränkung der Häftlinge sei im Sommer oder Herbst 1944, jedoch nicht früher, gewesen. Nur der Zeuge Laz. will den Vorfall in der ersten Hälfte des Jahres 1944 miterlebt haben. Der Zeuge hat jedoch für diese Zeitangabe keine Gedächtnisstütze. Aus seiner Sicht war die Tatzeit von Anfang an nur von untergeordneter Bedeutung. An nebensächliche Dinge konnte sich der Zeuge nicht mehr zuverlässig erinnern. Seiner Zeitangabe hat das Schwurgericht daher keinen Beweiswert zuerkannt. Es ist vielmehr auch insoweit aus den genannten Gründen dem Zeugen Doe. gefolgt. Danach steht fest, dass der Vorfall erst nach dem 21.6.1944 geschehen ist.
7. Zu II.6.
Der Angeklagte Baretzki hat auch diese Taten geleugnet. Wie bereits ausgeführt, hat er sich dahin eingelassen, nie einen Häftling erschossen und totgeschlagen zu haben. Die Feststellung unter II.6.a. hat das Gericht auf Grund der glaubhaften Aussage des Zeugen Erich K. getroffen. Die Feststellung unter II.6.b. beruhen auf der Aussage des Zeugen Laz. Die Misshandlung des Häftlings durch den Stockschlag auf den kahlen Kopf (II.6.c.) hat der Zeuge Dow K. und die Tötung eines Häftlings durch das sog. "Krawattelegen" (II.6.d.) hat der Zeuge Had. geschildert.
Alle genannten Zeugen haben die geschilderten Vorfälle nach ihrer glaubhaften Aussage selbst miterlebt. Es besteht keine Veranlassung, an der Richtigkeit ihrer Angaben zu zweifeln. Die Zeugen haben den Angeklagten Baretzki gekannt. Der - bisher noch nicht erwähnte - Zeuge Had. war lange Zeit im Lagerabschnitt B.II.d. Er lernte daher den Angeklagten Baretzki als Blockführer kennen. Eine Verwechslungsgefahr scheidet daher aus. Irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass die Zeugen die Vorfälle erfunden haben könnten, bestehen nicht. Das Schwurgericht ist daher von der Richtigkeit ihrer Angaben, die sie mit dem Eid bekräftigt haben, überzeugt.
IV. Rechtliche Würdigung
1. Zu II.1.
Der Angeklagte Baretzki hat durch die geschilderte Tätigkeit im Rahmen des geleisteten Rampendienstes die Vernichtung der RSHA-Transporte im Zusammenwirken mit anderen SS-Angehörigen gefördert, somit einen kausalen Beitrag zu dem Mord der Haupttäter in mindestens fünf Fällen an je tausend Menschen geleistet. Er war ein Rädchen im gesamten Vernichtungsapparat. Durch seine Mitwirkung beim Aufstellen, Einteilen und Trennen der angekommenen Menschen hat er die Voraussetzung für die weitere Abwicklung der RSHA-Transporte, d.h. für die Tötung des grössten Teils dieser Menschen mitgeschaffen. Ferner hat er dadurch zum Tod der Opfer beigetragen, dass er sie zusammen mit anderen SS-Angehörigen zu den Gaskammern hingeführt hat. Der Angeklagte Baretzki hat den Rampendienst auf Befehl seiner Vorgesetzten geleistet. Da er Angehöriger der Waffen-SS gewesen ist, ist seine strafrechtliche Verantwortlichkeit im Rahmen des §47 MStGB zu beurteilen.
Er hat erkannt, dass die Befehle, die auf die Massentötung unschuldiger jüdischer Menschen hinzielten, ein allgemeines Verbrechen bezweckten. Wie oben unter A.V.2. bereits ausgeführt worden ist, hat Baretzki eingeräumt, dass er schon damals die Auffassung gehabt habe, dass die Judentötungen "hundertprozentiges Unrecht" seien. Ihm war es somit klar, dass die Massentötungen der Juden trotz der Befehle der höchsten Führung ein allgemeines Verbrechen waren und dass die Befehle, die seine Beteiligung an den Massentötungen anordneten, ein allgemeines Verbrechen bezweckten. Der Angeklagte Baretzki ist daher wegen seiner Mitwirkung an den Massentötungen als Teilnehmer zu bestrafen.
Bei ihm liegt der Verdacht nahe, dass er die Vernichtung der Juden als eigene Taten gewollt, also mit Täterwillen gehandelt hat. Denn - wie sich aus den Feststellungen unter II. ergibt - hat er im Lager als Blockführer zum Nachteil der Häftlinge erheblich mehr getan, als ihm befohlen war. Er hat sich nicht gescheut, eigenmächtig Menschenleben zu vernichten und Häftlinge trotz Verbotes brutal zu misshandeln. Bei den Lagerselektionen hat er durch Hinweise den selektierenden Lagerarzt auf bestimmte Häftlinge aufmerksam gemacht, was über seine befohlene Tätigkeit hinausging und somit zur Tötung bestimmter Häftlinge entscheidende Beiträge geleistet. Das kann als Beweisanzeichen dafür angesehen werden, dass er auch die Vernichtung der sog. RSHA-Juden innerlich bejaht und zu seiner eigenen Sache gemacht, also mit Täterwillen gehandelt hat.
Gleichwohl blieben Zweifel, ob sich der Angeklagte Baretzki ganz mit dem Judenvernichtungsprogramm der NS-Machthaber identifiziert hat. Der Angeklagte Baretzki ist nach dem Eindruck in der Hauptverhandlung ein primitiver Mensch von einfacher Denkungsart. Er kam erst nach Ausbruch des Krieges als Volksdeutscher nach Deutschland. Zur Waffen-SS wurde er - wie viele Volksdeutsche - eingezogen. Mit weltanschaulichen oder rassebiologischen Fragen hat er sich nach den getroffenen Feststellungen nicht befasst. Das hat ihn offenbar auch wenig interessiert. Dass er ein überzeugter Nationalsozialist gewesen sei, konnte nicht festgestellt werden.
Auch hat die Beweisaufnahme nicht ergeben, dass er beim Rampendienst durch besonderen Eifer aufgefallen und über die gegebenen Befehle hinausgegangen wäre. Er ist allerdings den damaligen Parolen, dass die Juden an allem, insbesondere dem Ausbruch des Krieges schuld seien, erlegen. Das zeigt der unter II.6.b. geschilderte Fall, in welchem er einem Juden vorwarf, dass seinetwegen Krieg sei, und indem er den Juden aus nichtigem Anlass bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen hat. Andererseits hat er mit anderen SS-Männern gegenüber dem Schulungsleiter Knittel - was ihm geglaubt werden kann - die Frage aufgeworfen, was denn die jüdischen Kinder getan hätten.
Das zeigt, dass er die Vernichtung aller jüdischen Menschen nicht ohne weiteres für notwendig und richtig gehalten und innerlich bejaht hat. Nach der Überzeugung des Gerichts kann daher trotz seines Eifers und seines gefühllosen und unbarmherzigen Verhaltens gegenüber bestimmten Häftlingen im Lager mit Sicherheit nur festgestellt werden, dass er den Haupttätern bei der Ausführung des beschlossenen und befohlenen Mordplanes Beihilfe hat leisten wollen. Irgendwelche Rechtfertigungsgründe für die Handlungsweise des Angeklagten Baretzki sind nicht ersichtlich.
Der Angeklagte Baretzki hat auch vorsätzlich gehandelt. Er hat - wie sich aus den getroffenen Feststellungen unter II.1. ergibt - das Bewusstsein gehabt, dass er als Glied im gesamten Vernichtungsapparat die Haupttaten förderte, und er hat die gesamten Umstände, die die Beweggründe der Haupttäter für diese Taten als niedrig und die Art ihrer Ausführung als heimtückisch und grausam kennzeichnen, gekannt. Ihm hat auch nicht das Bewusstsein gefehlt, durch seine Mitwirkung bei den Massentötungen Unrecht zu tun. Das ergibt sich aus seiner eigenen Einlassung, wonach er die Massentötungen der unschuldigen jüdischen Menschen bereits damals trotz der gegebenen Befehle als Unrecht ansah. Er hat auch nicht irrig angenommen, dass er die verbrecherischen Befehle als bindend befolgen müsse. Hierzu kann auf die Ausführungen unter A.V.2. Bezug genommen werden.
Dem Angeklagten Baretzki ist die Mitwirkung bei den Massentötungen nicht abgenötigt worden. Darauf beruft er sich selbst nicht. Dagegen spricht auch sein sonstiges Verhalten im KL Auschwitz und seine bereitwillige Mithilfe bei den Lagerselektionen. Nach der Überzeugung des Gerichts hat der Angeklagte bei der Abwicklung der RSHA-Transporte bereitwillig mitgeholfen, zumal er den Rampendienst jeweils dazu ausgenutzt hat, sich verschiedene Dinge zu "organisieren". Nach seiner eigenen Einlassung hat er sich auf der Rampe Zigaretten und sonstige Gegenstände aus dem Gepäck der angekommenen Menschen besorgt.
Die Frage eines wirklichen oder vermeintlichen Befehlsnotstandes (§52 StGB) oder eines allgemeinen Notstandes (§54 StGB) stellt sich daher bei ihm überhaupt nicht.
Der Angeklagte Baretzki war daher wegen seiner Mithilfe an mindestens fünf Vernichtungsaktionen von sog. RSHA-Juden wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zu gemeinschaftlichem Mord in mindestens fünf Fällen (§§47, 49, 211, 74 StGB), begangen in gleichartiger Tateinheit (§73 StGB) an mindestens je tausend Menschen, zu verurteilen.
2. Zu II.2.
Die Mithilfe des Angeklagten Baretzki an den Lagerselektionen ist rechtlich genau so zu beurteilen, wie seine Mitwirkung bei der Abwicklung der RSHA-Transporte. Dass die Tötung arbeitsunfähiger und schwacher Menschen Mord war, ist oben unter C.V.2. bereits ausgeführt worden. Der Angeklagte Baretzki hat zu diesen Mordtaten einen kausalen Beitrag durch die geschilderten Handlungen geleistet. Das bedarf keiner näheren Begründung. Auch in diesen Fällen hat der Angeklagte Baretzki - was zu seinen Gunsten unterstellt werden muss - auf Befehl seiner Vorgesetzten gehandelt, so dass auch hier der §47 MStGB zur Anwendung kommt. Nach der Überzeugung des Gerichts war dem Angeklagten Baretzki auch in diesen Fällen klar, dass die Tötung dieser unschuldigen Menschen nur wegen ihrer schlechten körperlichen Verfassung und Arbeitsunfähigkeit ein allgemeines Verbrechen war, und dass die Befehle, die die Mitwirkung von SS-Angehörigen an diesen Selektionen anordneten, ein allgemeines Verbrechen bezweckten. Er behauptet selbst nicht, dass er die Tötungen von Häftlingen nach sog. Lagerselektionen für rechtmässig gehalten habe. Im übrigen kann hierzu auf die Ausführungen unter C.V.2. und A.V.2. verwiesen werden.
Der Angeklagte Baretzki hat, ebenso wie in den unter II.1. geschilderten Fällen, nach der Überzeugung des Gerichts - aus den gleichen Gründen wie dort - auch nicht irrig angenommen, dass die ihm gegebenen Befehle, an diesen Lagerselektionen teilzunehmen, verbindlich gewesen seien.
Auch in diesen Fällen konnte nicht mit letzter Sicherheit festgestellt werden, dass der Angeklagte Baretzki mit Täterwillen gehandelt hat, wenn auch vieles dafür spricht, nämlich, dass er den Lagerarzt auf bestimmte Häftlinge aufmerksam gemacht hat, damit sie für den Gastod bestimmt würden und dass er in einem Fall auf flüchtende Häftlinge geschossen hat. Sein Eifer kann jedoch auch Ausfluss einer besonderen Beflissenheit und Befehlsergebenheit gegenüber seinen Vorgesetzten gewesen sein, um sich beliebt zu machen, so dass auch hier mit Sicherheit nur festgestellt werden kann, dass er die Mordtaten der Haupttäter als Gehilfe bereitwillig fördern und unterstützen wollte.
Jede der mindestens fünf Vernichtungsaktionen, durch die jeweils mindestens fünfzig Menschen getötet worden sind, ist als eine selbständige Handlung im Sinne einer gleichartigen Tateinheit anzusehen, da die Tötung der durch die fünf Lagerselektionen ausgewählten Häftlinge durch eine Willensbetätigung, nämlich das Einwerfen des Zyklon B durch die damit beauftragten SS-Männer erfolgt ist. Der Angeklagte Baretzki hat daher seine Beihilfehandlungen zu mindestens fünf verschiedenen Mordtaten, durch die jeweils mindestens fünfzig Menschen getötet worden sind, geleistet.
Er hat auch vorsätzlich gehandelt. Denn nach den getroffenen Feststellungen war ihm bewusst, dass er durch seine Handlungen bei den Selektionen und bei dem Abtransport der ausgesonderten Häftlinge die Vernichtungsaktionen förderte, somit einen kausalen Tatbeitrag zu dem Tode der Häftlinge leistete. Das wollte er auch. Er kannte nach den getroffenen Feststellungen auch die gesamten Umstände, die die Beweggründe für die Tötung der "selektierten" Menschen als niedrig und die Art ihrer Tötung als grausam kennzeichnen.
Irgendwelche Rechtfertigungs- oder Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich. Auch hier liegen die Voraussetzungen für einen wirklichen und vermeintlichen Nötigungsnotstand oder allgemeinen Notstand nicht vor. Der Angeklagte Baretzki ist zu der Mithilfe nicht gezwungen worden. Das behauptet er selbst nicht. Dagegen spricht auch sein Eifer bei den Selektionen und dem Abtransport der Häftlinge.
Der Angeklagte Baretzki war daher wegen seiner Mithilfe an mindestens fünf Lagerselektionen wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zu gemeinschaftlichem Mord in mindestens fünf Fällen (§§47, 49, 211, 74 StGB) begangen jeweils in gleichartiger Tateinheit (§73 StGB) an mindestens je fünfzig Menschen zu verurteilen.
3. Zu II.3.
Der Angeklagte Baretzki hat den Häftling Lischka mit bedingtem Vorsatz getötet. Denn die Stockschläge, die Baretzki dem Häftling Lischka verabreicht hat, waren ursächlich für dessen Tod, da Lischka an den durch die Stockschläge erlittenen Nierenverletzungen gestorben ist und Baretzki bei der Misshandlung Lischkas damit gerechnet hat, dass dieser infolge der Stockschläge sterben könnte, was er nach den getroffenen Feststellungen billigend in Kauf genommen hat. Damit sind die Voraussetzungen des bedingten Vorsatzes erfüllt.
Die Tötung war grausam. Der Angeklagte Baretzki hat Lischka durch die wuchtigen Stockschläge auf empfindliche Körperstellen, insbesondere die Nierengegend, erhebliche Schmerzen zugefügt. Nach der Verletzung der Nieren musste Lischka bis zu seinem Tode, der erst nach längerer Zeit nach der Misshandlung eintrat, ohne Zweifel noch erhebliche körperliche Schmerzen, aber auch seelische Qualen (Todesangst) erleiden. Baretzki hat dem Häftling diese Schmerzen und Qualen - wie schon die Tat selbst zeigt, wofür aber auch sein Verhalten bei der Ertränkung der vier Häftlinge spricht - aus einer rohen und unbarmherzigen Gesinnung heraus zugefügt. Die Tötung war auch heimtückisch. Der Häftling brauchte, als er auf der Lagerstrasse entlang ging, nicht mit einem plötzlichen und unerwarteten Angriff auf sein Leben zu rechnen. Er war somit arglos. Er war auch wehrlos. Denn als "Muselmann" hatte er nicht mehr die Kraft, sich gegen den Angriff zu wehren. Er konnte sich wegen seines geschwächten körperlichen Zustandes, der ihm nur noch langsame Bewegungen ermöglichte, auch nicht mehr durch Flucht dem Angriff entziehen. Baretzki hat diese Situation für seinen unerwarteten Angriff bewusst ausgenutzt.
Da der Angeklagte Baretzki zwangsläufig auch die gesamten Umstände, die die Tötung als grausam und heimtückisch kennzeichnen, miterlebt und somit gekannt hat, ist der Tatbestand des §211 StGB erfüllt. Nicht erforderlich ist, dass Baretzki selbst die Art der Tötung als grausam und heimtückisch bewertet hat.
Der Angeklagte Baretzki war daher wegen der Tötung des Häftlings Lischka wegen Mordes zu lebenslangem Zuchthaus (§211 StGB) zu verurteilen.
4. Zu II.4.
Die Massentötung der jüdischen Menschen aus dem KL Theresienstadt war ebenfalls Mord. Haupttäter dieser Vernichtungsaktion waren Hitler, Himmler und ihre Komplizen. Denn sie erfolgte im Rahmen der sog. "Endlösung der Judenfrage" aus den gleichen Gründen wie die Massentötung der mit RSHA-Transporten deportierten Menschen. Wenn die jüdischen Menschen aus dem KL Theresienstadt nicht sofort nach ihrer Ankunft im KL Auschwitz getötet worden sind, so geschah das nur aus Tarnungsgründen. Man wollte die Aussenwelt und die Angehörigen der deportierten Juden über deren Schicksal täuschen. Hierfür spricht eindeutig, dass die Juden aus Theresienstadt an ihre Verwandten vordatierte Karten schicken mussten, die erst nach der Vernichtungsaktion abgeschickt wurden.
Die Tötung der jüdischen Menschen aus dem KL Theresienstadt erfolgte daher ebenfalls aus niedrigen Beweggründen. Hierzu kann auf die Ausführung unter A.V.1. Bezug genommen werden. Die Tötungsart war grausam. Hier gilt das gleiche, was oben unter A.V.1. zu der Massentötung der RSHA-Juden in den Gaskammern durch Zyklon B ausgeführt worden ist.
Die ganze Vernichtungsaktion ist als eine einzige selbständige Handlung im Sinne einer gleichartigen Tateinheit anzusehen. Es war allerdings nicht zu klären, ob alle dreitausend Menschen in einer einzigen Gaskammer gleichzeitig getötet worden sind oder ob sie auf verschiedene Gaskammern verteilt oder in einer Gaskammer nacheinander getötet worden sind. Zu Gunsten des Angeklagte Baretzki musste davon ausgegangen werden, dass die Ermordung der Juden gleichzeitig in einer Gaskammer durch einmaliges Einwerfen von Zyklon B, also durch eine Willensbetätigung, erfolgt ist, weil dies die für den Angeklagten Baretzki rechtlich günstigste Möglichkeit ist. Es liegt somit Mord in einem Falle begangen in gleichartiger Tateinheit an mindestens dreitausend Menschen vor.
Der Angeklagte Baretzki hat zu diesem Mord an dreitausend Menschen im Zusammenwirken mit anderen SS-Angehörigen kausale Tatbeiträge geleistet, indem er beim Aufstellen und Formieren der für den Abtransport zu den Gaskammern bestimmten Menschen mithalf und widerstrebende Häftlinge zwang, die LKWs zu besteigen. Dadurch hat er zu dem reibungslosen Ablauf der gesamten Aktion beigetragen.
Auch in diesem Falle hat er auf Befehl seiner Vorgesetzten gehandelt, so dass §47 MStGB zur Anwendung kommt. Nach der Überzeugung des Gerichts hat er erkannt, dass die befohlene Tötung unschuldiger jüdischer Menschen verbrecherisch war und somit der ihm gegebene Befehl, dabei mitzuhelfen, ein allgemeines Verbrechen bezweckte. Denn hier war die gleiche Sachlage gegeben, wie bei der Tötung der mit RSHA-Transporten deportierten Juden.
Der Angeklagte Baretzki hat - wie sich aus der ganzen Art seiner Mithilfe von selbst ergibt - das Bewusstsein gehabt, durch seine Mitwirkung die Vernichtungsaktion zu fördern, somit einen kausalen Tatbeitrag zu dem Massenmord zu leisten. Das wollte er auch. Dies ergibt sich von selbst daraus, dass er widerstrebende Juden mit gezogener Pistole zwang, die LKWs zu besteigen. Ihn trifft daher die Strafe des Teilnehmers. Auch hier konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass er mit Täterwillen gehandelt hat. Nach den getroffenen Feststellungen hat er sich im Rahmen der gegebenen Befehle gehalten. Von irgendwelchen Exzessen gegenüber den jüdischen Menschen in diesem Falle ist nichts bekannt geworden. Im übrigen kann für die Frage seiner Willensrichtung (ob er mit Täter- oder nur mit Gehilfenwillen gehandelt hat) auf die obigen Ausführungen unter IV.1. verwiesen werden.
Somit war davon auszugehen, dass der Angeklagte Baretzki als Gehilfe die Vernichtungsaktionen fördern und unterstützen wollte. Da er gewusst hat, dass die jüdischen Menschen nur wegen ihrer Abstammung getötet werden sollten und getötet wurden, kannte er auch die Umstände, die die Beweggründe für die Tötungsaktionen als niedrig kennzeichnen. Ebenso kannte er die Umstände, die die Art ihrer Tötung als grausam kennzeichnen, da er über das Schicksal der Juden nach ihrem Abtransport Bescheid wusste. Er hat somit vorsätzlich in Kenntnis der gesamten Tatumstände in denen die Tatbestandsmerkmale des Mordes enthalten sind, Beihilfe zum Mord an dreitausend Menschen geleistet.
Irgendwelche Rechtfertigungs- oder Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich. Für das Vorliegen eines wirklichen oder vermeintlichen Nötigungsnotstandes oder allgemeinen Notstandes liegen keinerlei Anhaltspunkte vor. Er selbst beruft sich auch nicht darauf, dass sein Wille gebeugt oder er zur Mithilfe unter Gefahr für Leib und Leben gezwungen worden sei. Hier gilt im übrigen das gleiche, was oben bereits ausgeführt worden ist.
5. Zu II.5.
Die Ertränkung der vier Häftlinge erfüllt den Tatbestand des Mordes.
Der Angeklagte Baretzki hat bewusst und gewollt den Tod dieser Häftlinge herbeigeführt. Durch das Hineinwerfen in das Wasser hat er sie zunächst in Lebensgefahr gebracht. Dann hat er sie daran gehindert, sich aus dieser Gefahr zu befreien, bis ihre Kräfte erlahmten und sie ertranken. Aus seiner Handlungsweise ergibt sich klar, dass er ihren Tod bewusst gewollt hat.
Die Tötung der vier Häftlinge war grausam. Dies bedarf kaum einer näheren Begründung. Die in das Wasser hineingeworfenen Häftlinge mussten längere Zeit um ihr Leben kämpfen. Dabei musste ihnen immer mehr klar werden, dass der Angeklagte Baretzki ihnen keine Chance zur Rettung ihres Lebens lassen wollte. Das hat sie nach der Überzeugung des Gerichts in verzweifelte Todesangst versetzt. Es bedarf keiner Frage, dass sie in dieser Situation schwere seelische Qualen auszustehen hatten. Das Bewusstsein, unschuldig auf eine solche unwürdige Art und Weise wie eine Ratte oder Maus ersäuft zu werden, hat ohne Zweifel diese Qualen erhöht.
Diese Qualen hat der Angeklagte Baretzki den Häftlingen - was sich aus der Tat selbst ergibt - aus einer gefühllosen und unbarmherzigen Gesinnung heraus bereitet. Er hat sich an dem verzweifelten Kampf der Häftlinge um ihr Leben geweidet. Denn sonst wäre seine Handlungsweise nicht zu verstehen und zu erklären. Er hat nicht nur den einfachen Tod der Häftlinge gewollt, sondern hat ihnen aus unnatürlicher Freude an menschlichen Qualen einen qualvollen Tod bereiten wollen. Andernfalls hätte er sie mit der Pistole erschossen. Der Einwand der Verteidigung, dass sich der Angeklagte Baretzki "in einer heissen Wut"
oder in "wütender Erregung" befunden habe und deshalb seine Tat nicht als grausam empfunden habe, ist rechtlich unbeachtlich. Denn es kommt nicht darauf an, ob der Angeklagte Baretzki selbst die Tat als "grausam" bewertet hat. Entscheidend ist, dass er die gesamten Umstände gekannt hat, die die Art der Tötung eines Menschen als grausam kennzeichnen. Das ist nach der gesamten Sachlage der Fall. Im übrigen spricht auch die lange Dauer des Geschehens gegen eine Affekthandlung.
Da somit der Angeklagte Baretzki die vier Häftlinge vorsätzlich und grausam in Kenntnis der Tatumstände, die die Tat als grausam kennzeichnen, getötet hat, war er wegen Mordes in vier Fällen (§§211, 74 StGB) zu viermal lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen.
6. Zu II.6.
Die unter II.6. aufgeführten Taten des Angeklagten Baretzki sind nicht angeklagt und werden ihm durch den Eröffnungsbeschluss nicht zur Last gelegt. Nachtragsanklage ist insoweit nicht erhoben. Eine Verurteilung kann daher nicht erfolgen. Es erübrigt sich daher eine rechtliche Würdigung. Die Taten sind deswegen aufgeführt worden, weil sie Aufschluss über das allgemeine Verhalten des Angeklagten Baretzki im KL Auschwitz und seine innere Einstellung gegenüber den Häftlingen geben und zur Beurteilung seiner Persönlichkeit dienen können.
V. Hilfsbeweisanträge
Der Hilfsbeweisantrag des Verteidigers des Angeklagten Baretzki, den Josef Baretzki, den Bruder des Angeklagten Baretzki, darüber zu vernehmen, dass der Angeklagte Baretzki im November 1940 von Rumänien nach Deutschland und zwar mit seiner Schwester nach Oberschlesien umgesiedelt worden ist. war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da die in das Wissen des Zeugen gestellten Tatsachen zu Gunsten des Angeklagten Baretzki so behandelt werden können, als wären sie wahr. Das Gericht ist bei der Schilderung des Lebenslaufes des Angeklagten Baretzki von der behaupteten Tatsache ausgegangen. Der weitere Hilfsbeweisantrag des Verteidigers des Angeklagten Baretzki, den Zeugen Johann Mirbeth zum Beweise dafür zu vernehmen, dass im Frühjahr 1942 Volksdeutsche aus Rumänien und Ungarn zur Ausbildung nach Auschwitz gekommen sind und der Angeklagte Baretzki in eine Wachkompanie eingeteilt worden ist, für die der Zeuge bei der Aufstellung als Zugführer bestimmt worden war, war gemäss §244 Abs.III StPO ebenfalls abzulehnen, da die in das Wissen des Zeugen gestellten Tatsachen zu Gunsten des Angeklagten Baretzki so behandelt werden können, als wären sie wahr. Das Gericht ist davon ausgegangen, dass der Angeklagte Baretzki erst im Frühjahr 1942 nach Auschwitz eingezogen und dort zunächst im Wachsturmbann eingesetzt worden ist. Der weitere Hilfsbeweisantrag des Angeklagten Baretzki, den Inhaber der Firma Michalek zum Beweis dafür zu vernehmen, dass der Angeklagte Baretzki bei der Firma Michalek bis zum Februar 1942 gearbeitet hat, war gemäss §244 Abs.III StPO ebenfalls abzulehnen, da die in das Wissen des Zeugen gestellten Tatsachen so behandelt werden können, als wären sie wahr.
Die weiteren Hilfsbeweisanträge des Angeklagten Baretzki, eine Auskunft des Einwohnermeldeamtes in Gross-Wartenberg einzuholen zum Beweis dafür, dass sich der Angeklagte Baretzki bis zum Jahre 1942 (gemeint ist offensichtlich bis zum Frühjahr 1942, da in dem obigen Hilfsbeweisantrag behauptet wird, dass Baretzki im Frühjahr 1942 nach Auschwitz gekommen sei) in Gross-Wartenberg befunden habe, und die zwei Beschuldigtenlisten der Staatsanwaltschaft (Bl.5128 und 14032 der Akten) zum Beweise dafür zu verlesen, dass ein früherer SS-Angehöriger namens Koretzky im Verdachte steht, im KL Auschwitz strafbare Handlungen begangen zu haben, sowie den Zeugen Rögner zum Beweise dafür zu vernehmen, dass dieser Zeuge nur einen SS-Mann Barecki, aber nicht den Angeklagten Baretzki gekannt habe, waren gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da die unter Beweis gestellten Tatsachen so behandelt werden können, als wären sie wahr.
Der Hilfsbeweisantrag des Angeklagten Baretzki, den Zeugen See. zum Beweise dafür zu vernehmen, dass er in Auschwitz den Namen einer SS-Aufseherin (gemeint ist offensichtlich der Name Stiewitz) genannt bekam, jedoch bei seiner Gegenüberstellung im Jahre 1960 erklären musste, dass der ihm genannte Name nicht mit der Person identisch sei, die ihm von Auschwitz her bekannt gewesen sei, war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da die in das Wissen des Zeugen gestellten Tatsachen für die Entscheidung ohne Bedeutung sind. Dass allgemein die Möglichkeit von Verwechslungen bestehen kann, hat das Gericht bei der Beweiswürdigung stets berücksichtigt. Hierzu bedarf es nicht der Vernehmung des Zeugen See. Wie sich aus den Ausführungen im Rahmen der Beweiswürdigung ergibt, hat das Gericht in einer Reihe von Fällen eine Verwechslung durch Zeugen als möglich angenommen und daher auf Grund der Aussagen dieser Zeugen, die bestimmte Angeklagte belastet haben, keine für diese Angeklagten nachteiligen Feststellungen getroffen. Soweit die Vernehmung des Zeugen See. beantragt worden sein sollte, um dessen Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen, bedurfte es seiner Vernehmung nicht, weil in der Hauptverhandlung allseits auf die Vernehmung des Zeugen verzichtet worden ist, nachdem er bereits vernommen worden war. Auf Grund seiner Aussage sind keine Feststellungen getroffen worden und das Urteil beruht in keiner Weise auf seiner Aussage.
Der weitere Hilfsbeweisantrag des Angeklagten Baretzki, ein Sachverständigengutachten darüber einzuholen, dass die auf der vom Zeugen K. überreichten Fotografie als Baretzki bezeichnete Person nicht der Angeklagte Baretzki sei, war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da das Beweismittel völlig ungeeignet ist. Die aufgeworfene Frage ist keine Sachverständigenfrage. Nur ein Zeuge, der damals Baretzki gekannt hat, kann beurteilen, ob die abgebildete Person identisch ist mit dem Angeklagten Baretzki im Zeitpunkt der Aufnahme der Fotografie.
Im übrigen ist es für die Entscheidung ohne Bedeutung, ob die vom Zeugen K. auf der Fotografie als Baretzki bezeichnete Person tatsächlich mit Baretzki identisch ist oder nicht. Die auf der Fotografie abgebildete Person ist nicht deutlich zu erkennen. Die Meinungen der Zeugen, die den Angeklagten Baretzki vor über 20 Jahren gekannt haben, gehen daher auseinander, ob die abgebildete Person Baretzki ist oder nicht. Auch wer heute den Angeklagten Baretzki kennt, kann nicht sicher beurteilen, ob er die auf der Fotografie abgebildete Person ist oder nicht. Wenn Zeugen behauptet haben, Baretzki sei mit der abgebildeten Person identisch, so mindert das den Wert ihrer Aussage nicht. Denn sie können sich guten Glaubens wegen der schlechten Erkennbarkeit der abgebildeten Person geirrt haben. Das schliesst jedoch nicht aus, dass sie trotzdem Baretzki damals im Lager Auschwitz gut gekannt haben.
Der weitere Hilfsbeweisantrag des Verteidigers des Angeklagten Baretzki, den Zeugen Christian Schleusinger darüber zu vernehmen, dass der Angeklagte Baretzki streng aber gerecht gewesen sei, war als unzulässig abzulehnen, weil in das Wissen des Zeugen keine Tatsachen gestellt worden sind, sondern weil der Zeuge in Wirklichkeit ein Werturteil über den Angeklagten Baretzki abgeben soll. Es ist nicht ersichtlich, auf welche Tatsachen dieses Werturteil gestützt werden soll.
Im übrigen wäre es für die Entscheidung ohne Bedeutung, wenn der Zeuge nach seiner subjektiven Auffassung den Angeklagten Baretzki als streng, aber gerecht beurteilt hat. Das schliesst nicht aus, dass der Angeklagte Baretzki - vielleicht ohne Wissen des Zeugen - die oben festgestellten Taten begangen hat.
Der Hilfsbeweisantrag des Verteidigers des Angeklagten Baretzki, ein Sachverständigengutachten zum Beweise dafür einzuholen, dass der Angeklagte auf Grund seiner heutigen Kenntnis der polnischen Sprache niemals in der Lage gewesen sein könne, die polnische Sprache so beherrscht zu haben, dass er sich in ganzen Sätzen ausdrücken konnte, die polnische Sprache also fliessend beherrschte und dadurch bei einem Polen den Eindruck erwecken konnte, dass er ein sehr gutes Polnisch sprach, war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, weil das Beweismittel völlig ungeeignet ist. Denn ein Sachverständiger kann den Angeklagten Baretzki nicht zwingen, seine Kenntnisse der polnischen Sprache zu offenbaren. Der Angeklagte Baretzki könnte einen Sachverständigen bei einer Prüfung über seine heutigen Kenntnisse der polnischen Sprache täuschen. Eine solche Prüfung könnte daher nicht den Beweis erbringen, dass der Angeklagte Baretzki vor 20 Jahren nicht in der Lage gewesen ist, ganze Sätze in polnisch zu sprechen. Das beantragte Sachverständigengutachten könnte somit die Aussage des Zeugen Laz., dass er den Angeklagten Baretzki etliche Male gehört habe, wie er polnisch gesprochen habe, dass Baretzki wiederholt Häftlinge in der polnischen Sprache angesprochen, dass er ganze Sätze in Polnisch gesprochen und nach seiner - des Zeugen - Auffassung gut polnisch gesprochen habe, nicht widerlegen. Durch das beantragte Sachverständigengutachten kann daher die Glaubwürdigkeit des Zeugen Laz. nicht erschüttert werden. Im übrigen besagt die Aussage des Zeugen Laz. nicht, dass Baretzki die polnische Sprache in Wort und Schrift beherrscht und fliessend polnisch gesprochen hat. Es ist durchaus möglich, dass sich der Angeklagte Baretzki einige Redewendungen und Sätze in der polnischen Sprache angeeignet hatte, die er gut aussprechen konnte, so dass bei einem polnischen Zuhörer der Eindruck entstehen konnte, Baretzki spreche gut polnisch.
Schliesslich war auch der Hilfsbeweisantrag des Angeklagten Baretzki, ein Sachverständigengutachten zum Beweise dafür einzuholen, dass der Angeklagte Baretzki unter Berücksichtigung seines Herkommens, seines Charakters und seiner Stellung als Blockführer bei der Abnahme eines Appells durch das zu späte Erscheinen oder Nichterscheinen eines Häftlings derart erbost worden ist, dass er dadurch verärgert gewesen und in eine gewisse Erregung geraten ist, dass eine gewisse affektive Gemütsbewegung vorgelegen habe, gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da das angegebene Beweismittel völlig ungeeignet ist. Es war Aufgabe des Gerichts, in der Beweisaufnahme auf Grund der Zeugenaussage und der gegebenen Umstände festzustellen, ob bei dem Angeklagten Baretzki die behauptete Gemütslage gegeben war. Ein Sachverständiger, der die damaligen Vorgänge nicht miterlebt hat, kann darüber keine verbindlichen Angaben machen. Im übrigen kann es als wahr unterstellt werden, dass der Angeklagte Baretzki durch den angeordneten Strafappell, der seine Freizeit beschränkte, verärgert worden ist und in eine gewisse Erregung und gewisse affektive Gemütsbewegung geraten ist. Das hinderte den Angeklagten Baretzki nach der Überzeugung des Schwurgerichts jedoch nicht, die Tatumstände, die die Ertränkung der vier Häftlinge als "grausam" kennzeichnen, zu erkennen. Der Angeklagte Baretzki und sein Verteidiger behaupten nicht, dass seine Zurechnungsfähigkeit bei der Ertränkung der vier Häftlinge in irgendeiner Weise beeinträchtigt gewesen sei. Anhaltspunkte hierfür liegen auch nicht vor. Denn die Tötung der vier Häftlinge erfolgte erst nach zweistündigem Strafappell. Die Ertränkung selbst erstreckte sich über einen längeren Zeitraum. Die Verärgerung, "gewisse Erregung" und gewisse "affektive Gemütsbewegung" des Angeklagten Baretzki konnten daher wieder abklingen. Schliesslich spricht die Art der Tötung für eine wohlüberlegte, planmässig ausgeführte Tat. Anders wäre es, wenn Baretzki die Häftlinge erschossen hätte.
VI. Strafzumessung
Dem Angeklagten Baretzki konnte bei der Bemessung der wegen der 11 Beihilfehandlungen gegen ihn auszusprechenden zeitigen Zuchthausstrafen zugute gehalten werden, dass er zum Wachsturmbann des KL Auschwitz kommandiert worden ist, ohne entfernt zu wissen, was ihn dort erwartete und dass er bei seinen einfachen geistigen Anlagen zu einer gründlichen Beurteilung der Gesamtsituation in einer ihm völlig fremden Umgebung nicht in der Lage war und auf Befehl gehandelt hat. Zu seinen Gunsten wirkte sich auch aus, dass er sich bis zu seiner Aussiedlung in seiner Heimat unauffällig geführt hat. Zu seinen Ungunsten wurde aber gewertet, dass er die ihm im Lager übertragenen Aufgaben voller Eifer, unnachsichtig, roh und gefühllos den Häftlingen gegenüber ausgeführt hat. Er hat bei den Lagerselektionen von sich aus den Arzt auf schwache Häftlinge aufmerksam gemacht, die nach seiner Meinung ins Gas zu schicken seien. Deshalb erschien wegen der Mitwirkung bei den Lagerselektionen, wenn dabei auch die Zahl der Opfer 50 nicht überstieg, die gleiche Strafe angemessen, wie bezüglich seiner Beihilfe bei den Selektionen auf der Rampe, wo er zwar weniger Eifer zeigte, jeweils aber mit seiner Hilfe mindestens 1000 Menschen ermordet wurden. In diesen insgesamt 10 Fällen wurden Zuchthausstrafen von je 3 Jahren und 6 Monaten ausgesprochen. Bei der Vernichtung des Theresienstädter Lagers war der Tatbeitrag des Angeklagten nicht unerheblich, die Zahl der Opfer besonders hoch; es wurde deshalb für diese Tat eine Zuchthausstrafe von 5 Jahren auferlegt.
Unter Berücksichtigung der angeführten Umstände wurde unter Erhöhung der Zuchthausstrafe von 5 Jahren eine Gesamtstrafe von 8 Jahren Zuchthaus gebildet.
L. Die Straftaten des Angeklagten Dr. L.
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Dr. L.
Der Angeklagte Dr. L. ist am 15.9.1911 als Sohn eines Schlachtermeisters in Osnabrück geboren. Er besuchte vom 6. Lebensjahr an die Mittelschule in Osnabrück bis zur mittleren Reife. Dann kam er auf das humanistische Gymnasium Carolinum in Osnabrück, das er vier Jahre lang besuchte. Anschliessend wechselte er auf das Gymnasium in Meppen/Emsland über, wo ein Onkel von ihm als Schulrat tätig war. 1933 bestand er in Meppen das Abitur. Danach studierte er 4 Semester Philologie an der Universität Münster. Er gab dann das Philologie-Studium auf und begann mit dem Studium der Medizin. 1937 setzte er dieses Studium an der Universität Rostock und 1939 an der Universität in Danzig fort. 1942 legte er an der Universität in Danzig das medizinische Staatsexamen ab und promovierte im gleichen Jahr zum Doktor der Medizin.
Der Angeklagte trat im Jahre 1933 als Student der SA bei. Er machte drei Kurse auf der SA-Geländesportschule mit. Im September 1934 trat er wieder aus der SA aus. In einem am 15.2.1938 in Rostock geschriebenen handschriftlichen Lebenslauf gab der Angeklagte als Grund für diesen Austritt an, "dass der Geist vieler Angehöriger der SA-Studentenstürme in Münster" - wo Studenten nur in SA-Studentenstürmen eingegliedert wurden - "alles andere als "ideal" gewesen sei". In Rostock trat der Angeklagte am 15.11.1937 der SS bei. Im Jahre 1938 oder 1939 stellte er den Antrag auf Aufnahme in die NSDAP. Er wurde mit Wirkung vom 1.5.1937 in die Partei aufgenommen.
Nach dem Staatsexamen und der Promotion wurde der Angeklagte Dr. L. zum Sicherheitshilfsdienst (SHD) in Danzig eingezogen. Bei diesem machte der Angeklagte 6 oder 8 Wochen Dienst. Anschliessend kam er zur ärztlichen Akademie der Waffen-SS nach Graz. Dort absolvierte er einen zwei Monate dauernden Lehrgang, nach dessen Abschluss er zum SS-Hauptscharführer - was dem Unterarzt bei der Wehrmacht entspricht - befördert wurde. Gegen Ende des Jahres 1942 wurde er nach Nürnberg versetzt, wo er in einem SS-Lazarett und gleichzeitig als Truppenarzt bei einer Nachrichteneinheit der Waffen-SS eingesetzt wurde.
Der Angeklagte wurde am 20.4.1943 zum SS-Untersturmführer und am 9.11.1943 zum SS-Obersturmführer befördert.
Am 11.10.1943 wurde er von Nürnberg zu der Bewährungseinheit 500 nach Belgrad versetzt. Wie er sich einlässt, soll die Versetzung wegen defaitistischer Äusserungen, die er während eines Bierabends gemacht habe, erfolgt sein. Bei der Bewährungseinheit wurde der Angeklagte als Truppenarzt verwendet. Später sei er dann - so hat der Angeklagte weiter angegeben -, in das Nachbardorf zu einer Fallschirmjägereinheit gekommen, die sich aus der Bewährungseinheit 500 rekrutiert habe. Auch bei dieser Einheit habe er als Truppenarzt Dienst gemacht.
Am 15.12.1943 wurde der Angeklagte zum WVHA Amt D III versetzt und kam noch im Dezember 1943 in das KZ Auschwitz. In Auschwitz wurde der Angeklagte als SS-Lagerarzt in Birkenau (Zigeunerlager und Theresienstädter Lager) und als Truppenarzt im Stammlager eingesetzt. Im Verlaufe des Jahres 1944 wurde der Angeklagte nach dem KZ Mauthausen versetzt. Von dort kam er nach dem KZ Stutthof, dann nach dem Lager Ravensbrück und schliesslich in das KZ Sachsenhausen. Aus diesem entfloh er im März 1945. Er verbarg sich bei einem Norweger namens Hjort.
Nach Kriegsende gelangte der Angeklagte nach Elmshorn, wo er heute noch ansässig ist. Ein Entnazifizierungsverfahren wurde gegen den Angeklagten nicht durchgeführt. Nachdem der Angeklagte im Krankenhaus in Elmshorn zunächst als Assistenzarzt und dann als Oberarzt beschäftigt war, wurde er dort als leitender Arzt der geburtshilflichen-gynäkologischen Abteilung angestellt. Er verdiente etwa 30000 DM netto jährlich.
Gemeinsam mit seiner Ehefrau besitzt der Angeklagte ein Einfamilienhaus im Werte von etwa 80000 DM. Da der Angeklagte bei seiner Einstellung an dem Stadtkrankenhaus in Elmshorn verschwiegen hatte, als SS-Lagerarzt im Konzentrationslager gewesen zu sein, wurde er nach Bekanntwerden der gegen ihn in diesem Verfahren erhobenen Anschuldigungen Anfang 1963 entlassen. Er betrieb zuletzt vor seiner Verhaftung eine Privatpraxis, ohne Zulassung für die AOK und die Ersatzkassen.
Der Angeklagte hat im Jahre 1950 geheiratet. Aus der Ehe sind 2 Kinder hervorgegangen, die noch minderjährig sind. Der Angeklagte ist im Verlauf der Hauptverhandlung am 24.3.1965 verhaftet worden. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft.
II. Mitwirkung des Angeklagten Dr. L. an der Massentötung jüdischer Menschen in Auschwitz (Tatsächliche Feststellungen)
Der Angeklagte Dr. L. hat als SS-Arzt bei der massenweisen Tötung der sog. RSHA-Juden (vgl. oben 2. Abschnitt VII.5. und 3. Abschnitt A.II.) mitgewirkt.
Er wurde - wie andere SS-Ärzte - vom SS-Standortarzt Dr. Wirths zum "ärztlichen Rampendienst" eingeteilt. Er hat diesen Rampendienst auch in einer unbestimmten Anzahl von Fällen versehen. Dabei hat er die Aufgaben erfüllt, die die SS-Ärzte befehlsgemäss bei der Abwicklung von RSHA-Transporten wahrzunehmen hatten: Er hat aus mindestens vier verschiedenen RSHA-Transporten, die zu verschiedenen Zeiten in Auschwitz ankamen, jeweils als einziger Arzt die jüdischen Männer und Frauen über 16 Jahren, die nicht schon vorher wegen Gebrechlichkeit und zu hohen Alters von niederen SS-Dienstgraden ausgesondert und in einer besonderen Marschkolonne aufgestellt worden waren, auf ihre Arbeitstauglichkeit gemustert und darüber entschieden, wer als arbeitsfähig in das Lager aufgenommen und wer in der Gaskammer getötet werden sollte. Bei diesen Selektionen hat er nicht mehr als 25% der angekommenen Menschen für die Aufnahme in das Lager bestimmt. Nach den Selektionen fuhr er zu einer der Gaskammern, in die die für den Tod bestimmten Menschen hineingeführt wurden. Dort gab er, nachdem die Gaskammer verriegelt worden war, den dafür eingeteilten SS-Männern des Vergasungskommandos das Zeichen zum Einschütten des Zyklon B. Während des Einschüttens überwachte er die Männer des Vergasungskommandos, um im Falle einer Vergiftung sofort eingreifen und ärztliche Hilfe geben zu können. Durch das Guckloch beobachtete er in den vier Fällen den Todeskampf der eingeschlossenen Opfer. Wenn nach seiner Meinung die Opfer tot waren, gab er das Zeichen zum Öffnen der Gaskammer. Er überzeugte sich dann von dem Tod der Opfer und gab ihre Leichen zur Verbrennung frei. Aus jedem der vier genannten RSHA-Transporte sind mindestens je tausend Menschen für den Tod bestimmt und in einer der Gaskammern getötet worden. Der Angeklagte Dr. L. wusste, dass die jüdischen Menschen nur wegen ihrer Abstammung als Angehörige einer sog. minderwertigen Rasse unschuldig getötet wurden. Er war sich auch darüber im klaren, dass er in den vier Fällen durch seine geschilderten Tätigkeiten selbst einen kausalen Beitrag zu den befohlenen Vernichtungsaktionen leistete.
III. Einlassung des Angeklagten Dr. L., Beweismittel, Beweiswürdigung
Die Feststellungen zum Lebenslauf des Angeklagten Dr. L. beruhen auf seiner eigenen Einlassung, seinem am 15.2.1938 handschriftlich geschriebenen Lebenslauf und der für ihn ausgestellten SS-Führerkarte. Die beiden genannten Urkunden wurden durch Verlesung zum Gegenstand der Verhandlung gemacht.
Was den ihm gemachten Schuldvorwurf betrifft, hat der Angeklagte Dr. L. eingeräumt, dass er als Arzt zum Rampendienst eingeteilt worden sei. Er hat auch zugegeben, dass er während der Abwicklung von RSHA-Transporten auf der Rampe gewesen sei. Über seine Tätigkeit auf der Rampe hat jedoch seine Einlassung im Verlaufe der Hauptverhandlung gewechselt. Bei seiner ersten Einlassung zur Sache hat er angegeben, dass er ab Frühjahr 1944 nach einer von Dr. Wirths einberufenen Ärztebesprechung jeweils zusammen mit einem Zahnarzt oder Apotheker zum Rampendienst eingeteilt worden sei. Das sei durch schriftliche Dienstpläne, an deren äussere Form er sich nicht mehr erinnere, geschehen. Wenn er eingeteilt gewesen sei, habe er sich jeweils, wenn ihm die Ankunft eines RSHA-Transportes angekündigt worden sei, unter der Hand einen Kollegen als Vertreter gesucht, der dann für ihn selektiert habe. Er sei allerdings auch selbst zu der Rampe hingefahren, weil sonst der Kollege nicht hingekommen wäre. Auf der Rampe habe er jedoch nicht selektiert. Es sei dort kein Platz für zwei Personen zum Selektieren gewesen. Dr. Wirths habe dies jedoch alsbald bemerkt. Er sei "hellhörig" und "bösartig" geworden und habe ihm befohlen, allein auf die Rampe zu gehen. Allerdings habe er ihm nicht in krasser Form gedroht. Er - der Angeklagte - sei dann in vier Fällen als einziger Arzt zum Rampendienst und zur Abwicklung von RSHA-Transporten hingegangen. Aber auch in diesen vier Fällen habe er nicht selektiert. Er sei vielmehr sofort zu dem anwesenden Kommandanten des Lagers Birkenau, Kramer, hingegangen und habe ihm erklärt, er sei nicht in der Lage, Dienst zu machen, weil er Gallenkoliken habe und an einer Magen- und Darmgeschichte leide. Kramer habe sich damit zufrieden gegeben und habe für ihn die Ausmusterung der Arbeitsfähigen übernommen. Er - der Angeklagte - sei dann bei der ersten besten Gelegenheit von der Rampe verschwunden. Bei den Gaskammern sei er nie gewesen. Insgesamt sei er vielleicht zwanzigmal auf der Rampe gewesen, ohne jedoch ein einziges Mal selektiert zu haben.
In der Sitzung vom 11.3.1965 hat der Angeklagte Dr. L. seine Einlassung wie folgt geändert: Nachdem er nach Auschwitz gekommen sei und festgestellt habe, was dort vorgehe, habe er das als ein Verbrechen bezeichnet. Deswegen habe er sich mit Dr. Wirths "angelegt". Er habe sich mit Magen- und Darmkoliken zu drücken versucht. Als die Massentransporte eingesetzt hätten, sei er jedoch auch für den Rampendienst eingeteilt worden. Er habe jedoch stets erreicht, dass Kollegen für ihn den Rampendienst versehen hätten. Allerdings sei er selbst auch mit zur Rampe gegangen. Als Grund hierfür gab der Angeklagte Dr. L. nunmehr an, dass er sich davon überzeugen wollte, ob der Kollege auch tatsächlich auf die Rampe hingekommen sei. Sonst wäre "die Bombe sofort geplatzt". Auf der Rampe habe er sich jeweils nur wenige Minuten aufgehalten. Schliesslich sei Dr. Wirths "hellhörig" geworden. Er habe ihn zum Rampendienst befohlen. Auf der Rampe habe er sich dann an den Kommandanten Kramer gewandt und habe Magen- und Darmkoliken vorgeschützt, weswegen er nicht selbst selektieren könne. Kramer habe ihn aber angefahren. Er habe geäussert, er sei über ihn - Dr. L. - bestens orientiert. Er wisse, dass er - Dr. L. - schon ein Verfahren wegen Häftlingsbegünstigung gehabt habe. Er - Kramer - gebe ihm den Befehl, sich an den Selektionen zu beteiligen, andernfalls lasse er ihn sofort abführen. Er - Dr. L. - habe dann vier- bis fünfmal selbst die jüdischen Menschen auf ihre Arbeitstauglichkeit überprüft, Kramer habe währenddessen hinter ihm gestanden. Als er - Dr. L. - viele Häftlinge, die gar nicht mehr arbeitsfähig gewesen seien, zu den Arbeitsfähigen gestellt und so vor dem Tode bewahrt habe, habe Kramer "getobt" und habe sie wieder zurück zu den für den Tod bestimmten Menschen geschickt. In den vier bis fünf Fällen sei noch ein zweiter Arzt dabeigewesen. Er wisse jedoch nicht mehr, ob dieser auch selektiert habe. Zu den Gaskammern sei er in den vier bis fünf Fällen nicht hingefahren.
Wenn er sich zu Beginn des Prozesses anders eingelassen habe, so deswegen, weil er keine Zeugen für seine jetzige Darstellung gehabt habe und gefürchtet habe, in Untersuchungshaft genommen zu werden.
Das Schwurgericht hat dem Angeklagten Dr. L. nicht geglaubt, dass er stets von Kollegen den Selektionsdienst hat übernehmen lassen, wenn er zum Rampendienst eingeteilt worden ist. Es hat ihm auch nicht abgenommen, dass er von Kramer zum Selektieren in der geschilderten Weise gezwungen worden ist. Nach der Überzeugung des Gerichts hat der Angeklagte Dr. L. den angeblichen Zusammenstoss mit Kramer erfunden, um eine Notstandssituation zu konstruieren, weil er sich nach der durchgeführten Beweisaufnahme sagen musste, dass ihm seine ursprüngliche Einlassung, Kramer habe für ihn den Selektionsdienst übernommen, er selbst habe nie selektiert, vom Gericht nicht abgenommen werden würde.
Was die Übernahme des Selektionsdienstes durch Kollegen anbetrifft, so erscheint es zwar an sich nicht unglaubhaft, dass sich Arztkollegen gegenseitig im befohlenen Dienst vertreten haben oder, dass ein Arzt aus Gefälligkeit gegenüber einem Kollegen dessen Funktionen übernommen hat. Ein einleuchtender Grund dafür, dass Dr. L. es aber noch für notwendig gehalten haben soll, auch selbst zur Abwicklung von RSHA-Transporten auf die Rampe hinzugehen, wenn er - wie behauptet - schon vor dem Eintreffen eines RSHA-Transportes einen Kollegen für die Übernahme des Selektionsdienstes gewonnen hatte, ist jedoch nicht ersichtlich. Denn wenn sich tatsächlich ein Kollege vor Ankunft des Transportes aus Gefälligkeit für die Übernahme des Selektionsdienstes bereit erklärt und dem Angeklagten Dr. L. das Versprechen gegeben hatte, freiwillig seine Funktion zu übernehmen, hätte Dr. L. keine Veranlassung mehr gehabt, auch selbst noch zum Rampendienst hinzugehen.
Der Angeklagte Dr. L. hat auch keine überzeugende Begründung für die Notwendigkeit seines Erscheinens auf der Rampe trotz der angeblichen Übernahme des Selektionsdienstes durch einen Kollegen geben können. Er hat insoweit zu verschiedenen Zeiten zwei verschiedene Erklärungen gegeben. Bei seiner ersten Einlassung zur Sache hat er auf Befragen erklärt, dass er selbst auch zur Rampe hätte gehen müssen, "weil sonst der Kollege, der ihn vertreten sollte, auch nicht hingegangen wäre". Damit hat er die Notwendigkeit seines eigenen Erscheinens auf der Rampe mit einer erforderlichen psychischen Unterstützung des Kollegen begründet. Diese Begründung vermag jedoch nicht zu überzeugen. Denn es erscheint abwegig, dass ein Kollege für einen Selektionsdienst, den er freiwillig zu übernehmen bereit war, noch der psychischen Unterstützung dessen, den er vertreten wollte, bedurft hätte, zumal der Vertretene auf der Rampe selbst nichts getan haben will.
Diese Begründung hat der Angeklagte Dr. L. bei seiner Einlassung am 11.3.1965 auch nicht mehr wiederholt. In dieser Sitzung hat er auf die Frage, warum er überhaupt noch selbst auf die Rampe hingegangen sei, wenn ihm bereits vor der Ankunft eines RSHA-Transportes ein Kollege die Übernahme des Selektionsdienstes versprochen hatte, erklärt, dies sei geschehen, weil er sich davon habe überzeugen wollen, ob der Kollege auch tatsächlich auf die Rampe hingekommen sei. "Sonst wäre die Bombe gleich geplatzt." Auch diese Begründung, die von der bei der ersten Einlassung gegebenen Erklärung erheblich abweicht, vermag nicht zu überzeugen. Denn normalerweise wird man davon ausgehen können, dass sich ein Arzt darauf verlassen wird, dass ein Kollege ein gegebenes Versprechen hält und dass es einer Kontrolle insoweit nicht bedarf. Hiervon abgesehen, spricht aber schon allein die Tatsache, dass Dr. L. zu verschiedenen Zeiten zwei verschiedene Begründungen dafür gegeben hat, warum er trotz der Übernahme des Selektionsdienstes durch Kollegen noch selbst zur Rampe gegangen ist, eindeutig dafür, dass seine gesamte Einlassung insoweit eine Schutzbehauptung und unglaubhaft ist. Unterstützt wird diese Auffassung des Gerichts noch durch die Überlegung, dass damals, zur Zeit der Ungarn-Transporte, täglich mindestens ein Transport, manchmal auch zwei oder mehr, angekommen sind. Alle Ärzte waren durch den Selektionsdienst überlastet. Deswegen hatte der Standortarzt Dr. Wirths auch angeordnet, dass die Zahnärzte und Apotheker zum Rampendienst mit heranzuziehen seien. Bei dieser Überlastung der Ärzte durch Selektionsdienst erscheint es unwahrscheinlich, dass Dr. L. stets einen Kollegen gefunden haben soll, der trotz eigener Überlastung mit Selektionsdienst auch noch zusätzlich für einen anderen Dienst gemacht haben soll.
Schliesslich ist diese Einlassung des Angeklagten Dr. L. auch noch aus folgenden Gründen unglaubhaft: Der ehemalige Kollege des Angeklagten Dr. L., der SS-Obersturmführer Dr. Fritz Klein, der ebenfalls als SS-Lagerarzt im KL Auschwitz tätig gewesen ist, hat in dem gegen ihn durchgeführten sog. Bergen-Belsen-Prozess auch Angaben über seine und seiner Kollegen Tätigkeit in Auschwitz gemacht. Die Abschrift eines Auszuges aus dem Protokoll über seine Vernehmung in dem Bergen-Belsen-Prozess ist gemäss §251 StPO verlesen worden, da der Zeuge Dr. Klein inzwischen hingerichtet worden ist. Das Gericht hat keine Zweifel, dass die Abschrift mit der Urschrift des Vernehmungsprotokolls übereinstimmt. Dr. Klein hat bei seiner Vernehmung im Bergen-Belsen-Prozess - wie sich aus dem Auszug aus dem Protokoll ergibt - die in Auschwitz tätigen SS-Ärzte angeführt. Dabei hat er auch den Namen des Dr. L. genannt. Über die Selektionen der RSHA-Transporte hat sich Dr. Klein wie folgt geäussert:
Wenn Transporte in Auschwitz ankamen, war es Aufgabe der Ärzte, diejenigen herauszusuchen, die zur Arbeit ungeeignet oder unfähig waren. Das betraf auch Kinder, alte Leute und Kranke. Ich habe die Gaskammern und Krematorien in Auschwitz gesehen, habe gewusst, dass diejenigen, die ich aussortierte, in die Gaskammern mussten .... Alle Befehle wurden mir mündlich übermittelt. Alle Ärzte, die ich vorher erwähnt habe, haben an diesen Aussortierungen teilgenommen .... Nach den Angaben des Dr. Klein hat somit auch der Angeklagte Dr. L. an den Aussortierungen teilgenommen. Es ist nicht anzunehmen, dass Dr. Klein den Angeklagten Dr. L. belastet hätte, wenn dieser stets einen Kollegen für die Übernahme des Rampendienstes gewonnen und nur in vier bis fünf Fällen unter Zwang selektiert hätte. Die Aussage des Dr. Klein spricht vielmehr dafür, dass Dr. L. - wie alle anderen eingeteilten Ärzte - befehlsgemäss den Rampendienst versehen hat.
Ferner hat der Zeuge Dr. Loeb., der selbst als Häftlingsarzt in Auschwitz gewesen ist, in der Hauptverhandlung erklärt, er wisse zwar heute nicht mehr, ob er den Angeklagten Dr. L. im KL Auschwitz gekannt habe. Unmittelbar nach seiner Befreiung aus dem Lager habe er jedoch den Namen des Dr. L. auf eine Liste der Hauptkriegsverbrecher gesetzt, die er im Jahre 1945 den Russen übergeben habe. Das ersehe er aus seinen Aufzeichnungen, die er sich unmittelbar nach der Befreiung angefertigt habe. Heute wisse er nicht mehr, warum er den Dr. L. auf die Hauptkriegsverbrecherliste gesetzt habe. Auch wenn Dr. Loeb. heute den Grund hierfür nicht mehr weiss, ist doch die Tatsache, dass er bereits 1945 den Dr. L. auf die Liste der Hauptkriegsverbrecher gesetzt hat, ein weiteres Indiz dafür, dass Dr. L. regelmässig an den befohlenen Selektionen teilgenommen haben muss. Denn auf Grund der Beweisaufnahme kann davon ausgegangen werden, dass sich Dr. L. im Lager den Häftlingen gegenüber anständig und hilfsbereit verhalten und alles getan hat, um ihr Los zu erleichtern, wie später noch auszuführen sein wird. Wegen irgendwelcher Vergehen oder Verbrechen im Lager kann Dr. Loeb. ihn daher nicht auf die Kriegsverbrecherliste gesetzt haben. Das kann sich vielmehr nur auf den Selektionsdienst nach der Ankunft von RSHA-Transporten beziehen. Andererseits wäre nicht zu verstehen, warum Dr. Loeb. den Angeklagten Dr. L. bereits im Jahre 1945 als Hauptkriegsverbrecher bezeichnet haben soll, wenn Dr. L. für den Selektionsdienst stets einen Vertreter bekommen hätte und allenfalls vier- bis fünfmal unter Zwang selektiert hätte.
Schliesslich hat der Angeklagte Baretzki im Anschluss an die Einlassung des Angeklagten Dr. L. am 11.3.1965 glaubhaft erklärt, dass Dr. L. während der ganzen Zeit der ungarischen Transporte im Sommer 1944 Dienst auf der Rampe gemacht hat. Er - Baretzki - habe nie bemerkt, dass Kramer ihn oder irgendeinen anderen Arzt zum Selektionsdienst gezwungen hätte.
Aus all diesen Gründen erscheint die Behauptung des Angeklagten Dr. L., er habe stets einen Vertreter für den Selektionsdienst gewonnen, wenn er zum Rampendienst eingeteilt gewesen sei, unglaubhaft. Das Gericht ist überzeugt, dass er, wenn er zum Rampendienst eingeteilt war, auch befehlsgemäss den Selektionsdienst gemacht hat.
Auch der angebliche Zusammenstoss zwischen dem Angeklagten Dr. L. und dem Lagerkommandanten von Birkenau, Kramer, auf der Rampe ist nicht glaubhaft. Auch hiergegen sprechen die Angaben des hingerichteten Dr. Klein, die Tatsache, dass Dr. Loeb. bereits im Jahre 1945 den Angeklagten Dr. L. auf die Liste der Hauptkriegsverbrecher gesetzt hat und schliesslich die Aussage des Angeklagten Baretzki, dass Dr. L. während der gesamten Zeit der Ungarn-Transporte Rampendienst gemacht hat.
Die von dem Angeklagten Dr. L. in der Sitzung vom 11.3.1965 gegebene Darstellung über den angeblichen Zusammenstoss mit Kramer, die in Widerspruch zu der ersten Darstellung des Angeklagten über das Verhalten Kramers auf der Rampe steht und diese ausschliesst und schon deswegen Misstrauen an der Wahrheitsliebe des Angeklagten Dr. L. wecken muss, erscheint aber noch aus folgenden Gründen unglaubhaft:
Der SS-Hauptsturmführer Kramer wurde gemäss Verfügung des Chefs des Personalamtes beim WVHA vom 9.5.1944 - wie sich aus dem verlesenen Kommandanturbefehl Nr.4/44 des KL Natzweiler vom 18.5.1944 ergibt - erst im Mai 1944 von dem KL Natzweiler zum KL Birkenau als Kommandant versetzt. Zu dieser Zeit war der Angeklagte Dr. L. - nach seiner eigenen Einlassung - nicht mehr als SS-Lagerarzt in Birkenau tätig. Er war bereits wieder nach Auschwitz zurückversetzt und dort als Truppenarzt eingesetzt worden. Mit Kramer hatte er also überhaupt nichts zu tun. Es erscheint daher unwahrscheinlich, dass Kramer den Angeklagten Dr. L. überhaupt näher gekannt hat. Nach der letzten Einlassung des Angeklagten Dr. L. hat Kramer angeblich auf ein gegen ihn - Dr. L. - gerichtet gewesenes Verfahren wegen Häftlingsbegünstigung angespielt und dabei erklärt, er sei bestens über ihn orientiert. Dieses Verfahren lag jedoch nach der Einlassung des Angeklagten Dr. L. bereits einige Zeit zurück. Der ihm zugrunde liegende Vorfall hatte sich bereits lange vor der Versetzung des Kommandanten Kramer nach Birkenau abgespielt.
Nach der Darstellung des Angeklagten Dr. L. hatte er im März 1944 einen Kapo, der durch eine Misshandlung eine Netzhautablösung erhalten hatte, vom Lager Birkenau zum Stammlager in den HKB in einem PKW gebracht. Deswegen hatte ihn - so hat er angegeben - der damalige Lagerkommandant von Birkenau, Hartjenstein, gemeldet. Hartjenstein hatte beanstandet, dass er sich nicht von ihm abgemeldet habe. Der Standortarzt Dr. Wirths habe ihm deswegen - so hat Dr. L. weiter erklärt - Vorwürfe gemacht und ihn verwarnt. Er habe ihn wegen des Vorfalls als Lagerarzt in Birkenau abgelöst und ihn als Truppenarzt beim Stammlager eingesetzt.
Aus dieser Darstellung des Angeklagten Dr. L. ergibt sich, dass Dr. Wirths den Fall durch eine Versetzung unter der Hand erledigt hat. Er hat ihn aus dem Bereich des Lagerkommandanten Hartjenstein weggeholt, offensichtlich um die Möglichkeit weiterer Schwierigkeiten zwischen Hartjenstein und Dr. L. auszuschalten. Für ein kriegsgerichtliches Verfahren haben sich keine Anhaltspunkte ergeben. Weder der Angeklagte Höcker, der im Mai 1944 als Adjutant nach Auschwitz gekommen ist und gleichzeitig Personalsachbearbeiter wurde, noch ein anderer Angeklagter hat von einem solchen Verfahren irgendetwas gewusst. Nur der Angeklagte Boger hat erklärt, dass Dr. L. einmal wegen Häftlingsbegünstigung "angeschwärzt" worden sei. Von einem offiziellen Verfahren wegen Häftlingsbegünstigung wusste er jedoch nichts. Es entsprach auch der Einstellung des Standortarztes Dr. Wirths, was der Zeuge Dr. M. bestätigt hat, offizielle Verfahren gegen die ihm unterstehenden Ärzte "abzubiegen" und ohne Aufsehen zu erledigen.
Als Kramer nach Birkenau kam, war somit dieser Fall der angeblichen Häftlingsbegünstigung längst abgeschlossen. Es ist daher unwahrscheinlich, dass Kramer dem Angeklagten Dr. L., den er bis dahin kaum gekannt haben kann, den etwa zwei Monate zurückliegenden Fall, mit dem er gar nichts zu tun hatte, vorgehalten haben soll. Es fragt sich, wer ihm hiervon überhaupt berichtet haben soll. Dass dies Dr. Wirths getan haben soll, erscheint unwahrscheinlich. Denn sein Bestreben war es gewesen - wie die Versetzung des Dr. L. zeigt -, den Fall ohne Aufsehen zu erledigen und weitere Reibereien zwischen dem ihm unterstellten Arzt und dem Kommandanten von Birkenau auszuschalten. Unwahrscheinlich erscheint auch, dass Kramer als Hauptsturmführer den im Rang nur geringfügig unter ihm stehenden Obersturmführer Dr. L. mit Verhaftung und Abführung gedroht haben soll. Denn Dr. L. unterstand ihm als Arzt weder sachlich noch disziplinär. Der unmittelbare Vorgesetzte des Angeklagten Dr. L., von dem er seine Weisungen und Befehle erhielt, war der Standortarzt Dr. Wirths. Dieser war vom Kommandanten in Birkenau völlig unabhängig. Er unterstand sachlich dem WVHA, Amt D III. Kramer musste befürchten, bei einer eigenmächtigen Verhaftung des Angeklagten Dr. L. in Konflikt mit Dr. Wirths und event. dem WVHA - Amt D III zu kommen, da er dadurch in dessen Kompetenzen eingegriffen hätte. Aller Wahrscheinlichkeit nach hätte er allenfalls eine Meldung an Dr. Wirths über den Angeklagten Dr. L. gemacht, wenn sich dieser - nach seiner Meinung - disziplinwidrig oder ungehorsam gegen Befehle des Standortarztes gezeigt hätte. Denn auch der frühere Kommandant Hartjenstein hatte den Angeklagten Dr. L. nicht unmittelbar wegen der angeblichen Häftlingsbegünstigung zur Rede gestellt, sondern hatte den Fall nur gemeldet und deren Erledigung dem Vorgesetzten des Dr. L., dem Standortarzt Dr. Wirths überlassen. Das zeigt, dass man auch in Auschwitz die Zuständigkeit im Bereich des Führerkorps respektiert hat.
Ferner hat auch der Zeuge Dow K. den Angeklagten Dr. L. wiederholt beim Rampendienst gesehen. Er hat beobachtet, dass Dr. L. auch selektiert hat. Der bereits mehrfach erwähnte glaubwürdige Zeuge Dow K. hat den Angeklagten Dr. L. in der Hauptverhandlung wiedererkannt. Im Lager Birkenau kannte er seinen Namen nicht. Er wusste nur, dass er eine Zeitlang als zweiter Lagerarzt in Birkenau bei Dr. Mengele gewesen ist. Er hat ihn wiederholt im Theresienstädter Lager zusammen mit Dr. Mengele gesehen, Dr. L. hat bestätigt, dass er im Theresienstädter Lager Dienst gemacht hat. Der Zeuge K. hat den Angeklagten Dr. L. zutreffend charakterisiert. Er hat ihn als einen gemütlichen, väterlichen Mann geschildert, der bedächtig und mit langsamen Bewegungen auf der Rampe selektiert habe im Gegensatz zu Dr. Mengele, der dies mit eleganten und schnellen Bewegungen gemacht habe. Diese Beschreibung passt genau auf den Angeklagten Dr. L. nach dem Eindruck, den das Gericht in der Hauptverhandlung von ihm gewonnen hat. Das Gericht hat daher keine Zweifel, dass der Zeuge Dow K. den Angeklagten Dr. L. richtig identifiziert hat. Auch diese Beobachtungen des Zeugen Dow K. sprechen dagegen, dass Dr. L. vier- bis fünfmal nur unter Zwang selektiert hat.
Schliesslich hat das Gericht noch aus dem Verhalten des Angeklagten Dr. L. in der Hauptverhandlung den Eindruck gewonnen, dass er bezüglich des Zusammenstosses mit Kramer nicht die Wahrheit gesagt hat. Er wirkte sowohl bei seiner ersten Vernehmung zur Sache, bei der er behauptete, Kramer habe für ihn den Selektionsdienst übernommen, als auch bei seiner Aussage am 11.3.1965 ausserordentlich unsicher. Es entstand der Eindruck, dass er auf Fragen stets nach den für ihn günstigsten Antworten suchte, jedoch selbst nicht von der Richtigkeit seiner Angaben überzeugt war. Auf Vorhalte gab er ausweichende oder nicht überzeugende Antworten.
Aus all diesen Gründen hat das Schwurgericht dem Angeklagten Dr. L. nicht geglaubt, dass der von ihm behauptete Zusammenstoss mit Kramer auf der Rampe überhaupt stattgefunden hat.
Nur der Angeklagte Boger will im Juni oder Juli 1944 nach einem Besuch beim Lagerkommandanten in Birkenau, Kramer, bei dem Kramer aufgeregt gewesen sein soll, von dem Lagerführer Schwarzhuber erfahren haben, dass es zwischen Kramer und Dr. L. auf der Rampe eine Kontroverse gegeben habe, Dr. L. habe sich geweigert, zu selektieren, Kramer sei aggressiv geworden und Dr. L. habe unter dem Druck des Kramer dann doch selektiert.
Das Gericht hat dem Angeklagten Boger nicht geglaubt. In seiner eigenen Sache hat er in vielen Punkten die Unwahrheit gesagt. So hat er z.B. immer wieder betont, dass er in Auschwitz nie ein Gewehr getragen und nie einen Menschen erschossen habe, bis er schliesslich doch eingeräumt hat, durch Grabner zum Erschiessen von zwei Häftlingen gezwungen worden zu sein. Auffällig ist, dass er die Behauptung, ihm sei von Grabner in Gegenwart von Höss befohlen worden, zwei Häftlinge an der Schwarzen Wand zu erschiessen, kurz nach seiner Aussage zu Gunsten des Angeklagten Dr. L. aufgestellt hat. Nach Auffassung des Gerichts hat er durch die den Angeklagten Dr. L. begünstigende Aussage seine eigene Verteidigung durch Konstruierung einer für den Angeklagten Dr. L. angeblich vorhanden gewesenen Notstandssituation vorbereiten wollen. Seine Kenntnis von dem angeblichen Zusammenstoss zwischen Kramer und Dr. L. ist nach der Überzeugung des Gerichts ebenso erfunden, wie der angebliche Zwang Grabners ihm gegenüber.
Das Schwurgericht hat aus der Aussage des Zeugen Dow. K. und der insoweit glaubhaften Erklärung des Angeklagten Baretzki in Verbindung mit der Einlassung des Angeklagten Dr. L., dass er zum Rampendienst eingeteilt und zur Abwicklung von RSHA-Transporten zur Rampe hingegangen sei, die Überzeugung gewonnen, dass der Angeklagte Dr. L. - wie alle anderen zum Rampendienst eingeteilten Ärzte - befehlsgemäss - wenn auch widerstrebend - in einer unbestimmten Anzahl von Fällen aus RSHA-Transporten die angekommenen jüdischen Menschen selektiert, d.h. die Arbeitsfähigen für die Aufnahme in das Lager ausgesondert und die übrigen zur Gruppe der zum Tode bestimmten geschickt hat.
Da nicht mehr festzustellen war, wie oft der Angeklagte Dr. L. auf diese Weise Rampendienst versehen hat, musste sich das Gericht auch in diesem Fall auf die Feststellung von Mindestzahlen beschränken. Mit Sicherheit kann davon ausgegangen werden, dass der Angeklagte Dr. L. mindestens viermal selektiert hat. Das gibt er nämlich selbst zu. Bei diesen vier verschiedenen Vernichtungsaktionen sind nach Überzeugung des Gerichts mindestens jeweils tausend Menschen für den Gastod bestimmt und anschliessend in einer der Gaskammern getötet worden. Denn im Jahre 1944 waren - wie schon mehrfach ausgeführt - die Transporte durchschnittlich dreitausend Personen stark. Da nie mehr als 25% als arbeitsfähig ausgesondert worden sind, kann unter Berücksichtigung aller eventl. Schwankungen mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass mindestens tausend Personen aus diesen RSHA-Transporten getötet worden sind.
Die Feststellung, dass der Angeklagte Dr. L. im Anschluss an die durchgeführten Selektionen bei der Gaskammer Dienst gemacht und den Todeskampf der in der Gaskammer eingeschlossenen Opfer beobachtet hat, stützt sich auf folgendes:
Zunächst hat der Angeklagte Dr. L. bei seiner ersten Einlassung zur Sache indirekt zugegeben, dass zum Selektionsdienst des Arztes auch der Dienst an der Gaskammer gehört hat. Denn als er bei der ersten Einlassung noch entschieden in Abrede stellte, selbst selektiert zu haben und behauptete, Kameraden bzw. der Lagerkommandant Kramer habe für ihn den Selektionsdienst übernommen, wurde er befragt, warum er denn nicht selektiert habe, um möglichst viele Menschen zu retten. Seine Antwort darauf war, er habe deswegen nicht selektiert, weil er nicht mit zu den Gaskammern gewollt habe. Nach den Anweisungen befragt, die Dr. Wirths für den Selektionsdienst herausgegeben habe, hat der Angeklagte Dr. L. bei seiner Vernehmung zur Sache erklärt, es sei nur allgemein gesagt worden, dass die Arbeitsfähigen auszusondern seien und dass das Einwerfen des Gases überwacht werden sollte, damit den Desinfektoren beim Einschütten des Gases nichts passiere. Schon daraus ergibt sich, dass es Aufgabe der Ärzte war, auch an den Gaskammern Dienst zu machen.
Darüber hinaus hat der frühere Lagerkommandant Höss in seinen Aufzeichnungen über die nichtärztliche Tätigkeit der Ärzte im KL Auschwitz ausgeführt, dass die Ärzte bei dem Vernichtungsvorgang in der Gaskammer dabei zu sein hätten, um die vorgeschriebene Anwendung des Giftgases Zyklon B durch die SDGs zu überwachen und sich nach der Öffnung der Gaskammern davon zu überzeugen, dass die Vernichtung vollständig sei.
Ferner hat der Zeuge Kremer, der selbst als SS-Arzt im KL Auschwitz gewesen ist und dort auch für die Vernichtungsaktionen der RSHA-Juden eingesetzt worden ist, bekundet, dass die
Ärzte, die für den Rampendienst eingeteilt worden seien, auch Dienst im Krematorium und bei den Vergasungen hätten machen müssen. Der Zeuge selbst hat mehrfach Dienst an der Gaskammer verrichtet. Deswegen ist er bereits durch das Schwurgericht in Münster am 29.11.1960 wegen Beihilfe zum Mord in zwei Fällen zu insgesamt 10 Jahren Zuchthaus verurteilt worden.
Auch der Angeklagte Hofmann hat bestätigt, dass das Einwerfen des Zyklon B in die Gaskammern durch Ärzte überwacht worden sei.
Schliesslich haben die Zeugen Philipp Mü. und Pa., die im jüdischen Sonderkommando in den Krematorien tätig waren, glaubhaft bekundet, dass stets ein Arzt während des Vergasungsvorganges durch ein Guckloch den Todeskampf der eingeschlossenen Menschen beobachtet habe.
Aus all diesen Zeugnissen und der Einlassung des Angeklagten Dr. L. ergibt sich somit, dass stets ein zum Rampendienst eingeteilter Arzt auch Gaskammerdienst verrichten musste. Schon daraus ist der Schluss gerechtfertigt, dass der Angeklagte Dr. L., wenn er zum Rampendienst eingeteilt war und auch, was das Gericht als erwiesen ansieht, selektiert hat, anschliessend mit zur Gaskammer gefahren und dort den befohlenen Dienst gemacht haben muss.
Anders könnte es nur sein, wenn ausser dem Dr. L. noch ein zweiter Arzt zum Rampendienst eingeteilt gewesen wäre. Diese Möglichkeit scheidet jedoch in den vier genannten Fällen aus. Denn der Angeklagte Dr. L. hat bei seiner ersten Einlassung erklärt, dass nach der Massierung der Transporte ab Frühjahr 1944 jeweils nur noch ein Arzt zum Rampendienst eingeteilt worden sei. Dies erscheint glaubhaft. Er hat bei seiner ersten Einlassung auch angegeben, dass er in mindestens vier Fällen als einziger Arzt zum Rampendienst befohlen worden ist. Allerdings will er nach seiner ersten Einlassung in diesen vier Fällen nicht selektiert haben. Vielmehr soll Kramer den Selektionsdienst für ihn übernommen haben. Das hat ihm jedoch das Gericht von vornherein nicht geglaubt. Er selbst ist von dieser Einlassung später auch abgerückt. Seine Einlassung erscheint jedoch zumindest insoweit glaubhaft, dass er in den vier Fällen als einziger Arzt zum Rampendienst eingeteilt gewesen ist. Denn nach der glaubhaften Aussage des Zeugen Hi., der in der Güterabfertigung am Bhf. in Auschwitz tätig gewesen ist, kamen in der Zeit von Mai bis Juli 1944 allein aus Ungarn etwa 120 Güterzüge mit Juden an. Das bedeutet, dass an jedem Tag mindestens ein RSHA-Transport und an etwa 30 weiteren Tagen zusätzlich ein zweiter Transport angekommen sein muss. Es musste daher Tag für Tag, häufig auch nachts selektiert werden. Es kam wiederholt vor, dass ein Transport noch nicht abgewickelt war, wenn bereits der zweite Güterzug mit RSHA-Juden einlief. Das haben mehrere Zeugen bekundet. Hierbei muss noch in Betracht gezogen werden, dass ausser aus Ungarn auch noch aus anderen Teilen Europas RSHA-Transporte einliefen. Bei dieser Massierung der Transporte hätten die Ärzte nicht ausgereicht, wenn jeweils zwei Ärzte zum Rampendienst eingeteilt worden wären. Wenn der Angeklagte Dr. L. in Widerspruch zu seiner ersten Einlassung am 11.3.1965 erklärt hat, es sei noch ein zweiter Arzt dabei gewesen, so hat er dies offensichtlich nur erfunden, um seine Behauptung zu stützen, dass er nie bei den Gaskammern gewesen sei. Der Zeuge Pa. hat auch den Angeklagten Dr. L. bei einer der Gaskammern gesehen, als ein RSHA-Transport durch Gas getötet worden ist. Er hat damals den Angeklagten Dr. L. zwar nicht mit Namen gekannt, er hat ihn jedoch in der Hauptverhandlung wiedererkannt. Das Gericht ist überzeugt, dass er den Angeklagten Dr. L. zutreffend identifiziert hat. Denn der Zeuge hat spontan erklärt, dass dieser Angeklagte Arzt gewesen sei.
Aus alledem hat das Gericht die Überzeugung gewonnen, dass der Angeklagte Dr. L. in den mindestens vier Fällen, in denen er selektiert hat, auch Dienst an der Gaskammer verrichtet hat.
Auf weitere Zeugenaussagen, die den Angeklagten Dr. L. ebenfalls beim Selektionsdienst auf der Rampe gesehen haben wollen, hat das Gericht seine Feststellung nicht gestützt. So will der Zeuge Gi. den Angeklagten Dr. L. am 14.10.1944 beim Rampendienst gesehen haben. Bei dem RSHA-Transport, den Dr. L. selektiert habe, sei, so hat der Zeuge erklärt, auch seine Mutter gewesen. Dr. L. habe seine Mutter auf seine Bitten hin gerettet, aber viele andere ins Gas geschickt. Der Zeuge kannte den Angeklagten Dr. L. damals nicht. Er will seinen Namen von einem Kapo namens Hans erfahren haben. Es erscheint jedoch zweifelhaft, ob Dr. L. damals tatsächlich noch Rampendienst gemacht hat. Denn nach der Aussage des Zeugen Szy., der selbst als Arzt im Lager Birkenau gewesen ist, soll Dr. L. bereits im August 1944 nach Mauthausen versetzt worden sein.
Die Zeugin van der Hue. will den Angeklagten Dr. L. bei einer Lagerselektion im November 1944 gesehen haben. Auch diese Zeugin kannte den Angeklagten Dr. L. nicht. Sie will seinen Namen gehört haben, als eine Aufseherin "Guten Morgen, Dr. L." gesagt habe. Schon das erscheint unglaubhaft. Denn es ist nicht anzunehmen, dass die SS-Aufseherinnen die SS-Führer mit ihrem Namen angesprochen haben. Vor allem aber erscheint es im Hinblick auf die Aussage des Zeugen Dr. Szy. unwahrscheinlich, dass Dr. L. noch im November 1944 im Lager Birkenau gewesen ist. Die Zeugin verwechselt wahrscheinlich den Angeklagten Dr. L. mit einem anderen Arzt. Möglicherweise hat sie den Angeklagten auch bewusst zu Unrecht belastet.
Die Zeugin Z. hat behauptet, Dr. L. habe den RSHA-Transport, mit dem sie angekommen sei, selektiert. Dabei habe er sie mit einem Dolch in den Arm gestochen, als sie wieder zu ihrer Mutter, die Dr. L. zu den Arbeitsunfähigen geschickt habe, hätte zurücklaufen wollen. Einige Wochen später hätte er sie im Lager für die Gaskammer ausgesucht. Von der Blockältesten habe sie den Namen des Dr. L. erfahren. Die Zeugin hat den Angeklagten Dr. L. aber offensichtlich mit einem anderen SS-Führer verwechselt. Denn auf die Frage, ob sie ein Bild von Dr. L. habe, übergab die Zeugin dem Gericht eine Fotografie, die einen SS-Standartenführer und alten Kämpfer darstellt und behauptet, dass dies Dr. L. sei. Ihre Aussage war daher wertlos.
Auch die Zeugin Go., die unter anderem behauptet hat, Dr. L. habe sie unmittelbar nach ihrer Ankunft auf der Rampe in Birkenau für den Küchendienst ausgewählt, erscheint nicht zuverlässig. Bei dieser Zeugin handelt es sich um eine kranke nervenschwache Frau, die nach ihrer eigenen Aussage die meiste Zeit im Bett verbringen muss. Sie hat darüber, wie sie den Namen des Angeklagten Dr. L. erfahren haben will, eine etwas phantastische Geschichte erzählt. Zunächst will sie den Namen auf der Rampe gehört haben, als ein anderer SS-Führer denjenigen, der sie für den Küchendienst ausgesucht habe, mit Dr. L. angesprochen habe. Dann will sie den Namen Dr. L. ein zweites Mal im Duschraum am gleichen Tag gehört haben. Sie sei - so hat sie berichtet - aus dem Duschraum von einem Häftling herausgeholt und draussen befragt worden, wer sie während des Transports geschlagen habe. Er habe nämlich gesehen, dass sie auf dem Rücken Verletzungen von Schlägen gehabt habe. Der Häftling habe sie dann beruhigt und habe ihr gesagt, sie brauche keine Angst zu haben, er arbeite schon drei Jahre im Krematorium und sei einer der ihren. Er gehöre zum Krematoriumskommando. Er habe sie dann nach den näheren Umständen und nach ihren Eltern gefragt. Dann habe er ihr erklärt, wenn Dr. L. am Bahnhof gewesen sei, dann würden ihre Mutter und ihre Schwester nicht mehr lange leben. Sie würden noch am gleichen Tag getötet. Die Zeugin erklärte dann weiter, dass der Häftling eine einfarbige weisse Lageruniform getragen habe. Eine Mütze habe er nicht aufgehabt. Er sei der einzige Mann weit und breit gewesen.
Diese Schilderung der Zeugin enthält mehrere Unwahrscheinlichkeiten: Die Angehörigen des Krematoriumskommandos arbeiteten im Krematorium, jedoch nicht bei den Duschräumen. Sie waren von den anderen Häftlingen streng isoliert. Im Lager B II d war ihr Block, in dem sie untergebracht waren, besonders gesichert und für andere Häftlinge gesperrt. Als sie ihre Unterkunft in den Krematorien selbst hatten, fehlte ihnen überhaupt jeglicher Kontakt zu anderen Häftlingen. In den Krematorien arbeiteten sie unter Aufsicht. Es erscheint daher unglaubhaft, dass sich ein Angehöriger des Sonderkommandos zu einem Duschraum hat begeben können, in dem Frauen geduscht wurden.
Die neu angekommenen Menschen wurden ferner stets von SS-Männern oder weiblichen SS-Aufseherinnen zu den Duschräumen begleitet. Auch bei den Duschräumen war Aufsicht. Es erscheint völlig ausgeschlossen, dass ein männlicher Häftling trotz dieser Aufsicht eine Frau aus dem Duschraum hat herausrufen und mit ihr sprechen können. Den Namen des Dr. L. will die Zeugin durch den Häftling des Sonderkommandos während der Unterhaltung - das zweite Mal an diesem Tag - gehört haben. Nach ihrer Aussage hat sie dem Häftling selbst den Namen nicht gesagt. Wieso der Häftling, der gar nicht bei den Selektionen auf der Rampe dabeigewesen ist, gerade auf den Namen des Dr. L. gekommen sein soll, ist unerfindlich. Es ist auch nicht zu verstehen, warum der Häftling es gerade auf die Person des Dr. L. abgestellt haben soll, um die Tötung der Angehörigen der Zeugin als sicher anzunehmen. Denn allen Häftlingen in Auschwitz, die längere Zeit dort waren, war klar, dass die Juden, die nicht als arbeitsfähig ausgesondert waren, vergast würden. Sie waren zum Tode bestimmt. Dabei war es gleichgültig, wer als Arzt auf der Rampe die Selektionen machte. Im übrigen war gerade Dr. L., wie viele Zeugen bekundet haben, im Schutzhaftlager der menschlichste Arzt.
Schliesslich ist auch die Angabe der Zeugin, Dr. L. habe sie bereits auf der Rampe für den Küchendienst ausgesucht, nicht glaubhaft. Niemand hat bestätigt, dass bereits auf der Rampe Häftlinge durch die selektierenden Ärzte für den Küchendienst ausgesucht worden seien. In der Hauptverhandlung hat die Zeugin sogar angegeben, Dr. L. habe mit ihr bereits am Bahnhof Tests über ihre Eignung zum Küchendienst gemacht. Auch das ist unglaubwürdig. Nach vier bis sechs Wochen soll dann nach der Angabe der Zeugin Dr. L. sie zum Küchendienst ausgesucht haben, nachdem die Tests gut ausgefallen und in Ordnung gewesen seien. Früher hatte die Zeugin gegenüber ihrem Anwalt angegeben, dass die Tests am nächsten Tag (Blut- und Stuhlproben) gemacht worden seien. Später sei er gekommen und habe ihr gesagt, sie könne jetzt in der Küche arbeiten. Nach ihrer früheren Angabe will sie Dr. L. insgesamt dreimal gesehen haben. In der Hauptverhandlung gab sie an, sie habe ihn nur zweimal gesehen. Die Zeugin will 20 Jahre darauf gewartet haben, den Dr. L. wiederzusehen. Als sie in der Zeitung auf den Namen gestossen sei, habe sie - so hat die Zeugin weiter angegeben - zu ihrem Mann gesagt: "Das ist der Mann, den ich suche."
Bei diesen zum Teil phantasievoll erscheinenden und unwahrscheinlichen Angaben kann die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass die sehr kranke und nervenschwache Zeugin unbewusst seit ihrer Lagerzeit die Selektion, die für sie ohne Zweifel ein furchtbares Erlebnis gewesen sein muss, zu Unrecht auf Dr. L. projiziert, dessen Name sie vielleicht in irgendeinem Zusammenhang im Lager erfahren hat oder den sie vielleicht im Lager als einzigen SS-Führer mit Namen kennengelernt hat. Möglicherweise hat sie sich innerlich an diesen Mann geklammert und ihn unbewusst mit dem furchtbaren Erlebnis in Verbindung gebracht, weil ihr andere Namen nicht bekannt waren. Die Zeugin hat schliesslich auch zugegeben, dass sie sich den SS-Führer, der sie auf der Rampe selektiert habe, nicht genau angesehen habe. Denn sie habe schon vor der Uniform Angst gehabt. Sie wisse nur, dass er sich am Bahnhof hässlich benommen habe. Sie hat auch in der Hauptverhandlung eine andere Beschreibung dieses SS-Führers gegeben, als sie sie ihrem Anwalt gegenüber gemacht hat.
Insgesamt konnte das Schwurgericht nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass die Zeugin Go. nach ihrer Ankunft in Auschwitz tatsächlich den Angeklagten Dr. L. auf der Rampe beim Selektieren gesehen hat.
IV. Rechtliche Würdigung
Der Angeklagte Dr. L. hat in den mindestens vier festgestellten Fällen durch den Rampendienst und den Dienst an der Gaskammer während der Vernichtung der RSHA-Transporte die Vernichtungsaktionen und damit die Mordtaten der Haupttäter durch eigene Tatbeiträge gefördert. Die Auswahl der Arbeitsfähigen aus den RSHA-Transporten kann allerdings - für sich allein betrachtet - nicht als kausaler Beitrag für die Mordtaten angesehen werden. Denn die Arbeitsfähigen wurden anschliessend in das Lager aufgenommen und somit durch den Arzt, hier durch Dr. L., vor dem Tode vorläufig gerettet. Die Tätigkeit des Arztes auf der Rampe, hier des Angeklagten Dr. L., erschöpfte sich jedoch nicht in der blossen Auswahl der Arbeitsfähigen. Er hatte vielmehr über Leben und Tod aller jüdischen Männer und Frauen über 16 Jahren, die ihm nach der durchgeführten Vorselektion durch die unteren SS-Dienstgrade zur Selektion vorgeführt wurden, zu entscheiden. Zwar waren alle jüdischen Menschen durch den Befehl Hitlers zum Tode bestimmt worden. Dem Arzt blieb jedoch auf der Rampe ein Ermessensspielraum, einen Teil der Todgeweihten als arbeitsfähig zu beurteilen und damit - zumindest vorläufig - vor dem Tode zu erretten. Dadurch, dass er einen Teil der an ihm vorbeimarschierenden Menschen als "arbeitsunfähig" beurteilte und mit der Hand oder einem sonstigen Zeichen zu der Gruppe der für den Gastod bestimmten Menschen schickte, gab er diese Menschen endgültig für die Tötung frei und setzte somit eine - in der Gesamtaktion vorgesehene - notwendige Bedingung für ihre Tötung. Die Beurteilung des Arztes auf der Rampe war somit mitursächlich für die Tötung der Opfer. Die Ärzte, hier der Angeklagte Dr. L., förderten die Vernichtungsaktionen auch dadurch, dass sie die unteren an den Aktionen beteiligten SS-Dienstgrade psychisch in ihrem Willen, ebenfalls die Vernichtungsaktionen zu unterstützen, stärkten. Zwar bedurfte ein Teil der verrohten SS-Männer dieser psychischen Stärkung nicht. Sie nahmen, ohne dass es noch eines besonderen Antriebes von aussen bedurft hätte, bereitwillig schon deshalb an den Aktionen teil, weil sie dafür Sonderrationen bekamen. Dies kam in der Aussage des Zeugen Kremer klar zum Ausdruck. Dieser Zeuge hat geschildert, wobei er dies in makabrer Weise sogar noch als "natürlich" ansah, dass viele SS-Männer sehr darauf bedacht gewesen seien, diese Zulagen zu erhalten und sich zum Rampendienst gedrängt hätten. Die Zulagen waren diesen SS-Männern wichtiger als das Leben von Tausenden von Menschen.
Andere SS-Männer halfen jedoch nur zögernd und widerstrebend. Ihr Gewissen war noch nicht völlig zum Schweigen gebracht. Sie wurden von Zweifeln gequält und waren über das furchtbare Geschehen entsetzt. Das ergibt sich aus den Aufzeichnungen des früheren Lagerkommandanten Höss, der mehrfach betont hat, dass er durch seine eigene Anwesenheit auf der Rampe die ihm unterstellten SS-Angehörigen "zum psychischen Durchhalten" hätte zwingen müssen.
Auf die schwankenden und zögernden unteren SS-Dienstgrade auf der Rampe musste das "Beispiel" des Arztes, der sich nicht scheute, die Menschen in die Gaskammern zu schicken, negativ wirken. Denn jedermann weiss, dass es Aufgabe eines Arztes ist, Menschenleben zu erhalten und kranke Menschen zu heilen und vor dem Tode zu bewahren. Deswegen geniesst der Arzt auch Ansehen und hohe Achtung in weiten Bevölkerungskreisen. Von ihm erwartet man, dass sein Handeln von ethischen und sittlichen Grundsätzen bestimmt wird. Für die SS-Unterführer und SS-Männer waren die Ärzte zudem noch als SS-Führer Vorgesetzte, nach deren Vorbild sie sich zu richten hatten. Wenn sie nun sahen, dass die Ärzte keine Hemmungen zeigten, an den Vernichtungsaktionen mitzuwirken, musste es ihnen nach der Überzeugung des Gerichts leichter fallen, ihre Bedenken wegen einer Mitwirkung an der Massentötung jüdischer Menschen zu überwinden und ihr Gewissen zum Schweigen zu bringen. Sie wurden somit durch das negative Beispiel der Ärzte darin bestärkt, ebenfalls an den Vernichtungsaktionen mitzuwirken. Das kann auch dem Angeklagten Dr. L. bei seinem Bildungsgrad und seiner Intelligenz nicht verborgen geblieben sein. Er war sich dessen nach Überzeugung des Gerichts auch durchaus bewusst.
Schliesslich hat der Angeklagte Dr. L. auch durch den Dienst an der Gaskammer einen kausalen Beitrag zu den Massentötungen geleistet. Durch das Zeichen an die Desinfektoren, das Zyklon B einzuwerfen, hat er eine Mitursache für den Tod der Opfer gesetzt, weil das Zyklon B erst auf dieses Zeichen hin eingeworfen wurde und somit der Tod der Opfer erst auf dieses Zeichen hin herbeigeführt worden ist. Durch die Überwachung der Desinfektoren hat er für einen reibungslosen Ablauf der Vernichtungsaktionen in der Gaskammer gesorgt. Denn ohne diese ärztliche Überwachung hätte man die Desinfektoren das Gift wegen der Gefährlichkeit des Zyklon B aus Sorge um ihr Leben nicht einwerfen lassen.
Schliesslich gehörte auch die Beobachtung des Todeskampfes und die Feststellung des Todes der Opfer zu einem Bestandteil der gesamten Vernichtungsaktionen, ohne die man die Tötungsaktionen nicht ohne weiteres auf diese Weise hätte durchführen können. Beides war somit ebenfalls eine Bedingung für die Tötung der Opfer, die nicht hinweggedacht werden kann.
Der Angeklagte Dr. L. hat diese kausalen Tatbeiträge zu den Vernichtungsaktionen auf Befehl seines Vorgesetzten Dr. Wirths geleistet. Da er Angehöriger der Waffen-SS gewesen ist, findet bei ihm ebenfalls §47 MStGB Anwendung.
Der Angeklagte Dr. L. hat klar erkannt, dass die Befehle an der Massentötung jüdischer Menschen durch den Selektionsdienst und den Dienst an der Gaskammer mitzuwirken, ein allgemeines Verbrechen bezweckten. Er hat selbst keinen Zweifel daran gelassen, dass er die Tötung der unschuldigen jüdischen Menschen als Verbrechen angesehen hat. Auch bei ihm stellt sich daher die Frage, ob er als Mittäter oder nur als Gehilfe zu bestrafen ist.
Die Beweisaufnahme hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Angeklagte Dr. L. die Tötung der jüdischen Menschen innerlich bejaht und sie als eigene Taten gewollt hat. Aus dem gesamten Verhalten des Angeklagten im KL Auschwitz und später in anderen Konzentrationslagern hat das Gericht vielmehr die Überzeugung gewonnen, dass Dr. L. innerlich ablehnend den Vernichtungsaktionen gegenüberstand und nur widerstrebend den befohlenen Selektions- und Gaskammerdienst versehen hat.
Im Lager selbst hat sich der Angeklagte als Lagerarzt den Häftlingen gegenüber anständig verhalten. Nach der Aussage des glaubwürdigen Zeugen Dr. F., der als Häftlingsarzt den Angeklagten Dr. L. gut gekannt hat, gehörte Dr. L. zu den "anständigen" Menschen. Der Zeuge hat erklärt, dass die Häftlinge den Angeklagten für einen "Ehrenmenschen" gehalten hatten. Er habe nicht nur Funktionshäftlinge, sondern auch die Kranken gut behandelt. Selektionen habe es im Lager - so hat der Zeuge weiter bekundet - nicht mehr während der Zeit, in der der Angeklagte Dr. L. Lagerarzt gewesen sei, gegeben. Auch der Zeuge Dr. Bej., der als Häftlingsarzt im Zigeunerlager gewesen ist, konnte nur Gutes über den Angeklagten Dr. L. berichten. Dr. L. habe sich einmal - so hat der Zeuge Dr. Bej. berichtet - längere Zeit mit dem Häftlingsarzt Dr. Eppstein unterhalten. Für sie sei das eine aussergewöhnliche Angelegenheit gewesen. Denn sonst hätten sich die SS-Ärzte kaum mit den Häftlingsärzten unterhalten. Dr. Eppstein habe ihm - dem Zeugen - nach dem Gespräch erklärt, dass Dr. L. ein "anständiger Kerl" sei. Er habe ihm berichtet, dass Dr. L. in den Krankenbau B II f als Vertreter des Dr. Thilo gekommen sei und dort die Selektionen (d.h. die Auswahl der schwachen und arbeitsunfähigen Häftlinge zur Vergasung) eingestellt habe. Dr. L. habe sogar mit jüdischen Häftlingsärzten zusammen kranke Häftlinge operiert. Ihm - dem Zeugen Dr. Bej. - sei später nach der Befreiung von jüdischen Ärzten aus Israel bestätigt worden, dass Dr. L. den jüdischen Ärzten sogar zusätzliche Verpflegung verschafft habe.
Der Zeuge Sn., der vom 4.4.1943 - 1.8.1943 als Häftlingsarzt im Zigeunerlager gewesen ist, hat glaubhaft bekundet, dass im Zigeunerlager, nachdem Dr. Mengele wegen einer Fleckfiebererkrankung als Lagerarzt ausgefallen und von Dr. L. vertreten worden sei, eine deutliche Entspannung eingetreten sei. Dr. L. habe die Häftlingsärzte zu einer Besprechung versammelt, wobei er ihnen erklärt habe, dass er ihnen bei ihrer schweren Arbeit und den kranken Häftlingen helfen wolle. Er habe dann während vier bis sechs Wochen, in denen er im Zigeunerlager gewesen sei, alles getan, um den Häftlingen ihr schweres Los zu erleichtern.
In ähnlicher Weise hat sich der Zeuge Dr. Szy., der ebenfalls Arzt im Lager Birkenau gewesen ist, über den Angeklagten Dr. L. geäussert. Dr. L. sei - so hat er erklärt - ein Mensch und ein richtiger Arzt gewesen. Er habe für die kranken Häftlinge sogar Medikamente von irgendeiner Stelle ausserhalb des Lagers besorgt. Sie - die Häftlingsärzte - hätten sich noch gewundert, dass er sich wegen der Häftlinge solchen Gefahren aussetze. Bei den Häftlingen hätte er keinen Unterschied nach Nationen gemacht. Erst unter Dr. L. hätten die Häftlingsärzte anfangen können, die Kranken zu retten. Bei Dr. Mengele sie dies nicht möglich gewesen.
Die Zeugen Luise Liar., Nei., Schw., Ar., Ge. und Ko. haben über das Verhalten des Angeklagten Dr. L. im Konzentrationslager Ravensbrück nur Günstiges berichtet. Nach ihren Aussagen hat sich der Angeklagte auch in diesem Lager anständig und menschlich gegenüber den Häftlingen verhalten und ihnen geholfen, wo er nur konnte. Er hat z.B. Frau Salversen bei der Übermittlung von Nachrichten an Rechtsanwalt Hjort, die von wesentlicher Bedeutung für die Gefangenenbetreuung waren, geholfen. Wie die Zeugin Nei. berichtet hat, hat sich der Angeklagte im KL Ravensbrück sogar geweigert, arbeitsunfähige und schwache Häftlinge für den Gastod auszusondern. Dr. L. hat nach der Aussage dieser Zeugin erklärt, "er mache die Schweinerei nicht mit. Es gäbe genug Schweinereien, die er mitansehen müsse". Deswegen sei Dr. L. noch am selben Tage versetzt worden. Auch der Zeuge Ge. hat gehört, wie sich Dr. L. geäussert hat, "er mache die Auschwitzer Methoden (in Ravensbrück) nicht mit".
Demgegenüber hat kein zuverlässiger Zeuge bekundet, dass sich der Angeklagte Dr. L. im KL Auschwitz bzw. Birkenau anders als von den obengenannten Zeugen geschildert, verhalten hätte. Ausser den bereits oben erwähnten Zeugen, deren Aussagen dem Gericht nicht zuverlässig erschienen, hat noch der Zeuge Mir. den Angeklagten Dr. L. belastet. Er will ihn einmal auf dem Lagerabschnitt B III (Lager Mexiko) dabei beobachtet haben, wie er nackte Frauen selektiert habe. Das Gericht konnte jedoch nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass der Zeuge den Angeklagten Dr. L. nicht mit einem anderen SS-Arzt oder SS-Führer verwechselt hat. Der Zeuge hat bei der Gegenüberstellung mit dem Angeklagten auf Dr. L. gezeigt und etwas unsicher gemeint, er wisse nicht, ob das L. sei oder nicht. Erst anschliessend hat er behauptet, er habe ihn beim Selektieren im Lager Mexiko gesehen. Den Namen "L." habe er damals von Häftlingen erfahren.
Zunächst kann nicht ausgeschlossen werden, dass die anderen Häftlinge, die dem Zeugen den Namen "L." genannt haben, irrtümlich einen anderen SS-Führer als den Dr. L. bezeichnet haben. Das Gericht hat keine Möglichkeit zu überprüfen, ob die anderen Häftlinge einwandfrei den Dr. L. gekannt haben. Das erscheint nicht zweifelsfrei, weil das Lager Mexiko noch nicht fertig ausgebaut war und nur vorübergehend belegt worden ist. Die meisten Häftlinge, die sich auf diesem Lagerabschnitt aufhielten, blieben dort nur kurze Zeit.
Dass der Zeuge nach über zwanzig Jahren noch so genau den SS-Führer in seiner Erinnerung hat, den er nur einmal und zwar nur flüchtig gesehen haben kann - der Zeuge hat selbst nicht an der Selektion teilgenommen, sondern sie nur aus einer gewissen Entfernung (er gibt an aus 30 m) beobachtet -, dass er ihn heute irrtumsfrei wiedererkennen kann, erscheint sehr unwahrscheinlich. Dem vermeintlichen Wiedererkennen in der Hauptverhandlung kann daher kein Gewicht beigemessen werden. Der Zeuge war sich selbst auch nicht sicher, wie sich aus seiner Frage beim Anblick des Angeklagten Dr. L. ergibt. Hiervon abgesehen musste der Zeuge, der zunächst gemeint hatte, dass unter den nackten Frauen auch arbeitsunfähige gewesen seien, die sicher liquidiert worden seien, auf näheres Befragen einräumen, dass er nicht sicher wisse, ob die Frauen für den Gastod oder für einen Transport ausgesucht worden seien.
Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass der Angeklagte Dr. L. nach den übereinstimmenden Aussagen einer Reihe von Zeugen, insbesondere von früheren Häftlingsärzten, sich im Lager Auschwitz und Birkenau anständig, menschlich und hilfsbereit gegenüber allen Häftlingen - auch den jüdischen Häftlingen - verhalten hat und ihnen, soweit es in seiner Macht stand, geholfen hat. Die üblichen Selektionen arbeitsunfähiger und schwacher Häftlinge im Lager hat er während seiner Zeit unterbunden.
Bei dieser Einstellung und diesem Verhalten des Angeklagten Dr. L. im Lager ist der Schluss gerechtfertigt, dass er auch die Tötung der sog. RSHA-Juden abgelehnt und nur widerstrebend an den Vernichtungsaktionen teilgenommen hat. Andererseits bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Angeklagte Dr. L. nur deswegen den Selektionsdienst und den Dienst an den Gaskammern verrichtet hat, um einer wirklichen oder vermeintlichen Gefahr für Leib oder Leben zu entgehen. Seine Einlassung, dass ihn der Kommandant von Birkenau, Kramer, in vier bis fünf Fällen hierzu gezwungen hätte, ist - wie oben im einzelnen ausgeführt - unglaubhaft. Dass er von seinem unmittelbaren Vorgesetzten, dem Standortarzt Dr. Wirths, unter Drohung mit gegenwärtiger, auf andere Weise nicht abwendbarer Gefahr für Leib oder Leben zum Rampendienst befohlen worden sei, hat er selbst nicht behauptet. Er hat vielmehr eindeutig erklärt, dass Dr. Wirths ihm in krasser Form nicht gedroht habe.
Hiervon abgesehen, hat die Beweisaufnahme ergeben, dass es nicht die Art des Standortarztes Dr. Wirths gewesen ist, seine ihm untergeordneten Ärzte zum Rampendienst zu zwingen. Nach der glaubhaften Aussage des Zeugen Dr. M. hat sich einmal ein Arzt namens Delmotte geweigert, den Selektionsdienst auf der Rampe zu versehen. Delmotte war ein junger Arzt. Er war zunächst dem hygienischen Institut zugeteilt worden, ohne dass er jedoch von diesem gebraucht wurde. Dann war er zum Standortarzt kommandiert worden, damit er beim Selektionsdienst aushelfe. Delmotte weigerte sich jedoch gegenüber dem Standortarzt, zu selektieren. Wie der Zeuge Dr. M. weiter glaubhaft versichert hat, zeigte Dr. Wirths Verständnis für den jungen Arzt. Er drohte ihm nicht und zwang ihn auch nicht zum Selektionsdienst. Er liess dem jungen Arzt Zeit zum Überlegen. Dann versuchte er, ihn mit Argumenten zu überzeugen. Sein Hauptargument war, dass das Lager überbelegt werde, wenn man alle jüdischen Menschen in das Lager hineinlasse. Dann würden sie sowieso sterben. Der Gastod sei leichter als der langsame Tod im Lager. Auch die anderen SS-Ärzte redeten auf Delmotte auf gleiche oder ähnliche Weise ein. Delmotte beugte sich schliesslich diesen Argumenten. Der Zeuge Dr. M. meinte jedoch, dass Delmotte nichts passiert wäre, wenn er auf seiner Weigerung bestanden hätte. Der Chef in Berlin (Dr. Lolling vom Amt D III) hätte ihn wahrscheinlich zu einem anderen Kommando versetzt. Auch Dr. Wirths hätte gegen Delmotte kaum ein offizielles Verfahren eingeleitet. Denn dem Standortarzt Dr. Wirths sei es unangenehm gewesen, solche Verfahren einzuleiten.
Das Schicksal des Zeugen Dr. M. in Auschwitz zeigt ebenfalls, dass ein Arzt, wenn er wollte, vom Selektionsdienst freigestellt werden konnte, ohne dass ihm irgendwelche Nachteile entstanden. Der Zeuge, der als Arzt beim hygienischen Institut in Auschwitz tätig war, wurde ebenfalls von Dr. Wirths aufgefordert, Selektionsdienst zu machen. Der Zeuge, der damals nur den Rang eines SS-Unterscharführers hatte, lehnte dies jedoch ab. Er fuhr - wie er glaubhaft geschildert hat - ohne Erlaubnis seiner Vorgesetzten nach Berlin und sprach im Amt D III des WVHA vor. Dort gelang es ihm, mit Dr. Lolling, dem Chef des Amtes D III und Vorgesetzten des Standortarztes zu sprechen. Er erklärte ihm, dass er nicht selektieren könne, Dr. Lolling hatte hierfür Verständnis. Er erklärte dem Zeugen, dass er das auch nicht könne. Dann sorgte er dafür, dass Dr. M. vom Selektionsdienst befreit wurde. Irgendwelche Nachteile sind dem Zeugen hieraus nicht entstanden.
Auch der Zeuge Ju., der als SS-Unterführer in der Lagerapotheke eingesetzt war, hat sich Dr. Wirths gegenüber geweigert, eine befohlene Arbeit zu verrichten, ohne dass ihm hieraus Nachteile entstanden sind. Der Zeuge sollte - wie er glaubhaft geschildert hat - auf Befehl des Dr. Wirths die Häftlinge, die den Leichen der getöteten jüdischen Menschen die Goldzähne zu ziehen hatte, bei ihrer Arbeit beaufsichtigen. Der Zeuge ist einmal mit den zu diesem Dienst eingeteilten Häftlingen zur Gaskammer bzw. dem Krematorium gegangen. Dort blieb er jedoch vor dem Krematorium stehen, um nicht die Arbeit der Häftlinge im Krematorium mitansehen zu müssen. Am nächsten Tag ging er zu Dr. Wirths und erklärte ihm, dass er die befohlene Beaufsichtigung der Häftlinge nicht machen könne. Dr. Wirths habe zwar - so hat der Zeuge weiter bekundet - "getobt" und geschrien und habe ihm erklärt, er könne im fünften Kriegsjahr keine Rücksichten mehr auf seine Sentimentalitäten nehmen. Er hat dann aber den Zeugen nicht mehr für diesen Dienst eingesetzt. Der Zeuge Ju. hat kurz nach dieser Unterredung eine Dienstreise nach Berlin dazu benutzt, um im Vorzimmer des Dr. Lolling wegen dieser Angelegenheit mit zwei Oberscharführern zu sprechen und um seine Versetzung zu bitten. Zwei bis drei Wochen später wurde er tatsächlich von Auschwitz nach Landsberg versetzt, ohne dass ihm sonstige Nachteile entstanden sind.
Schliesslich hat der Zeuge Lil., der als Häftlingsschreiber im SS-Revier eingesetzt war und daher Gelegenheit hatte, den Standortarzt Dr. Wirths näher kennenzulernen, gemeint, dass Dr. Wirths, wenn sich ein Arzt geweigert hätte zu selektieren, gesagt hätte: "Endlich ein Mensch mit Charakter!"
Aus all dem folgt, dass für Dr. L. keine Gefahr für Leib oder Leben bestanden hätte, wenn er sich dem Rampendienst oder dem Gaskammerdienst hätte entziehen wollen. Es liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sich Dr. L. irrig vorgestellt hat, ihm drohe Gefahr für Leib oder Leben, wenn er versuche, sich dem Rampendienst oder dem Dienst an der Gaskammer auf irgendeine Weise zu entziehen, und dass er nur wegen dieser vermeintlichen Gefahr selektiert und Gaskammerdienst verrichtet hat. Er hat zwar zuletzt behauptet, dass er nur auf Grund der angeblichen Drohung des Lagerkommandanten Kramer selektiert habe. Dass jedoch von Kramer eine solche Drohung nie ausgegangen ist, sondern nur von dem Angeklagten Dr. L. erfunden worden ist, ist oben bereits ausgeführt worden.
Auf eine von anderer Stelle drohende Leibes- oder Lebensgefahr hat sich der Angeklagte Dr. L. nicht berufen. Für ihn bestand kein Anlass, von seinem unmittelbaren Vorgesetzten, dem Standortarzt Dr. Wirths, eine Gefahr für Leib oder Leben zu fürchten. Nach seiner eigenen Einlassung sollte er einmal auf Wunsch eines Lagerführers eines Nebenlagers die Arbeitsunfähigkeit einiger Häftlinge bestätigen, damit diese vergast werden könnten. Er weigerte sich jedoch mit dem Hinweis, dass es seine Aufgabe sei, Menschenleben zu erhalten. Man sollte die Häftlinge besser ernähren, dann kämen sie auch wieder zu Kräften. Der Standortarzt Dr. Wirths erfuhr nach der Einlassung des Angeklagten Dr. L. von dieser seiner Äusserung und seiner Weigerung, die Arbeitsunfähigkeit einiger Häftlinge zu bestätigen. Er machte jedoch dem Angeklagten Dr. L. deswegen keine Vorhaltungen und liess die Sache auf sich beruhen. Dr. L. hatte lediglich - wie er angab - den Eindruck, dass sich Dr. Wirths nach diesem Vorfall ihm gegenüber reserviert verhalten habe.
Auch aus der Meldung des Lagerkommandanten Hartjenstein wegen der Behandlung eines Kapos waren dem Angeklagten Dr. L. keine Nachteile entstanden. Dr. Wirths hatte ihn im Gegenteil, was für ihn nur von Vorteil sein konnte, als Lagerarzt abgelöst und als Truppenarzt, also in einer viel angenehmeren Tätigkeit, eingesetzt.
Nach der Überzeugung des Gerichts war der Angeklagte Dr. L. zu schwach, um sich gegen eine Mitwirkung bei den Vernichtungsaktionen zu sträuben. Er ist aus einer Befehlsergebenheit heraus den bequemeren Weg des geringsten Widerstandes gegangen, um sich nicht irgendwelchen Unannehmlichkeiten auszusetzen, jedoch nicht, weil ihm eine wirkliche - oder vermeintliche - Gefahr für Leib oder Leben gedroht hat. Dafür spricht auch, dass er sich im Lager Ravensbrück schliesslich dazu durchgerungen hat, seine Mitwirkung am Selektionsdienst zu verweigern. Irgendwelche Gefahren für Leib oder Leben sind ihm hierdurch nicht entstanden. Er ist lediglich in ein anderes Lager versetzt worden.
Der Angeklagte Dr. L. hat durch den geschilderten Selektionsdienst und den Dienst an der Gaskammer die Mordtaten der Haupttäter vorsätzlich gefördert.
Denn nach den getroffenen Feststellungen hat er das Bewusstsein gehabt, durch die geschilderten Tätigkeiten die Vernichtungsaktionen zu fördern. Unerheblich ist, dass er die Massentötungen jüdischer Menschen innerlich abgelehnt und seine Tatbeiträge nur widerstrebend geleistet hat. Denn entscheidend ist allein, dass er erkannte, durch seine Tatbeiträge die Haupttaten zu fördern und dass er in diesem Bewusstsein durch Handlungen, die von seinem Willen abhängig waren, seine Tatbeiträge geleistet hat (vgl. RGSt. 56, 71). Er hat auch die Tatumstände gekannt, die den Beweggrund dieser Massentötung als niedrig kennzeichnen. Denn er wusste, dass die jüdischen Menschen nur wegen ihrer Abstammung als Angehörige einer sog. minderwertigen Rasse getötet wurden. Da er selbst mit in der Gaskammer gewesen ist und den Todeskampf der Opfer in der Gaskammer beobachtet hat, nahm er auch Kenntnis von den gesamten Umständen, die die Tötungsart als grausam kennzeichnen.
Nach der gesamten Sachlage kann es auch nicht zweifelhaft sein, dass er, da er während seiner Anwesenheit auf der Rampe und bei der Gaskammer die Täuschung der Opfer unmittelbar selbst miterleben musste, auch Kenntnis von den Umständen genommen hat, die die Tötungen als heimtückisch erscheinen lassen.
Irgendwelche Rechtfertigungs- oder sonstigen Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich.
Der Angeklagte Dr. L. war daher wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zu gemeinschaftlichem Mord in mindestens vier Fällen (§§47, 49, 211, 74 StGB) begangen jeweils in gleichartiger Tateinheit an mindestens eintausend Menschen (§73 StGB) zu verurteilen.
V. Hilfsbeweisanträge
Der Hilfsbeweisantrag des Verteidigers des Angeklagten Dr. L., Herrn Speer in der alliierten Haftanstalt in Berlin Spandau darüber als Zeugen zu vernehmen, dass die aus den Vernichtungsmassnahmen in Auschwitz herausgenommenen ungarischen Juden zum grossen Teil in den Rüstungsprozess einzuschalten waren, war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da die in das Wissen des Zeugen gestellten Tatsachen so behandelt werden können, als wären sie wahr.
Aus den gleichen Gründen war der weitere Hilfsbeweisantrag des Verteidigers des Angeklagten Dr. L. abzulehnen, Herrn Knittel, ... , als Zeugen darüber zu vernehmen, dass es Aufgabe des weltanschaulichen Schulungsleiters war, die SS-Angehörigen im nationalsozialistischen Sinne auszurichten und sie zu Instrumentalisten des nationalsozialistischen Regimes zu machen. Das Schwurgericht hat bereits als wahr unterstellt, dass die Einheit 500, bei der der Angeklagte Dr. L. vom 11.10.1943 bis zum 15.12.1943 Dienst getan hat, eine Bewährungseinheit gewesen ist. Der hilfsweise beantragten Beiziehung der Akte "Vowinckel-Verlag/Bundesprüfstelle" beim Bundesverwaltungsgericht in Berlin zum Beweis für die Existenz der Einheit 500 bedurfte es daher nicht. Der Hilfsantrag des Verteidigers des Angeklagten Dr. L., den Zeugen Konrad Finkelmeier darüber zu vernehmen,
1. dass Dr. L. sich mit allen Mitteln von dem Verlangen zu drücken versucht habe, die männlichen Zigeuner in Ravensbrück zu sterilisieren; er habe deshalb mit dem Standortarzt Dr. Frommer einen Zusammenstoss gehabt,
2. dass den Zigeunern von SS-Leuten erklärt worden sei, sie würden entlassen, wenn sie sich sterilisieren liessen,
3. dass dies die Zigeuner geglaubt hätten, obwohl Dr. L. und Finkelmeier gesagt hätten, dass sie dies nicht glauben dürften,
war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da die in das Wissen des Zeugen Finkelmeier gestellten Tatsachen zu Gunsten des Angeklagten Dr. L. als wahr unterstellt werden können.
VI. Strafzumessung
Die Angehörigen des ärztlichen Dienstes hatten eine wichtige Funktion im Ablauf der Vernichtungsaktion zu erfüllen. Sie, deren Aufgabe die Heilung kranker Menschen und die Erhaltung des Lebens ist, stellten ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in den Dienst eines verbrecherischen Systems. Auf der Rampe wirkten sie an exponierter Stelle bei den Vernichtungsaktionen mit und trugen dazu bei, dass die anderen SS-Angehörigen, denen sie als Akademiker und SS-Führer hätten Vorbilder sein müssen, ihre Hemmungen leichter überwinden und ihr Gewissen leichter zum Schweigen bringen konnten, nachdem ihnen die Mitwirkung an den Massenmorden befohlen worden war. Besonders schwer fällt die ärztliche Tätigkeit an der Gaskammer ins Gewicht. Hier standen die Angehörigen des ärztlichen Dienstes in unmittelbarer Nähe des grauenhaften Geschehens. Der erschütternde und furchtbare Todeskampf der in der Gaskammer eingeschlossenen Menschen hätte spätestens so starke Hemmungsvorstellungen bei den Angehörigen des ärztlichen Dienstes hervorrufen müssen, dass eine Mitwirkung für sie nicht mehr hätte in Frage kommen dürfen. Sie haben aber diese Hemmungen und jegliche sittlichen und moralischen Bedenken überwunden und ihr Gewissen zum Schweigen gebracht. Auch bei der Gaskammer haben sie als Angehörige des ärztlichen Dienstes durch ihr negatives Beispiel dazu beigetragen, dass andere SS-Angehörige ihre sittlichen und moralischen Hemmungen leichter überwinden konnten. Denn auch hier hatten sie an exponierter Stelle eine wichtige Funktion im gesamten Ablauf der Vernichtungsaktion zu erfüllen. Der Unrechtsgehalt ihrer Tatbeiträge ist daher sehr hoch.
Es erschien kaum vertretbar, die Beihilfehandlungen der Angehörigen des ärztlichen Dienstes zu den Massenmorden mit geringeren Strafen zu ahnden, als die Beihilfehandlungen der unteren SS-Dienstgrade. Wenn das Schwurgericht gleichwohl beim Angeklagten Dr. L. die im Gesetz vorgesehene Mindeststrafe von 5 Jahren Zuchthaus für jede der mindestens vier festgestellten gemeinschaftlichen Beihilfehandlungen zu den festgestellten Mordtaten, durch die jeweils 1000 Menschen getötet worden sind, für eine ausreichende Sühne angesehen hat, so deswegen, weil der Angeklagte Dr. L. nach seiner Persönlichkeit aus dem Rahmen der im KL Auschwitz tätig gewesenen SS-Angehörigen herausfällt und gewichtige Strafmilderungsgründe das Mass seiner Schuld geringer erscheinen lassen.
Der Angeklagte Dr. L. hat den Vernichtungsaktionen ablehnend gegenüber gestanden und seine Beihilfe zu den Mordtaten nur widerstrebend geleistet. Im KL Auschwitz war er noch zu schwach, um sich einer Mitwirkung an den Massenmorden zu entziehen. Diese menschliche Schwäche kann seine Handlungsweise zwar nicht entschuldigen, sie findet aber eine gewisse Erklärung darin, dass er von einer Bewährungseinheit in das KL Auschwitz versetzt worden war. Im Hinblick auf die Zeit bei der Bewährungseinheit mag ihm im KL Auschwitz noch der Mut gefehlt haben, nach einem Weg zu suchen, der ihm - ohne Gefahr für Leib oder Leben - erspart hätte, am Tode Tausender unschuldiger jüdischer Menschen mitschuldig zu werden. Für ihn spricht aber, was ihm das Schwurgericht hoch angerechnet hat, dass er später im KL Ravensbrück den Mut gefunden hat, die Mitwirkung bei der Aussonderung und Vergasung kranker und arbeitsunfähiger Häftlinge zu verweigern. Dort hat er sich schliesslich eindeutig von den "Auschwitzer Methoden" distanziert und klar zu erkennen gegeben, dass er nicht mehr gewillt war, an Verbrechen mitzuwirken. Er hat in Kauf genommen, das Wohlwollen seiner Vorgesetzten zu verlieren und in andere Lager versetzt zu werden. Er hat vielen Häftlingen das Leben gerettet und ist schliesslich aus dem KL Sachsenhausen geflohen, um nicht in neue Verbrechen verstrickt zu werden.
Der Angeklagte Dr. L. hat ferner im KL Auschwitz, als er als Lagerarzt eingesetzt war, im Gegensatz zu anderen SS-Lagerärzten alles getan, um das Los der Häftlinge zu erleichtern. Oben ist unter L.IV. bereits näher ausgeführt worden, wie sich der Angeklagte Dr. L. als Lagerarzt gegenüber den Häftlingsärzten und den Häftlingen verhalten hat. In der Atmosphäre des KL Auschwitz war dies nicht selbstverständlich; denn es gehörte damals Mut dazu, z.B. den Häftlingen von ausserhalb des Lagers Medikamente zu besorgen. Bei den Häftlingsärzten rief sein Verhalten auch Erstaunen und Verwunderung hervor. Das gleiche gilt für sein Verhalten im KL Ravensbrück gegenüber den Häftlingen, wie es ebenfalls bereits oben unter L.IV. geschildert worden ist. Sein Verhalten gegenüber den Häftlingen im Lager, insbesondere auch gegenüber den jüdischen Häftlingen, zeigt, dass er nur schweren Herzens bei den Massenmorden der sog. RSHA-Juden mitgewirkt hat und bestrebt war, bereits damals seine Schuld durch gute Taten gegenüber den Häftlingen im Lager aufzuwiegen.
Der Angeklagte Dr. L. hat in seinem Schlusswort erklärt, er sei in diese Dinge verstrickt worden, und es sei für ihn eine starke seelische Belastung gewesen, wenn er daran gedacht habe, was aus den Menschen werde, die er nicht zur Arbeit ausgewählt habe. Nach Auffassung des Schwurgerichts hat der Angeklagte seine damalige Situation zutreffend umschrieben. Er hat durch diese Worte schliesslich seine Schuld eingeräumt, wozu ihm zuvor noch der Mut gefehlt hatte. Das Schwurgericht hat den Eindruck, dass bei dem Angeklagten Dr. L. die erforderliche Einsicht in seine Taten vorhanden ist und er sie aufrichtig bereut.
Aus all diesen Gründen erschien daher für jede Beihilfehandlung die im Gesetz vorgesehene Mindeststrafe von 3 Jahren Zuchthaus als eine ausreichende Sühne. Aus den Einzelstrafen war gemäss §74 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden, die im Hinblick auf die Persönlichkeit des Angeklagten und sein sonstiges im KL Auschwitz und den anderen Konzentrationslagern gezeigtes Verhalten trotz des erheblichen Unrechtsgehalts seiner Tatbeiträge in Höhe von 3 Jahren und 3 Monaten Zuchthaus als eine ausreichende Sühne erschien.
M. Die Straftaten des Angeklagten Dr. Frank
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Dr. Frank
Der Angeklagte Dr. Frank ist am 9.2.1903 als Sohn eines Assessors, späteren Oberregierungsrates (Postingenieur), in Regensburg geboren. Er besuchte 4 Jahre die Volksschule und anschliessend 4 Jahre das humanistische Gymnasium in Regensburg. Als sein Vater nach München versetzt wurde, wechselte der Angeklagte auf ein Realgymnasium in München über. Dort legte er im Jahre 1923 die Reifeprüfung ab. 1920 meldete sich der Angeklagte freiwillig zum Freikorps Epp, mit dem er 3 bis 4 Wochen lang an einer Aktion im Ruhrgebiet teilnahm. Im Jahre 1922 trat er der NSDAP als Gründungsmitglied der Ortsgruppe Regensburg bei. Bei mindestens einer Parteiversammlung wurde er als Saalschutz eingeteilt. Als während dieser Versammlung eine Schlägerei ausbrach, wurde er verletzt. Nach dem Abitur studierte der Angeklagte 8 Semester an der technischen Hochschule in München. Er gehörte als Student dem Korps Ratisbonia München an. Am 8.11.1923 nahm er an der Versammlung im Bürgerbräukeller und am 9.11.1923 an dem sog. Marsch zur Feldherrnhalle teil. Angeblich ist er - wie er sich einlässt - nur zufällig auf den Zug gestossen und nur 200 m mitmarschiert. Dann habe sich der Zug, so gibt er an, wegen der Schiesserei aufgelöst. Er sei so weit hinten gewesen, dass er davon nichts abbekommen habe.
1927 bestand der Angeklagte an der Technischen Hochschule in München die Prüfung als Dipl.Ing. Er war anschliessend ein Jahr lang Ingenieur bei der Maschinenfabrik I.A. Mattei AG in München tätig. Dann wurde er von der Firma Siemens-Schuckert-Werke in Nürnberg als Besuchs- und Reiseingenieur eingestellt.
Als sich 1931 die Wirtschaftslage in Deutschland verschlechterte, wurde er von den Siemens-Schuckert-Werken wegen Auflösung der Abteilung, der er angehörte, entlassen. Auf Veranlassung der Firma studierte er sodann in München Zahnmedizin. Dort gehörte er dem NS-Studentenbund an, nachdem das Korps Ratisbonia München in eine Kameradschaft des NSDStB umgewandelt worden war.
Im April 1933 liess sich der Angeklagte in München erneut in die NSDAP aufnehmen, da er von der Ortsgruppe Regensburg jahrelang nichts mehr gehört hatte und der zuständige Kreisleiter ihm mitgeteilt hatte, sein Aufnahmeantrag sei verlorengegangen. Im September 1933 trat er ausserdem in das NSKK ein.
Im Dezember 1934 bestand der Angeklagte das Staatsexamen. Er ging nun nach Ulm und arbeitete dort eine Zeitlang als Assistent bei einem Zahnarzt. Er trat aus dem NSKK im Februar 1935 wieder aus (sein letzter Dienstgrad beim NSKK war Scharführer), um beim Segelfliegersturm Ulm als Sturmführer Dienst zu tun. Nachdem er im September 1935 an der Universität München zum Dr. der Zahnmedizin promoviert wurde, liess er sich im November 1935 in Stuttgart - Bad Cannstatt als Zahnarzt nieder. In Stuttgart trat er auch in die allgemeine SS ein. Er machte dann nebenbei im Stab des SS-Oberabschnittsarztes Südwest Dienst als Zahnarzt. Hierzu gibt der Angeklagte an, dass er sich nach seiner Niederlassung im Jahre 1935 bei dem Chef des Gesundheitswesens gemeldet habe. Dieser habe ihm erklärt, dass er einen Zahnarzt für die SS brauche. Er - der Angeklagte - habe sich daraufhin hierzu bereit erklärt. Er habe aber insgesamt nur ein paar junge Leute untersucht und behandelt.
Bei Ausbruch des Krieges war der Angeklagte Unterscharführer bei der allgemeinen SS. Er durfte auch den Winkel für "alte Kämpfer" tragen.
Im Jahre 1940 meldete sich der Angeklagte zur Waffen-SS, um dort als Zahnarzt Verwendung zu finden. Er wurde zur Waffen-SS eingezogen und im Oktober und November 1940 bei der SS-Division "Germania" in Hamburg ausgebildet. Am 30.1.1941 wurde er zur SS-Division "Wiking" versetzt, mit der er den Russlandfeldzug bis zum 25.12.1941 mitmachte, wegen einer Erkrankung wurde er am 25.12.1941 zu einem SS-Sanitäts-Ersatzbataillon versetzt und kam in das Lazarett nach Bad Cannstatt. Er war danach nur noch g.v.H. Vom 23.4.1942 bis zum 20.7.1942 arbeitete er in der SS-Zahnstation Dachau. Anschliessend war er bis zum 10.November 1942 in dem SS-Lazarett Minsk und bis Februar 1943 bei der SS-Zahnstation in Wewelsburg als Zahnarzt tätig. In Wewelsburg wurde der Angeklagte im Januar 1943 zum SS-Obersturmführer befördert. Am 28.2.1943 wurde der Angeklagte in das Konzentrationslager Auschwitz versetzt. Hier fand er zunächst Verwendung als zweiter Zahnarzt. Im Sommer 1943 wurde er leitender Zahnarzt. Während seiner Tätigkeit in Auschwitz wurde er zum SS-Hauptsturmführer (Juni 1944) befördert.
Am 15.August 1944 wurde der Angeklagte als leitender Zahnarzt nach KZ Dachau versetzt, wo er bis zum 10.11.1944 blieb. Anschliessend wurde er noch in Ungarn bis zum Kriegsende eingesetzt. Er geriet in amerikanische Kriegsgefangenschaft, aus der er im Januar 1947 entlassen wurde. Von der Spruchkammer in München wurde er als Mitläufer eingestuft. Er nahm seine frühere Tätigkeit als Zahnarzt in Stuttgart - Bad Cannstatt wieder auf.
Der Angeklagte hat am 17.12.1934 geheiratet. Aus der Ehe sind zwei - inzwischen volljährig gewordene - Kinder hervorgegangen.
Der Angeklagte Dr. Frank ist während der Hauptverhandlung auf Grund des Haftbefehls des Schwurgerichts vom 5.10.1964 am gleichen Tage verhaftet worden. Er befindet sich seit dieser Zeit in Untersuchungshaft.
II. Die Mitwirkung des Angeklagten Dr. Frank an der Massentötung jüdischer Menschen in Auschwitz (Tatsächliche Feststellungen)
Der Angeklagte Dr. Frank hat ebenfalls an der Massenvernichtung von RSHA-Transporten mitgewirkt. Er wurde nach der bereits erwähnten Ärztebesprechung bei Dr. Wirths im Frühjahr 1944 ebenso wie die SS-Ärzte zum sog. Rampendienst eingeteilt. Wenn er eingeteilt war, begab er sich wiederholt nach der Ankunft von RSHA-Transporten auf die Rampe und selektierte dort die angekommenen jüdischen Männer und Frauen über 16 Jahre, die nicht schon vorher wegen Krankheit, Gebrechlichkeit oder zu hohen Alters von den niederen SS-Dienstgraden ausgesondert worden waren. Er bestimmte mit einer Handbewegung darüber, wer von ihnen als arbeitsfähig in das Lager aufzunehmen und wer durch das Gas zu töten sei. Diesen Selektionsdienst hat er mindestens fünfmal am Tage bei fünf verschiedenen RSHA-Transporten versehen. Mindestens einmal hat er auch in der Nacht einen RSHA-Transport selektiert. Von diesen sechs Transporten sind jeweils mindestens tausend Menschen in die Gaskammern verbracht und dort durch Zyklon B getötet worden. Der Angeklagte Dr. Frank ist auch mindestens einmal nach einer durchgeführten Selektion zu der Gaskammer hingefahren und hat dort Dienst während der Tötung der in der Gaskammer eingeschlossenen Menschen gemacht, d.h. er hat den Desinfektoren das Zeichen zum Einwerfen des Gases gegeben, nachdem die Gaskammer verriegelt worden war. Dann hat er nach dem Einschütten des Zyklon B den Todeskampf der in der Gaskammer eingeschlossenen Opfer beobachtet und schliesslich das Zeichen zum Öffnen der Gaskammer gegeben. Nach der Öffnung der Gaskammer hat er sich von dem Tod der Opfer überzeugt und ihre Leichen für die Verbrennung freigegeben.
Der Angeklagte Dr. Frank wusste, dass die jüdischen Menschen nur wegen ihrer Abstammung als Angehörige einer sog. minderwertigen Rasse unschuldig getötet wurden. Er war sich auch darüber im klaren, dass er durch den Selektionsdienst und den Dienst an der Gaskammer die Vernichtungsaktionen förderte.
III. Die Einlassung des Angeklagten Dr. Frank, Beweismittel, Beweiswürdigung
Die Feststellungen zum Lebenslauf des Angeklagten Dr. Frank beruhen auf seiner Einlassung, einem von ihm im Jahre 1939 geschriebenen handschriftlichen Lebenslauf sowie der für ihn angelegten SS-Führerkarte. Die beiden Urkunden wurden durch Verlesung zum Gegenstand der Verhandlung gemacht.
Zu dem ihm durch den Eröffnungsbeschluss gemachten Schuldvorwurf hat sich der Angeklagte Dr. Frank wie folgt eingelassen:
Im Frühjahr 1944 sei er zu einer Besprechung sämtlicher Ärzte, Zahnärzte und Apotheker zu Dr. Wirths bestellt worden. Dieser habe ihm eröffnet, dass in Zukunft sehr viele Transporte ankämen und daher die Ärzte den Rampendienst voraussichtlich nicht mehr allein bewältigen können. Daher würden von jetzt ab neben einem SS-Arzt sämtliche Zahnärzte und Apotheker abwechselnd als "Ersatzleute" für den Rampendienst eingeteilt werden. Er - der Angeklagte - sei zwei bis drei Tage nach dieser Besprechung bei Dr. Wirths vorstellig geworden, um vom Rampendienst befreit zu werden. Er habe ihm erklärt, dass der Rampendienst keine Aufgabe für Zahnärzte sein könne. Als Zahnarzt könne er nicht erkennen, ob jemand arbeitsfähig sei oder nicht. Er habe Dr. Wirths auch gesagt, dass er von Auschwitz weg wolle. Dr. Wirths habe jedoch erwidert, es sei Befehl von Berlin und er müsse auf jeden Fall mit auf die Rampe. Der Dienst in einem KZ sei Frontdienst, jede Weigerung werde als "Fahnenflucht" bestraft.
Er sei dann in der Folgezeit etwa zehnmal zum Rampendienst eingeteilt worden. Auf Grund dieser Einteilung sei er auch etwa zehnmal zur Rampe hingefahren, wenn RSHA-Transporte angekommen seien. Zweimal habe er auch Nachtdienst auf der Rampe gemacht.
Wenn er in diesen Fällen auf die Rampe gekommen sei, hätten die jüdischen Menschen bereits in Marschblöcken gestanden. Sie seien dann von einem Arzt und anderen SS-Führern selektiert worden. Er selbst habe nicht selektiert. Dies sei nicht nötig gewesen. Denn er sei auf dem Dienstplan stets nur als Ersatzmann neben einem Arzt eingeteilt worden. Als Ersatzmann hätte er nur einspringen brauchen, wenn der eingeteilte Arzt aus irgendeinem Grunde ausgefallen wäre. Dieser Fall sei jedoch nie eingetreten. Auf der Rampe habe er sich nur um die Zahnärzte und Dentisten gekümmert, die mit den RSHA-Transporten angekommen seien. Er habe sie aus den Transporten herausgesucht und habe sie dem Schutzhaftlagerführer und dem Arbeitsdienstführer vorgestellt, damit sie in das Lager aufgenommen und dort eingekleidet würden. Häufig hätten sich auf seine Fragen auch Personen als Zahnärzte oder Dentisten gemeldet, die es gar nicht gewesen seien. Diese habe er später irgendwo eingesetzt. Auch habe er das zahnärztliche Material, das von jüdischen Zahnärzten und Dentisten mitgebracht worden sei, sichergestellt. Damit hätte er im gesamten Lagerbereich etwa 25 bis 30 Häftlingszahnstationen eingerichtet. Meist habe er sich auf der Rampe nur eine halbe Stunde bis eineinhalb Stunden aufgehalten. Häufig sei er vor Beendigung der Selektionen weggegangen. Zu den Krematorien sei er nie mitgegangen. Auch habe er nie das Einwerfen des Gases überwacht. Im übrigen sei er auch noch ohne Einteilung etwa zehn- bis fünfzehnmal auf die Rampe gegangen, um Zahnärzte und Dentisten aus den angekommenen RSHA-Transporten herauszusuchen und zahnärztliches Material sicher zu stellen.
Die Einlassung des Angeklagten Dr. Frank, er sei nur als "Ersatzmann" zum Rampendienst eingeteilt worden, ist - ausser von dem Angeklagten Dr. Sc. - von keinem Angeklagten und von keinem Zeugen bestätigt worden. Auch der Angeklagte Dr. Capesius, der nur als Apotheker und nicht als Arzt im KL Auschwitz gewesen ist, hat nicht bestätigt, dass die Zahnärzte und Apotheker nur als "Ersatzleute" eingeteilt worden seien. Er hat sich vielmehr dahin eingelassen, dass Dr. Wirths bei der Besprechung im Frühjahr 1944 erklärt habe, in Zukunft müssten auch die Zahnärzte und Apotheker zum Rampendienst herangezogen werden, da die Transporte sehr angeschwollen seien und die Ärzte Hilfe brauchten. Er hat auch zugegeben, dass er selbst ebenfalls zum Rampendienst eingeteilt worden sei. Allerdings behauptete er - was noch bei der Erörterung seiner Straftaten auszuführen sein wird - dass stets der mit ihm befreundete Dr. Klein für ihn den Selektionsdienst übernommen habe, wenn er zum Rampendienst eingeteilt gewesen sei (was allerdings - wie noch auszuführen sein wird - nur eine Schutzbehauptung ist). Damit hat der Angeklagte Dr. Capesius eingeräumt, dass er nicht nur als Ersatzmann eingeteilt worden ist. Denn sonst hätte er dies geltend gemacht und hätte sich nicht auf die Übernahme des ihm befohlenen Selektionsdienstes durch einen anderen zu berufen brauchen.
Der Angeklagte Kaduk hat in der Sitzung vom 3.5.1965 glaubhaft erklärt, man habe, als laufend Transporte in Birkenau angekommen seien, auch die Zahnärzte mit zum Rampendienst herangezogen, da die Ärzte überlastet gewesen seien. Davon, dass die Zahnärzte nur als Ersatzleute eingeteilt worden seien, hat der Angeklagte Kaduk nichts gewusst. Schon daraus folgt, dass die Einlassung des Angeklagten Dr. Frank insoweit unglaubhaft ist.
Es ist auch kein einleuchtender Grund ersichtlich, warum Dr. Frank überhaupt zur Abwicklung von RSHA-Transporten hätte gehen müssen, wenn der eingeteilte Arzt, für den er angeblich nur für den Fall seiner Verhinderung hätte einspringen sollen, stets selbst den Rampendienst wahrnehmen konnte und somit der "Ersatzfall" gar nicht eingetreten ist.
Wenn der Angeklagte Dr. Sc. die Einlassung des Angeklagten Dr. Frank bestätigt hat, so verdient er keinen Glauben. Denn er war ebenfalls im KL Auschwitz als Zahnarzt. Ihm wird der gleiche Schuldvorwurf wie dem Angeklagten Dr. Frank gemacht. Es ist daher nicht verwunderlich, dass beide die gleiche Schutzbehauptung vorbringen. Sie hatten genügend Gelegenheit, sich vor Beginn der Hauptverhandlung abzusprechen, da sie bis zu ihrer Vernehmung zur Sache in der Hauptverhandlung in Freiheit waren. Dagegen war eine Absprache mit dem Angeklagten Dr. Capesius nicht möglich, da dieser schon längere Zeit vor Beginn der Hauptverhandlung in Untersuchungshaft genommen worden ist.
Die Einlassung des Angeklagten Dr. Frank ist darüber hinaus in der Hauptverhandlung durch die glaubhafte Aussage des Zeugen Ros. widerlegt worden. Der Zeuge, der im März 1942 als slowakischer Jude mit einem RSHA-Transport nach Auschwitz deportiert worden ist, wurde im Frühjahr 1943 als Hilfspfleger und Häftlingszahnarzt auf der Häftlingszahnstation im Block 31 des Lagerabschnitts B II eingesetzt. Das hat der Angeklagte Dr. Frank nicht in Abrede gestellt. In dieser Funktion lernte der Zeuge den Angeklagten Dr. Frank kennen. Nach der glaubhaften Aussage des Zeugen kam Dr. Frank jede Woche Dienstags zu der Häftlingszahnstation auf den Block 31. Auch das hat der Angeklagte Dr. Frank bestätigt. Allerdings will er stets mit dem Motorrad zu dieser Zahnstation gefahren sein, während der Zeuge Ros. behauptet, Dr. Frank sei mit einem Sanka gekommen, in denen oft Kisten mit Goldzähnen gelegen hätten. Er selbst habe - so hat der Zeuge Ros. ausgesagt - wiederholt den Angeklagten Dr. Frank aus dem Block 31 zum Sanka begleitet und dabei die Kisten mit den Goldzähnen gesehen.
Wie der Angeklagte Dr. Frank zur Häftlingszahnstation im Block 31 gekommen ist, kann auf sich beruhen. Auf jeden Fall musste der Angeklagte Dr. Frank bestätigen, dass er jede Woche die Zahnstation besucht hat, in der der Zeuge Ros. als Häftlingspfleger bzw. Häftlingszahnarzt tätig war. Daraus folgt, dass der Zeuge Ros. den Angeklagten Dr. Frank gut gekannt haben muss. Der Angeklagte Dr. Frank hat auch nicht in Zweifel gezogen, dass der Zeuge ihn im KL Auschwitz gekannt hat.
Der Zeuge Ros. hat nun bei seiner Vernehmung in der Hauptverhandlung geschildert, dass er wiederholt von einer der Waschbaracken aus, die hinter dem Block 31 unmittelbar am Lagerzaun gelegen hätte, die Selektionen auf der Rampe in Birkenau beobachtet habe. Die beiden Waschbaracken hätten keine Fenster gehabt. Aber an den beiden Stirnseiten der Baracken seien Türen gewesen. Er habe sich in eine der beiden Waschbaracken hineingestellt und durch die geöffnete Tür hindurch die Abwicklung der RSHA-Transporte sehen können. Er habe stets gut beobachtet, weil er damals seine Flucht vorbereitet habe. Von seinem Beobachtungsposten aus habe er auch den Angeklagten Dr. Frank gesehen, wie er nach der Ankunft von RSHA-Transporten den an ihm vorbeimarschierenden jüdischen Menschen mit der Hand gedeutet habe, wohin sie zu gehen hätten, nach rechts oder nach links, je nachdem, ob sie in das Lager aufgenommen oder durch Gas getötet werden sollten. Dr. Frank habe auf diese Weise mindestens fünfmal am Tage und mindestens einmal in der Nacht RSHA-Transporte auf der Rampe in Birkenau selektiert. Das sei im Sommer (Juni/Juli) 1944 gewesen. Die Entfernung von seinem Beobachtungsposten bis zu dem Angeklagten Dr. Frank auf der Rampe habe etwa 60 m betragen.
Das Gericht hat dem Zeugen vollen Glauben geschenkt. Der Zeuge hat einen glaubwürdigen Eindruck gemacht. Seine Aussage war klar, sachlich und bestimmt. Nach der dem Gericht vorliegenden Skizze vom Lager Birkenau, deren Richtigkeit die Angeklagten bestätigt haben, befanden sich im Lagerabschnitt B II d - vom Lagereingang aus gesehen - zwei Waschbaracken hinter den beiden letzten Baracken des Lagerabschnitts B II d unmittelbar am Drahtzaun, der das Lager von dem Rampengelände abschloss. Es erscheint daher glaubhaft, dass der Zeuge die Abwicklung der RSHA-Transporte aus unmittelbarer Nähe beobachten konnte. Das Gericht hat auch keine Zweifel, dass der Zeuge Ros. den Angeklagten Dr. Frank auf eine Entfernung von etwa 60 m einwandfrei erkannt hat. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Zeuge seine Aussage wider besseres Wissen gemacht hat, um den Angeklagten Dr. Frank zu Unrecht zu belasten. Er ist - wie er glaubhaft bekundet hat - von dem Angeklagten Dr. Frank gut behandelt worden. Das Motiv einer persönlichen Rache scheidet aus. Auch sonstige Motive für eine wahrheitswidrige Belastung des Angeklagten Dr. Frank sind nicht ersichtlich. Bezüglich des Angeklagten Dr. Sc. hat der Zeuge erklärt, dass er ihn zwar auf der Rampe gesehen, aber nicht beobachtet habe, dass Dr. Sc. selektiert habe. Hätte der Zeuge den Angeklagten Dr. Frank wahrheitswidrig belasten wollen, so hätte es nahe gelegen, dass er dies auch in bezug auf den Angeklagten Dr. Sc. gemacht hätte.
Dass der Zeuge den Angeklagten Dr. Frank mit einem anderen SS-Führer verwechselt hat, hält das Gericht für ausgeschlossen. Der Zeuge hat die Abwicklung der RSHA-Transporte während eines längeren Zeitraumes beobachten können. Der Angeklagte Dr. Frank war ihm nicht nur dem Gesicht, sondern auch der ganzen Gestalt und seinen Bewegungen nach bekannt, weil er ihn mindestens einmal in der Woche aus nächster Nähe sehen konnte. Der Zeuge war im Block 31 des Lagerabschnitts B II d von März 1943 bis zur Versetzung des Angeklagten Dr. Frank von Auschwitz am 15.August 1944. Er hat somit den Angeklagten Dr. Frank während eines Zeitraumes von fast eineinhalb Jahren wöchentlich gesehen. Auf der Rampe hat der Zeuge den Angeklagten Dr. Frank so gesehen, wie er bei ihm wöchentlich auf Block 31 erschienen ist, nämlich in Uniform und Führermütze. Der Angeklagte Dr. Frank stand bei den Selektionen an exponierter Stelle. Die jüdischen Menschen marschierten an ihm vorbei. Er hob sich gegen die mit zivilen Kleidern bekleideten Menschen ab. Bei der Gruppe der SS-Führer kann es sich nur um relativ wenige Personen gehandelt haben. Für den Zeugen bestand daher keine Schwierigkeit, aus dieser Gruppe den ihm bekannten Dr. Frank zu erkennen. Der Zeuge hat auch mit aller Bestimmtheit erklärt, dass er den Angeklagten Dr. Frank einwandfrei hat identifizieren können.
Die Verteidigung des Angeklagten Dr. Frank hat in Zweifel gezogen, dass der Zeuge auf eine Entfernung von etwa 60 m die Person des Angeklagten Dr. Frank überhaupt hat erkennen können. Das Gericht teilt diese Zweifel nicht. Denn bei der durchgeführten Ortsbesichtigung auf dem Gelände des früheren KL Auschwitz durch den beauftragten Richter ist festgestellt worden, dass man auf eine Entfernung von 60 m eine auf der früheren Rampe stehende Person erkennen kann. Am Tage der Besichtigung war zudem noch diesiges Wetter. Das Gericht hat sich selbst durch ein Experiment im Hof des Gallushauses davon überzeugt, dass man auf eine Entfernung von 60 m die Hand- und Daumenbewegungen einer Person gut erkennen kann. Allerdings konnten bei diesem Experiment von drei in einer Entfernung von 60 m aufgestellten Personen zwei nicht von allen Mitgliedern des Gerichts einwandfrei identifiziert werden. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass die eine Person, ein Justizwachtmeister in Uniform, eine Uniformmütze getragen hat, während er den Mitgliedern des Gerichts bis dahin noch nie in einer Uniformmütze zu Gesicht gekommen war. Sein Erscheinungsbild war somit ein anderes als das den Mitgliedern des Gerichts bekannte. Die andere Person, die nicht von allen Mitgliedern des Gerichts hat identifiziert werden können, war diesen Mitgliedern überhaupt nicht bekannt. Es war ein uniformierter Mann, der zwar vorher zur Bewachung des Gallushauses eingesetzt gewesen war, von den Mitgliedern des Gerichts jedoch nie mit Bewusstsein wahrgenommen worden ist. Dagegen war der Angeklagte Dr. Frank auf der Rampe so bekleidet, wie er dem Zeugen Ros. aus seinen Besuchen auf Block 31 bekannt war. Im übrigen steht nicht fest, ob die Sichtverhältnisse bei dem Experiment so gut gewesen sind, wie während der Beobachtungszeit des Zeugen Ros. Der Zeuge Ros. hat den Angeklagten Dr. Frank auch während eines längeren Zeitraumes beobachten können, während als Gericht die drei Personen nur kurze Zeit betrachtet hat. Zieht man noch in Betracht, dass der Angeklagte Dr. Frank selbst zugegeben hat, mindestens zehnmal bei der Abwicklung von RSHA-Transporten auf der Rampe gewesen zu sein und dass seine Einlassung - wie oben ausgeführt - nur als "Ersatzmann" eingeteilt gewesen zu sein, nur eine unglaubhafte Schutzbehauptung ist, so erscheint die Aussage des Zeugen Ros. voll glaubhaft und die Möglichkeit einer Verwechslungsgefahr scheidet aus.
Die Feststellung, dass der Angeklagte Dr. Frank mindestens einmal auch Dienst an der Gaskammer gemacht hat, beruht ebenfalls auf der Aussage des Zeugen Ros. und der glaubhaften Aussage der Zeugen Philipp Mü. und Pa.
Der Zeuge Ros. hat glaubhaft bekundet, dass der Angeklagte Dr. Frank einmal im Sanka hinter einer Kolonne jüdischer Menschen, die nach der Selektion von SS-Posten begleitet und zu der Gaskammer geführt worden seien, zur Gaskammer gefahren sei. Auf dem Gelände des Krematoriums wurde der Angeklagte Dr. Frank, als jüdische Menschen in die Gaskammern hinein geführt worden sind, einmal von dem Zeugen Pa. gesehen. Allerdings konnte dieser Zeuge nicht feststellen, was der Angeklagte Dr. Frank dort gemacht hat. Wie bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Dr. L. bereits ausgeführt worden ist, musste bei der Tötung von Menschen in den Gaskammern stets ein Arzt dabei sein. Die Ärzte kamen - wie der Zeuge Pa. glaubhaft bekundet hat - meist mit dem Rote-Kreuz-Wagen zur Gaskammer gefahren. Aus der Tatsache, dass Dr. Frank nach einer Selektion mit diesem Wagen hinter den zu tötenden Menschen zur Gaskammer gefahren ist, hat das Gericht die Überzeugung gewonnen, dass der Angeklagte Dr. Frank in diesem Fall den vorgeschriebenen Gaskammerdienst, wie er bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Dr. L. näher beschrieben worden ist, versehen hat. Denn es ist nicht ersichtlich, was der Angeklagte Dr. Frank unter den gegebenen Umständen anders bei der Gaskammer hätte machen sollen. Wenn auch der Angeklagte Dr. Frank nur Zahnarzt gewesen ist, so schliesst das nicht aus, dass er auch zum Gaskammerdienst befohlen worden ist. Denn auch der Selektionsdienst war an sich ursprünglich nur Angelegenheit der Ärzte, weil man offenbar davon ausging, dass nur sie den körperlichen Zustand und die Arbeitstauglichkeit der Menschen feststellen könnten. Gleichwohl wurden die Zahnärzte und Apotheker ebenfalls hierfür eingeteilt, als die Ärzte für den Selektionsdienst nicht mehr ausreichten. Daher erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass man sie auch zum Gaskammerdienst eingeteilt hat, wenn keine Ärzte zur Verfügung standen.
Welche Tätigkeit die Ärzte bei den Gaskammern zu verrichten hatten, ist bereits bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Dr. L. unter L. III. ausgeführt worden. Hierauf kann daher Bezug genommen werden. Wenn auch kein Zeuge gesehen hat, was der Angeklagte Dr. Frank während dieses Gaskammerdienstes getan hat, so hat das Gericht keinen Zweifel, dass er die Tätigkeit, die zu diesem Dienst gehörte, auch verrichtet hat. Der ärztliche Dienst an der Gaskammer war genau vorgeschrieben. Das ergibt sich auch aus den Aufzeichnungen des Lagerkommandanten Höss. Ohne die unter II. geschilderten Handlungen des Angeklagten Dr. Frank wäre eine reibungslose Durchführung der Vernichtungsaktion nicht möglich gewesen. Denn die Desinfektoren schütteten das Gas - wie der Angeklagte Kaduk in der Sitzung vom 3.5.1965 glaubhaft bekundet hat - nur auf ein Zeichen des Arztes hin durch die Einfüllöcher in die Gaskammer hinein. Auch die Öffnung der Gaskammer erfolgte erst, nachdem der Arzt das Zeichen hierfür gegeben hatte.
Da der Angeklagte Dr. Frank den Selektionsdienst im Sommer 1944 verrichtet hat, konnte mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass von den sechs RSHA-Transporten, bei deren Vernichtung er mitgewirkt hat, mindestens je tausend Menschen getötet worden sind. Es gilt hier das gleiche, was bereits bei dem Angeklagten Dr. L. und anderen Angeklagten für die Transporte im Sommer 1944 ausgeführt worden ist.
Die Feststellung, dass der Angeklagte Dr. Frank den Grund für die Massentötung der unschuldigen jüdischen Menschen gekannt hat, ergibt sich daraus, dass dies allen SS-Angehörigen in Auschwitz bekannt gewesen ist. Jeder wusste, dass die Juden nur wegen ihrer Abstammung als Angehörige einer sog. "minderwertigen Rasse" getötet worden sind. Der Angeklagte Dr. Frank hat auch nicht in Abrede gestellt, darüber Bescheid gewusst zu haben. Er hat sich nicht darauf berufen, darüber im Unklaren gewesen zu sein.
Das Gericht ist auch überzeugt, dass ihm beim Rampendienst und dem Dienst an der Gaskammer völlig klar gewesen ist, die Vernichtungsaktionen zu fördern. Das ergab sich nämlich aus seiner Tätigkeit auf der Rampe und an der Gaskammer von selbst. Dem intelligenten und gebildeten Angeklagten kann nach der gesamten Situation nicht verborgen geblieben sein und war ihm nach der Überzeugung des Gerichts auch durchaus bewusst, dass er durch die geschilderten Tätigkeiten auf der Rampe und an der Gaskammer als ein Rad in dem gesamten Vernichtungsapparat für die Vernichtungsaktion - auch durch psychische Unterstützung der anderen SS-Dienstgrade - einen nicht unerheblichen Tatbeitrag leistete. Das ergibt sich im übrigen auch daraus, dass er zunächst einen schwachen Versuch gemacht hat, von dem Rampendienst befreit zu werden.
IV. Rechtliche Würdigung
Der Angeklagte Dr. Frank hat durch den geschilderten Selektionsdienst in den sechs Fällen und durch seine Tätigkeit bei der Gaskammer während der Vernichtung eines RSHA-Transportes die Vernichtungsaktionen in sechs Fällen und damit die Mordtaten der Haupttäter gefördert. Hierzu kann auf die Ausführung unter L. (Dr. L.) IV. verwiesen werden. Er hat den Rampendienst und den Dienst an der Gaskammer auf Befehl eines unmittelbaren Vorgesetzten, des Standortarztes Dr. Wirths geleistet. Da er Angehöriger der Waffen-SS gewesen ist, findet daher auch bei ihm der §47 MStGB Anwendung. Der Angeklagte Dr. Frank hat klar erkannt, dass dieser Befehl ein allgemeines Verbrechen bezweckte. Denn er hat selbst eingeräumt, dass er das Geschehen in Auschwitz als "ungeheuerlich" empfunden und die Tötung der jüdischen Menschen als Unrecht und Verbrechen angesehen habe. Daraus ergibt sich auch, dass er nicht irrig angenommen hat, die Befehle, die auf die Massentötung der unschuldigen jüdischen Menschen hinzielten, seien bindend, weil sie von dem Inhaber der höchsten Staatsautorität ausgingen. Auch wenn er sich anders eingelassen hätte, könnte daran kein Zweifel sein. In diesem Fall gilt das gleiche, was bisher bereits bei allen anderen Angeklagten, die an der Massentötung jüdischer Menschen teilgenommen haben, insoweit ausgeführt worden ist. Ihn trifft daher die Strafe des Teilnehmers.
Das Schwurgericht konnte nicht feststellen, dass der Angeklagte Dr. Frank die Massentötung der jüdischen Menschen als eigene Taten gewollt hat. Nach den getroffenen Feststellungen ist er nicht durch besonderen Eifer aufgefallen. Auch war nicht ersichtlich, dass er ein eigenes persönliches Interesse an der Vernichtung der RSHA-Transporte gehabt hat. Aus seinem Verhalten im KZ Auschwitz gegenüber jüdischen Häftlingen haben sich auch keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass er den jüdischen Menschen gegenüber feindlich eingestellt oder ihre Tötung für notwendig und zweckmässig gehalten hätte.
Nach der glaubhaften Aussage der Zeugin Fanni Her., die von dem Angeklagten Dr. Frank mit einer anderen Häftlingsfrau für die Häftlingszahnstation ausgesucht worden ist, war der Angeklagte Dr. Frank zu ihr und allen anderen Frauen sehr gut und hat allen Häftlingen geholfen, wo er nur helfen konnte. Der Zeuge Menne Krat., der am 15.1.1943 als jüdischer Häftling nach Auschwitz deportiert und dort nach etwa vier bis sechs Wochen dem Kommando SS-Zahnstation zugeteilt worden ist, hat den Angeklagten Dr. Frank ebenfalls positiv beurteilt. Der Zeuge musste zunächst zusammen mit drei anderen Häftlingen das Zahngold aus den Zähnen bzw. Zahnprothesen, die man den Toten herausgebrochen hatte, einschmelzen. Das geschmolzene Gold wurde dem Angeklagten Dr. Frank übergeben, der dafür verantwortlich war, dass es an das RSHA geschickt wurde. Später wurde der Zeuge "Putzer" bei dem Angeklagten Dr. Frank. In dieser Funktion lernte er den Angeklagten Dr. Frank näher und gut kennen. Er hat den Angeklagten Dr. Frank als einen "anständigen" Menschen geschildert, der wiederholt Menschlichkeit gezeigt habe. Als der Zeuge einmal auf Veranlassung des Arbeitseinsatzführers Sell in den Arrestbunker eingeliefert worden war, hat der Angeklagte Dr. Frank - wie der Zeuge glaubhaft erklärt hat - sich für ihn eingesetzt und bei dem Lagerkommandanten seine Freilassung erwirkt. Der Angeklagte hat den Zeugen auch von einem Transport zurückstellen lassen. Auch andere Häftlinge habe der Angeklagte Dr. Frank - so hat der Zeuge weiter bekundet - menschlich und anständig behandelt. Der Zeuge hat ferner einen Brief des Standortarztes Dr. Wirths an den Angeklagten Dr. Frank gelesen, in dem diesem sinngemäss mitgeteilt worden ist, dass er zur Truppe versetzt werde, weil er es nicht verstünde, zwischen sich und den Häftlingen Distanz zu wahren.
Der Zeuge Philipp Mü. hat von den jüdischen Häftlingen Feldmann und Katz, die im Krematorium II für den Angeklagten Dr. Frank Gold einschmelzen mussten, ebenfalls eine günstige Beurteilung über den Angeklagten Dr. Frank gehört. Beide haben dem Zeugen Mü. erklärt, dass der Angeklagte Dr. Frank sehr anständig zu ihnen sei. Er habe ihnen sogar Weissbrot und Margarine zusätzlich beschafft.
Nimmt man zu dieser Beurteilung der Zeugen die unwiderlegte Einlassung des Angeklagten hinzu, er habe sich bei Dr. Wirths nach der Besprechung im Frühjahr 1944 um eine Befreiung vom Rampendienst bemüht, so kann man nicht zu der Überzeugung kommen, dass der Angeklagte Dr. Frank die Massentötungen der jüdischen Menschen innerlich bejaht und sie als eigene Taten gewollt hat. Hierfür reichen die Tatsachen, dass der Angeklagte Dr. Frank sehr früh in die NSDAP und relativ früh in die allgemeine SS eingetreten ist und den Winkel der "alten Kämpfer" tragen durfte und dass er sich im Jahre 1940 freiwillig zur Waffen-SS gemeldet hat, was das Schwurgericht alles bei der Feststellung seiner inneren Einstellung zur Massentötung der jüdischen Menschen berücksichtigt hat, allein nicht aus.
Der Angeklagte Dr. Frank hat nur als Gehilfe die Vernichtungsaktionen befehlsgemäss fördern wollen. Er hat nach den getroffenen Feststellungen das Bewusstsein gehabt, durch den Rampendienst und den Dienst an der Gaskammer die Vernichtungsaktionen zu fördern. Er mag den Vernichtungsaktionen ablehnend gegenüber gestanden und den befohlenen Dienst nur widerstrebend verrichtet haben. Das schliesst jedoch seinen Gehilfenwillen nicht aus. Denn es genügt, dass er erkannte, durch seine Tatbeiträge die Haupttaten zu fördern und dass er in diesem Bewusstsein durch Handlungen, die von seinem Willen abhängig waren, die Tatbeiträge geleistet hat.
Der Angeklagte Dr. Frank hat seine Tatbeiträge zwar auf Befehl, jedoch auf Grund freier Entschliessung geleistet. Sein Wille ist nicht durch eine Drohung mit gegenwärtiger auf andere Weise nicht abwendbarer Gefahr für Leib oder Leben gebeugt worden. Der Angeklagte Dr. Frank beruft sich selbst nicht darauf, dass er zum Rampendienst durch eine solche Drohung gezwungen worden sei. Denn er bestreitet, überhaupt Rampendienst geleistet zu haben. Schon das spricht dafür, dass er zum Rampendienst nicht gezwungen worden ist. Sonst hätte er das im einzelnen dargelegt. Es liegen aber auch sonst keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sein Wille gebeugt worden ist und er nur deswegen den Rampendienst versehen hat, um einer drohenden auf andere Weise nicht abwendbaren Gefahr für Leib oder Leben zu entgehen. Wenn er sich unwiderlegt darauf beruft, dass er Dr. Wirths um Befreiung vom Rampendienst gebeten habe und dass Dr. Wirths seine Bitte mit dem Hinweis auf den Befehl von Berlin abgeschlagen und erklärt habe, der KZ-Dienst sei Frontdienst, jede Weigerung werde als "Fahnenflucht" bestraft, so sind damit die Voraussetzungen eines Befehls-(Nötigungs-)notstandes noch nicht gegeben. Auch wenn man unterstellt, dass die Erklärung des Dr. Wirths so, wie es der Angeklagte Dr. Frank behauptet, gefallen ist, ergibt sich daraus noch nicht, dass der Angeklagte Dr. Frank zum Rampendienst durch unmittelbare Gefahr für Leib oder Leben gezwungen worden ist.
Der Angeklagte Dr. Frank hat seine Bitte um Befreiung vom Rampendienst mit einem schwachen Argument begründet, nämlich dass er als Zahnarzt nicht die Arbeitsfähigkeit der Häftlinge beurteilen könne. Nachdem Dr. Wirths die Bitte mit der behaupteten Erklärung abgeschlagen hatte, hätte er mit stärkeren Argumenten auf Befreiung vom Rampendienst dringen müssen, etwa, dass er an der grausamen Tötung der unschuldigen Menschen aus seiner inneren Einstellung heraus nicht mitwirken könne und dass er dem furchtbaren Geschehen auf der Rampe und insbesondere an der Gaskammer nervlich nicht gewachsen sei. Dass Dr. Wirths solchen Argumenten gegenüber aufgeschlossen war, beweist der Fall Delmotte. Auch der Fall Ju. zeigt, dass der Standortarzt Dr. Wirths, auch wenn er sich zunächst als scharfer Vorgesetzter und scheinbar unnachgiebig gezeigt hatte, stillschweigend seine Untergebenen von einer Teilnahme an verbrecherischen Aktionen zu befreien bereit war. Der Angeklagte Dr. Frank hat jedoch überhaupt nicht den Versuch gemacht, Dr. Wirths durch weitere Argumente umzustimmen. Er hat sich mit der Ablehnung seiner Bitte begnügt. Dabei hätte er als "alter Kämpfer" ohne Zweifel ein offenes Wort riskieren können.
Hiervon abgesehen, hat der Angeklagte Dr. Frank auch sonst keine ernsthaften Versuche gemacht, vom Rampendienst befreit zu werden. Der Fall Dr. M. zeigt, dass durch eine persönliche Vorsprache beim Chef des Amtes D III im WVHA, Dr. Lolling, eine Befreiung vom Rampendienst möglich war. Wenn Dr. M. es als Unterscharführer gewagt hat, ohne Erlaubnis nach Berlin zu fahren und dort beim Chef des Amtes D III wegen des Rampendienstes vorzusprechen, so muss man einen solchen Versuch dem Angeklagten Dr. Frank, der den Rang eines Obersturmführers hatte und zudem noch "alter Kämpfer" war, um so eher zuzumuten.
Hinzu kommt, dass der Angeklagte Dr. Frank - nach seiner eigenen Einlassung - mit dem zahnärztlichen Berater des Dr. Lolling, dem jetzigen Zahnarzt und Zeugen Dr. Poo. persönlich bekannt gewesen ist. Dr. Poo. hat als Zeuge bestätigt, dass er den Angeklagten Dr. Frank während seiner Ausbildungszeit im Oktober/November 1940 im Ersatzbataillon "Germania" kennengelernt habe und dass er im Jahre 1944 zahnärztlicher Berater des Dr. Lolling im Amt D III gewesen sei. Der Zeuge war während eines Zeitraumes von ca. 8 Wochen mit Dr. Frank in dem Bataillon "Germania" zusammen. Beide erhielten dort ihre Ausbildung. Es war also eine Bekanntschaft auf kameradschaftlicher Basis, verbunden durch das gemeinsame Erlebnis der Ausbildungszeit. Unter Anknüpfung an diese Bekanntschaft hätte Dr. Frank alles versuchen müssen, um durch Vermittlung des Dr. Poo. eine persönliche Unterredung mit Dr. Lolling und die Befreiung vom Rampendienst zu erreichen. Das hat er jedoch nicht getan. Er behauptet es selbst nicht. Auch der Zeuge Dr. Poo. hat davon nichts berichtet. Nach Auffassung des Gerichts wäre es dem Zeugen Dr. Poo. sicher noch in Erinnerung gewesen, wenn Dr. Frank mit allem Nachdruck und aller Energie durch seine Vermittlung die Befreiung vom Rampendienst betrieben hätte.
Der Angeklagte Dr. Frank hat nur behauptet, dass er ein Versetzungsgesuch an die zuständige Stelle über Dr. Poo. geleitet habe, um von Auschwitz wegzukommen. Er will deswegen auch mit Dr. Poo. gesprochen haben. Der Zeuge Dr. Poo. konnte sich daran nicht mehr positiv erinnern. Er hält es jedoch für möglich. Er hält es auch für möglich, dass Dr. Frank anlässlich seines Besuches in Auschwitz an ihn wegen seines Versetzungsgesuches herangetreten sei, möglicherweise auch mit ihm deswegen telefoniert habe. Das Gericht ist davon ausgegangen, dass der Angeklagte Dr. Frank tatsächlich ein schriftliches Versetzungsgesuch über den Zeugen Dr. Poo. an den zahnärztlichen Dienst im Sanitätsamt der Waffen-SS in Berlin gerichtet und wegen seines Versetzungsgesuches auch persönlich mit dem Zeugen in Auschwitz anlässlich eines Besuches und möglicherweise auch telefonisch mit dem Zeugen deswegen gesprochen hat. Dies genügt jedoch nicht. Denn erfahrungsgemäss dauert es eine gewisse Zeit, bis solche schriftlichen Versetzungsgesuche bearbeitet und entschieden werden. Tatsächlich ist der Angeklagte Dr. Frank auch erst am 15.8.1944, also etwa vier Monate nach der Besprechung beim Standortarzt Dr. Wirths, von Auschwitz nach Dachau versetzt worden. Der Angeklagte Dr. Frank musste damit rechnen, dass längere Zeit bis zu seiner Versetzung vergehen würde. Er hätte sich daher unmittelbar und persönlich unter Ausnützung seiner Beziehungen zu Dr. Poo. und unter Hinweis auf seine "Verdienste" als "alter Kämpfer" um Befreiung vom Rampendienst schon vor seiner ersten Einteilung, spätestens nach seiner ersten Einteilung zum Rampendienst bemühen müssen. Wenn er dies unterlassen hat, so folgt daraus, dass er nach dem ersten schwachen Versuch bei Dr. Wirths, vom Rampendienst befreit zu werden, sich damit abgefunden hat, den Rampendienst befehlsgemäss verrichten zu müssen. Damit ist er den Weg des geringsten Widerstandes gegangen und hat den Rampendienst aus freier Entschliessung, mag es auch widerstrebend gewesen sein, befehlsgemäss verrichtet.
Da er auch die Tatumstände gekannt hat, die den Beweggrund der Haupttäter für die Massentötung der jüdischen Menschen als niedrig kennzeichnen und durch seine eigene Anwesenheit auf der Rampe und an der Gaskammer auch zwangsläufig die gesamten Umstände erfahren musste und daher nach der Überzeugung des Gerichts auch erfahren hat, die die Art der Tötungen als heimtückisch und grausam kennzeichnen, hat er vorsätzlich die Mordtaten der Haupttäter unterstützt und gefördert. Irgendwelche Rechtfertigungs- oder sonstige Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich.
Der Angeklagte Dr. Frank war daher wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in mindestens sechs Fällen (§§47, 49, 211, 74 StGB) jeweils begangen in gleichartiger Tateinheit (§73 StGB) an je mindestens tausend Menschen zu verurteilen.
V. Hilfsbeweisanträge
Der Hilfsantrag des Verteidigers des Angeklagten Dr. Frank, durch eine erneute Ortsbesichtigung festzustellen, dass auf die gegebene Entfernung von 60 m Bewegungen mit der Hand oder dem Daumen nicht feststellbar sind, war gemäss §244 Abs.V StPO abzulehnen, da zur Überprüfung der behaupteten Tatsache eine Ortsbesichtigung bzw. eine Augenscheinseinnahme auf dem früheren Gelände des Konzentrationslagers Auschwitz, insbesondere dem früheren Rampengelände, nicht erforderlich ist. Das Gericht hat sich durch das erwähnte Experiment auf dem Hof des Gallushauses davon überzeugt, dass auf eine Entfernung von 60 m Bewegungen einer Person mit der Hand oder dem Daumen gut erkennbar sind.
Der zu diesem Punkt vom Verteidiger des Angeklagten Dr. Frank am 29.Juli 1965 gestellte Hilfsantrag, durch eine erneute Ortsbesichtigung festzustellen, dass unter den gegebenen örtlichen Verhältnissen - insbesondere auch durch einen in Sichtrichtung befindlichen doppelten Drahtzaun - auf eine gegebene Entfernung von mindestens 60 m
1. weder eine in Uniform gekleidete Person ihrer Person nach erkannt werden kann,
2. noch Bewegungen feststellbar sind, die der Betreffende mit der Hand ausführt,
war ebenfalls gemäss §244 Abs.V StPO abzulehnen, da nach dem Ermessen des Gerichts ein solcher Ortstermin und eine erneute Augenscheinseinnahme auf dem früheren Gelände des Konzentrationslagers Auschwitz zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich ist. Bei der Augenscheinseinnahme durch den beauftragten Richter auf dem früheren Konzentrationslagergelände ist festgestellt worden, dass der Lagerzaun zwischen dem früheren Lagerabschnitt B II d und dem früheren Rampengelände nicht mehr vorhanden ist. Auch die Baracke, aus der der Zeuge Ros. die Selektionen des Dr. Frank beobachtet hat, existiert nicht mehr. Eine Augenscheinseinnahme nach den damaligen wirklichen örtlichen Verhältnissen - wie es der Verteidiger des Angeklagten Dr. Frank beantragt -, ist daher nicht mehr möglich. Die Frage, ob eine auf dem früheren Rampengelände stehende Person auf eine Entfernung von 60 m erkannt werden kann, hat der beauftragte Richter bei dem Augenscheinseinnahmetermin auf dem früheren Konzentrationslagergelände geprüft. Er hat festgestellt, dass dies möglich ist. Die Frage, ob auf 60 m Entfernung Hand- und Daumenbewegungen einer Person erkennbar sind, ist durch das Gericht im Hof des Gallusgebäudes geprüft worden. Aus den in der Hauptverhandlung gezeigten und von allen Prozessbeteiligten in Augenschein genommenen Fotografien von der Rampe und dem Lagerzaun des Lagerabschnitts B II d ergibt sich die Beschaffenheit des das Lager umgebenden Drahtzaunes, so dass sich das Gericht ein Bild darüber machen konnte, ob eine Sichtmöglichkeit durch diesen Zaun hindurch bestanden hat. Das Gericht hat dies bejaht.
Der Hilfsbeweisantrag des Verteidigers des Angeklagten Dr. Frank, die beiden Kollegen Rechtsanwälte Nau. und Gerhard darüber zu vernehmen, dass sie weder Staatsanwalt Wie. noch den Rechtsanwalt Ste. erkannt haben, als diese sich (bei der Augenscheinseinnahme auf dem früheren Rampengelände) an dem Punkt befunden haben, an dem angeblich die Selektion durch Dr. Frank vorgenommen worden sein soll, und dass Rechtsanwalt Nau. diese seine Feststellung bei der Ortsbesichtigung laut zum Ausdruck gebracht hat, war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da die behaupteten Tatsachen so behandelt werden können, als wären sie wahr. Auch wenn die beiden Rechtsanwälte den Staatsanwalt Wie. und den Rechtsanwalt Ste. auf eine Entfernung von 60 m nicht erkannt haben, wird dadurch die Feststellung des beauftragten Richters, dass er auf diese Entfernung zwei der Person nach bekannte Prozessbeteiligte erkannt hat und zwar besonders nach ihrer Statur, nicht widerlegt. Auch wird dadurch nicht die Glaubwürdigkeit des Zeugen Ros. erschüttert und auch nicht die Möglichkeit ausgeräumt, dass er auf eine Entfernung von 60 m den Angeklagten Dr. Frank hat erkennen können, zumal nicht feststeht, ob die Sichtverhältnisse bei dem Augenscheinseinnahmetermin ebenso gut gewesen sind, wie während der Beobachtungszeit des Zeugen Ros. Nach dem Protokoll über die Ortsbesichtigung herrschte an dem betreffenden Tag diesiges Wetter.
Der Hilfsbeweisantrag, den Zeugen Menne Krat. darüber zu vernehmen, dass er den Verteidiger des Angeklagten Dr. Frank, Rechtsanwalt Dr. Latern., ermächtigt hat, vor Gericht zu erklären, dass Dr. Frank ihm das Leben gerettet habe, war ebenfalls gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da die in das Wissen des Zeugen gestellten Tatsachen zu Gunsten des Angeklagten Dr. Frank so behandelt werden können, als wären die behaupteten Tatsachen wahr. Das Gericht ist im übrigen davon ausgegangen, dass der Angeklagte Dr. Frank nach der glaubhaften Aussage des Zeugen Menne Krat. diesen aus dem Arrestbunker herausgeholt und ihn vor einem Transport bewahrt habe.
Der Hilfsbeweisantrag des Verteidigers des Angeklagten Dr. Frank, eine Auskunft des Auschwitzkomitees darüber einzuholen, dass bei der Waschbaracke im Lagerabschnitt B II d nur eine Tür, die nach den Krematorien zu gelegen, (in Richtung Norden) vorhanden gewesen sei, war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da die Erhebung dieses Beweises unzulässig ist. Die Frage, wie die Waschbaracke damals beschaffen war, insbesondere, wieviel Türen sie gehabt hat, ist eine Frage, über die ausser fotografischen Aufnahmen aus der damaligen Zeit, von deren Existenz jedoch nichts bekannt ist, nur Zeugen oder Angeklagte, die die Baracke in der damaligen Zeit gekannt haben, Auskunft geben können. Zeugen hat der Verteidiger des Angeklagten Dr. Frank jedoch nicht benannt. Angeklagte haben sich zu der Frage nicht geäussert. Das "Auschwitzkomitee", das nur eine aus einer Vielzahl von Personen bestehende Organisation ist, kann hierüber aus eigenem Wissen keine Bekundungen machen, sondern allenfalls die im "Auschwitzkomitee" befindlichen natürlichen Personen, sofern sie die Waschbaracke in der damaligen Zeit, als sie noch existierte, gesehen haben. Hierüber müssten sie aber persönlich in der Hauptverhandlung vernommen werden. Ihre Vernehmung kann nicht durch eine schriftliche Äusserung ersetzt werden (§250 Satz 2 StPO). Das "Auschwitzkomitee" kann auch nicht als Sachverständigengremium angesehen werden, das sich gutachtlich über die Beweisfrage äussern könnte. Die Beweisfrage stellt keine Sachverständigenfrage dar. Die Mitglieder der "Auschwitzkomitees" müssten, sofern sie nicht aus eigenem Wissen die Beweisfrage beantworten können, Erhebungen durch Befragen von Zeugen, die die Waschbaracke in der damaligen Zeit gekannt haben, anstellen. Das aber würde gegen den Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme verstossen. Das Gericht hat auch keine Veranlassung, von Amts wegen nach Zeugen zu suchen, die die Waschbaracke im Lagerabschnitt B II d im Jahre 1944 gekannt haben und sie über die Beschaffenheit der Waschbaracke zu vernehmen. Denn das Gericht hat keine Zweifel, dass die Aussage des Zeugen Ros. richtig ist. Irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass der Zeuge aus der Waschbaracke die Selektionen auf der Rampe nicht hätte beobachten können, sind nicht gegeben. Auch die Angeklagten haben das nicht behauptet.
VI. Strafzumessung
Der Angeklagte Dr. Frank ist zwar nicht als Arzt ausgebildet worden und war im KL Auschwitz auch nicht als Arzt eingesetzt. Als Zahnarzt gehörte er aber im weiteren Sinne zum ärztlichen Dienst. Er unterstand dem Standortarzt und dem Amt D III im WVHA. Er hatte ein ähnliches Studium wie die Ärzte absolviert. Der Eid des Hippokrates und das von den Ärzten zu fordernde Berufsethos können ihm daher nicht unbekannt geblieben sein. Bei den Vernichtungsaktionen hatte er die den Ärzten vorbehaltenen Funktionen, die allerdings zu den eigentlichen ärztlichen Aufgaben in diametralem Gegensatz standen, zu erfüllen. Wenn er sich als Zahnarzt zu diesen sog. "ärztlichen" Tätigkeiten missbrauchen liess, so gilt für den Unrechtsgehalt seiner Beihilfehandlungen das gleiche, was bereits beim Angeklagten Dr. L. unter VI. hierzu ausgeführt worden ist. Der Unrechtsgehalt seiner Beihilfehandlungen ist daher als hoch zu bewerten.
Strafmilderungsgründe sind bei dem Angeklagten Dr. Frank zwar auch vorhanden, sie fallen aber nicht so ins Gewicht, dass sie - wie bei dem Angeklagten Dr. L. - trotz des hohen Unrechtsgehalts seiner Handlungsweise als Sühne für seine Straftaten in Frage kommen könnten, die an der unteren Grenze des Strafrahmens liegen. Für den Angeklagten Dr. Frank wäre es wesentlich einfacher gewesen, sich einer Mitwirkung an der Massenvernichtung zu entziehen, da er Beziehungen zu Dr. Poo., dem zahnärztlichen Berater des Dr. Lolling, hatte, die er intensiver hätte ausnützen können. Auch hätte er als "alter Kämpfer" energischer gegenüber seinen Vorgesetzten auftreten können. Der Angeklagte Dr. Frank hat zwar Häftlinge nicht schlecht behandelt, er hat sich aber auch nicht so eifrig wie der Angeklagte Dr. L. dafür eingesetzt, um das Los der Häftlinge zu erleichtern.
Es konnte auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Angeklagte Dr. Frank bedenkenlos und willig die Verwertung der den getöteten Opfern herausgezogenen Goldzähne übernommen hat. Er hat ohne erkennbare Hemmungen das Einschmelzen des Goldes durch Häftlinge organisiert und überwacht und danach das Gold an die zuständigen Dienststellen abgeliefert. Das wirft ein ungünstiges Licht auf seine Persönlichkeit. Strafmildernd hat das Schwurgericht zu Gunsten des Angeklagten berücksichtigt, dass seine Erkrankung im Jahre 1942, die er nicht zu vertreten hatte, und der Umstand, dass er danach nur noch garnisonsverwendungsfähig war, die entscheidende Rolle für seine Versetzung in das KL Auschwitz gespielt haben mag. Wäre er gesund geblieben, wäre er ohne Zweifel bei der kämpfenden Truppe geblieben und nicht in die Massenverbrechen verstrickt worden. Als Zahnarzt wäre er auch nicht in die Massenverbrechen verwickelt worden, wenn sich die RSHA-Transporte nicht im Jahre 1944 so gehäuft hätten, dass die vorhandenen Ärzte für den Selektionsdienst nicht mehr ausreichten. Schliesslich hat ihm das Schwurgericht auch zugute gehalten, dass er sich, wenn auch nicht intensiv genug, um seine Versetzung vom KL Auschwitz bemüht hat. Das zeigt, dass er die Massenverbrechen nicht gebilligt hat.
Im Hinblick auf diese Strafmilderungsgründe hielt das Schwurgericht für jeden Fall der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord (insgesamt 6) eine Zuchthausstrafe von je 5 Jahren für eine ausreichende Sühne. Aus den 6 Einzelstrafen war gemäss §74 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden.
Bei der grossen Zahl der Opfer (mindestens 6000 Menschen), die unter der Mitwirkung des Angeklagten Dr. Frank den Tod erleiden mussten, konnte als Sühne nur eine Gesamtstrafe in Betracht kommen, die nicht unerheblich über den Einzelstrafen liegt. Das Schwurgericht hielt eine Gesamtstrafe von 7 Jahren Zuchthaus für eine angemessene Sühne.
N. Die Straftaten des Angeklagten Dr. Capesius
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Dr. Capesius
Der Angeklagte Dr. Capesius ist am 7.2.1907 als Sohn eines Arztes, der ausserdem eine Apotheke besass, in Reussmarkt/Krs.Hermannstadt (Rumänien) geboren. Er besuchte in Reussmarkt die Volksschule und das Gymnasium, an dem er im Jahre 1925 das Abitur (Rumänisches Baccalauriat) bestand. Anschliessend studierte er in Klausenburg Pharmazie. Im Jahre 1931 wurde er zum rumänischen Militärdienst eingezogen. Vom 1.5. bis 30.5.1931 machte er einen Sanitätskursus mit und wurde dann beim rumänischen Heer als Apotheker eingesetzt. Am 1.10.1931 wurde er zur Fortführung seines Studiums nach Wien beurlaubt, wo er am 28.10.1933 promovierte. Am 2.2.1934 begann er eine dreimonatige Ausbildung als wissenschaftlicher Propagandist für das deutsche Werk Bayer-Leverkusen (IG-Farbenindustrie). Anschliessend war er als wissenschaftlicher Propagandist für die IG-Farbenindustrie, die in Rumänien eine Tochtergesellschaft besass, tätig. Er besuchte in dieser Eigenschaft Ärzte, und bot die Bayer-Pharmazeutischen-Präparate an. Nach dem Wiener Schiedsspruch (1938) ging der Angeklagte nach Bukarest. 1941 und 1942 war er beim rumänischen Heer als Apotheker. Er leitete eine Kriegsspitalapotheke. Am 24.1.1942 wurde er zum Hauptmann und einige Zeit später - wie er angibt - zum Major befördert.
Nach dieser Militärdienstzeit im rumänischen Heer ging der Angeklagte wieder zu seiner Firma zurück und war weiter als Propagandist tätig.
Auf Grund eines Abkommens zwischen Deutschland und Rumänien wurde der Angeklagte im August 1943 zur deutschen Wehrmacht nach Wien eingezogen. Von dort musste er sich bei dem Sanitätszeugmeister und General der Waffen-SS Dr. Karl Blumenreuter in Berlin melden. Er wurde von diesem nach Warschau zur Aussenstelle des Zentralsanitätslagers kommandiert. Dort wurde er einen Monat in der verwaltungsmässigen Apothekerarbeit für die Waffen-SS ausgebildet. Von Warschau wurde er dann wieder nach Berlin zurückbeordert und am 24.9.1943 nach Dachau kommandiert, wo er in der Apotheke als Vertreter des Chefs, der sich an der Front bewähren sollte, eingesetzt wurde. Am 10.2.1944 musste sich der Angeklagte erneut in Berlin melden. Dr. Blumenreuter erklärte ihm, der Apotheker des KL Auschwitz, Dr. Krömer, sei erkrankt und er - Dr. Capesius - solle ihn vertreten. Der Angeklagte trat am 12.2.1944 seinen Dienst in Auschwitz als Apotheker an.
Der Angeklagte war nach seiner Übernahme in die SS, entsprechend seinem Dienstgrad bei dem rumänischen Heer, am 1.8.1943 zum Hauptsturmführer befördert worden. Am 9.11.1944 wurde er in Auschwitz zum SS-Sturmbannführer befördert. Er blieb in Auschwitz als Apotheker bis zur Evakuierung des Lagers im Januar 1945.
Am 18.1.1945 verliess der Angeklagte mit anderen SS-Angehörigen und einigen Häftlingen das Lager Auschwitz mit einem Sanka um sich nach Berlin abzusetzen. Er erreichte Berlin und meldete sich bei dem SS-Sturmbannführer Dr. Lolling. Dieser schickte ihn zu dem KZ Mauthausen. Da dort bereits ein Apotheker war, kehrte der Angeklagte wieder nach Berlin-Oranienburg zurück. Er übte jedoch keine dienstliche Tätigkeit mehr aus.
Gegen Kriegsende geriet er in Schleswig-Holstein in englische Kriegsgefangenschaft. Er wurde in das KZ Neuengamme zur Überprüfung gebracht. Am 23.5.1946 wurde er aus der englischen Kriegsgefangenschaft entlassen. Er ging nach Stuttgart, wo er in der Bismarckstrasse 48 unter seinem richtigen Namen wohnte und polizeilich gemeldet war. Da er wegen seiner SS-Zugehörigkeit zunächst keine Anstellung finden konnte, studierte er Elektrotechnik an der Technischen Hochschule in Stuttgart. Bei einem Besuch in München im Juli 1946 wurde er von einem früheren Häftling des Konzentrationslagers Auschwitz wiedererkannt, durch die amerikanische Militärpolizei verhaftet und in ein Gefängnis in München eingeliefert. Nach etwa 6 bis 8 Wochen Haft kam er in das Lager Dachau und am 18.12.1946 in das Lager Ludwigsburg. Am 2.8.1947 wurde er aus dem Internierungslager in Ludwigsburg nach Stuttgart entlassen. Anschliessend arbeitete er bis zum Jahre 1950 als angestellter Apotheker in der Reitelsberg-Apotheke in Stuttgart.
Am 5.10.1950 eröffnete er die Markt-Apotheke in Göppingen, die er seit dieser Zeit als selbständiger Apotheker betreibt. In Reutlingen betreibt der Angeschuldigte noch daneben einen Kosmetiksalon. Er beschäftigt insgesamt 12 Angestellte und erzielte in den letzten Jahren vor seiner Verhaftung einen Umsatz von durchschnittlich 400000 DM im Jahr.
Der Angeklagte hat am 28.1.1934 geheiratet. Aus der Ehe sind 3 - inzwischen volljährig gewordene - Töchter hervorgegangen. Die Ehefrau des Angeklagten ist im Jahre 1963 aus Rumänien in die Bundesrepublik gekommen. Die ältere Tochter (geboren 1935) befindet sich noch in Rumänien. Die beiden anderen Töchter studieren in der Bundesrepublik Biologie bzw. Pharmazie. Der Angeklagte befindet sich auf Grund des Haftbefehls des Amtsgerichts in Frankfurt am Main vom 3.12.1959 seit dem 4.12.1959 in dieser Sache in Untersuchungshaft.
II. Die Mitwirkung des Angeklagten Dr. Capesius an der Massentötung der jüdischen Menschen in Auschwitz (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
Der Angeklagte Dr. Capesius hat ebenfalls bei der Massentötung der mit RSHA-Transporten angekommenen jüdischen Menschen mitgewirkt. Er wurde nach der bereits erwähnten Ärztebesprechung im Frühjahr 1944 bei Dr. Wirths wie die anderen SS-Ärzte wiederholt zum Rampendienst eingeteilt. Er war auch in einer unbestimmten Anzahl von Fällen nach der Ankunft von RSHA-Transporten auf der Rampe in Birkenau. Dort hat er auch den Rampendienst, zu dem er eingeteilt war, verrichtet.
Im einzelnen konnte das Schwurgericht folgende Fälle feststellen, in denen sich der Angeklagte Dr. Capesius nach der Ankunft von RSHA-Transporten betätigt hat:
1. Am 29.5.1944 kam ein RSHA-Transport in einem Güterzug aus Siebenbürgen, das damals zu Ungarn gehörte, mit jüdischen Menschen auf der Rampe in Birkenau an. Die Menschen mussten aus den Waggons aussteigen und wurden auf der Rampe von niederen SS-Dienstgraden - wie üblich - aufgestellt. Auf der Rampe befanden sich unter anderem die SS-Ärzte Dr. Mengele und Dr. Klein und der Angeklagte Dr. Capesius. Mit dem Transport waren auch der Zeuge Dr. Bern., der damals schon Arzt war, und die Zeugin Gisela Böh., die von Beruf Kinderärztin ist, mit ihrer Tochter Ella, der Zeugin Sa. geb. Böh. angekommen. Letztere war damals 21 Jahre alt. Nachdem die angekommenen Menschen nach Geschlechtern getrennt aufgestellt worden waren, wurden die Ärzte und Apotheker herausgerufen und an einer bestimmten Stelle etwas abseits von den anderen versammelt. Es waren 50-70 Personen. Unter ihnen befand sich auch der Zeuge Dr. Bern. Dr. Mengele und Dr. Capesius unterhielten sich mit einigen Ärzten freundlich. Dr. Mengele gestattete dem Zeugen Dr. Bern. auf seine Bitte hin, sein Arztdiplom aus seinem Reisegepäck zu holen. Dann gab Dr. Mengele bekannt, dass die Kranken und die Kinder, sowie alle, die müde seien, mit dem Wagen fahren könnten. Es seien LKWs da, die sie besteigen könnten. Es sei noch ein weiter Weg von mindestens 10 km im Fussmarsch zurückzulegen. Der Angeklagte Dr. Capesius übersetzte diese Worte in die ungarische Sprache. Auf seine Ankündigung hin meldete sich unter anderen ein Apotheker namens Kövarie, der nur ungarisch verstand. Ein Arzt Dr. Löwenstein, der deutsch verstand, hatte sich schon auf die Aufforderung des Dr. Mengele hin gemeldet. Beide Herren, die sich zunächst in der Gruppe der Ärzte befunden hatten, schickte Dr. Mengele auf die andere Seite. Auch die Zeugin Sa. wollte die Fahrgelegenheit wahrnehmen, da sie sich sehr müde fühlte. Die Zeugin Böh. bestand jedoch darauf, zu Fuss zu gehen. Deswegen gab es noch zwischen ihr und ihrer Tochter einen kleinen Streit. Die Zeugin Böh. wurde von Dr. Mengele, der offenbar den Disput zwischen den beiden Zeuginnen gehört hatte, gefragt, wie alt sie sei. Die Zeugin gab ihr Alter an, wobei sie sich einige Jahre jünger machte. Dr. Mengele erklärte daraufhin, dann könne sie laufen. Beide Zeuginnen wurden später in das Lager aufgenommen.
Nach dieser Begebenheit rückten die in Reihen aufgestellten jüdischen Menschen auf Befehl der SS-Unterführer und SS-Männer zu Dr. Mengele vor. Dieser bestimmte, wer von ihnen in das Lager aufgenommen und wer durch Gas getötet werden sollte, indem er sie entweder nach rechts oder nach links schickte. Diejenigen, die auf die linke Seite geschickt wurden, waren für den Tod bestimmt. Die Ehefrau des Zeugen Dr. Bern. ging mit den beiden Kindern des Zeugen, zwei Zwillingskindern, ebenfalls auf Weisung des Dr. Mengele auf die linke Seite. Der Zeuge bat daraufhin Dr. Capesius, ihn bei seiner Familie zu lassen mit dem Hinweis, dass die beiden Kinder Zwillingskinder seien und der Schonung bedürften. Er selbst sei bereit, jede Arbeit anzunehmen. Dr. Capesius sagte daraufhin zu dem Zeugen, er solle die beiden Kinder zurückrufen. Nachdem der Zeuge seine Frau und die beiden Kinder zurückgeholt hatte, nahm Dr. Capesius die Kinder an der Hand und führte sie zu Dr. Mengele. Der Zeuge Bern. wiederholte diesem gegenüber, dass er Zwillingskinder habe, konnte jedoch nicht weiter sprechen, da Dr. Mengele abwinkte mit der Bemerkung, dass er keine Zeit habe. Er vertröstete den Zeugen auf später. Dr. Capesius erklärte daraufhin dem Zeugen, er müsse nun die Kinder wieder zurückbringen. Der Zeuge, dem die Tränen kamen, brachte daraufhin seine Frau und die beiden Kinder wieder in die Reihe der Menschen zurück, die auf die linke Seite geschickt worden waren. Der Angeklagte Dr. Capesius sagte zu dem Zeugen, als er dessen Tränen sah, er solle nicht weinen, seine Frau und die beiden Kinder würden nur gebadet, in einer Stunde sei er wieder mit ihnen zusammen. Der Zeuge Dr. Bern. glaubte dieser Versicherung des Angeklagten. Er sah jedoch seine Frau und seine beiden Kinder nie wieder. Sie wurden mit den anderen für den Tod bestimmten Juden in einer der Gaskammern durch Zyklon B getötet. Der Arzt Dr. Löwenstein und der Apotheker Kövarie sind ebenfalls in die Gaskammer gebracht und dort durch Zyklon B getötet worden.
2. In der Nacht vom 3. zum 4.6.1944 kam ein RSHA-Transport mit jüdischen Menschen aus Siebenbürgen/Ungarn auf der Rampe in Birkenau an. In dieser Nacht hatte der Angeklagte Dr. Capesius Rampendienst. Nachdem die jüdischen Menschen ausgestiegen waren, und von niederen SS-Dienstgraden - wie üblich - getrennt aufgestellt worden waren, bestimmte der Angeklagte Dr. Capesius, wer von den jüdischen Männern und Frauen, die nicht schon von den niederen SS-Dienstgraden wegen Gebrechlichkeit, zu geringen oder zu hohen Alters von vornherein abgesondert worden waren, in das Lager aufzunehmen und wer in die Gaskammer zu bringen sei, indem er sie nach rechts oder links schickte. Unter den jüdischen Menschen, die an dem Angeklagten Dr. Capesius zur Musterung ihrer Arbeitstauglichkeit vorbeizugehen hatten, befand sich auch die Zeugin Ne. Mit ihr zusammen war ihr Vater, eine Schwester und drei Brüder. Die Zeugin kannte den Angeklagten Dr. Capesius von früher. Als sie zu ihm kam, erkannte sie ihn sofort wieder. Der Angeklagte fragte sie auf deutsch, wie alt sie sei. Dann schickte er sie zu der Gruppe, die in das Lager aufgenommen werden sollte. Die Zeugin wollte danach noch einmal zu Dr. Capesius zurückkehren, um mit ihm zu sprechen. Sie fragte einen SS-Mann, der ein Gewehr trug: "Sagen Sie bitte, ist das nicht Dr. Capesius?". Der SS-Mann war erstaunt und erwiderte: "Doch, das ist Dr. Capesius, woher kennen Sie ihn?" Die Zeugin antwortete: "Aus Rumänien." Der Zeugin gelang es jedoch nicht mehr, zu Dr. Capesius zurückzukehren. Der SS-Mann führte sie zusammen mit anderen für das Lager ausgewählten Häftlingen in das Bad zum Duschen und Einkleiden. Der Vater der Zeugin, zwei Brüder und eine Schwester mit ihren Kindern wurden nicht in das Lager aufgenommen. Sie kamen mit den anderen jüdischen Menschen, die mit dem Transport angekommen und als nicht arbeitstauglich beurteilt worden waren, in eine der Gaskammern und wurden dort durch Zyklon B getötet.
3. In der nächsten Nacht, der Nacht vom 4. zum 5.6.1944 kam gegen 24 Uhr ein RSHA-Transport mit jüdischen Menschen aus einem Ghetto in Ungarn auf der Rampe in Birkenau an. Auch in dieser Nacht hatte der Angeklagte Dr. Capesius Rampendienst. Nachdem die jüdischen Menschen aus den Waggons gestiegen und von den niederen SS-Dienstgraden aufgestellt worden waren, musterte der Angeklagte Dr. Capesius die jüdischen Männer und Frauen, die an ihm vorbeigeschickt wurden, auf ihre Arbeitstauglichkeit. Er bestimmte, wer von ihnen in das Lager aufgenommen und wer zur Tötung in die Gaskammern zu bringen sei, indem er die einen mit einer Handbewegung nach rechts und die anderen nach links schickte. Wer nach rechts geschickt wurde, kam später in das Lager, während die anderen, die nach links gewiesen worden waren, später in eine der Gaskammern verbracht und dort durch Zyklon B getötet wurden. In dem RSHA-Transport befand sich auch der Zeuge Pajo., sowie einige Bekannte des Zeugen, so die Juden Simon Lazar, Friemann, Kellmann, Szcecel, Samuel und Goldglanz. Der Zeuge Pajo. wurde von dem Angeklagten Dr. Capesius, als er sich ihm zur Musterung näherte, wie folgt auf ungarisch angesprochen: "Sind Sie nicht ein Apotheker?" Der Zeuge antwortete: "Jawohl!" Dr. Capesius fragte daraufhin weiter: "Sind Sie aus Nemvorosch (Rumänisch: Oradea)?" Als der Zeuge dies bejahte, murmelte der Angeklagte Dr. Capesius etwas vor sich hin auf ungarisch. Der Zeuge verstand etwas wie: "Am Eck." Dann schickte der Angeklagte den Zeugen nach rechts. Der Zeuge kam anschliessend in das Lager, blieb dort jedoch nur vier Tage. Dann wurde er mit einem Transport in ein anderes Lager gebracht. Den Simon Lazar schickte der Angeklagte Dr. Capesius nach links. Er wurde mit den anderen für den Tod bestimmten Opfern durch Zyklon B in einer der Gaskammern getötet. Auch die anderen oben aufgeführten Bekannten hat der Zeuge nie wieder gesehen.
4. In der Nacht vom 10. auf den 11. oder vom 11. auf den 12.Juni 1944 hatte der Angeklagte Dr. Capesius erneut Rampendienst.
Gegen 3 Uhr oder 4 Uhr am 11. oder 12.Juni kam ein RSHA-Transport aus Clausenburg in Siebenbürgen auf der Rampe in Birkenau an. Der Zug blieb zunächst einige Zeit verschlossen auf der Rampe stehen. Gegen 4 Uhr oder 5 Uhr wurden die Waggons geöffnet. Die jüdischen Menschen mussten aussteigen. Unter ihnen befanden sich 12 Ärzte aus dem Ghettospital in Clausenburg und etwa 250 bis 300 Schwerkranke aus dem gleichen Spital. Die Kranken wurden zunächst auf die Erde hingelegt. Es entstand ein grosses Durcheinander. Die Männer schrien und die Frauen und Kinder weinten. Der Zeuge Dr. Schli., der zu den zwölf Ärzten aus dem Spital gehörte, sah sich hilfesuchend um. Dabei bemerkte er den Angeklagten Dr. Capesius, den er von früher her kannte, etwas abseits auf der Rampe stehen. Er lief voll Freude zu ihm hin, grüsste ihn und fragte, wo man sich befinde. Der Angeklagte antwortete, sie seien in Mitteldeutschland, was der Zeuge jedoch nicht glaubte, weil er unterwegs Bahnstationen mit slawischen Namen gesehen hatte. Der Zeuge fragte dann den Angeklagten weiter, was mit ihnen geschehen werde. Der Angeklagte antwortete, es werde alles gut. Der Zeuge erklärte dann dem Angeklagten Dr. Capesius, dass seine Frau nicht ganz gesund sei. Daraufhin bedeutete der Angeklagte dem Zeugen, dass sie sich zu einer bereits gesondert aufgestellten Gruppe von Kranken stellen solle, indem er sagte, sie solle sich dorthin stellen und mit der Hand auf diese Gruppe zeigte. Der Zeuge lief daraufhin zu seiner Frau und seiner bei ihr befindlichen 17jährigen Nichte, die inzwischen mit den anderen jüdischen Männern und Frauen in Reihen aufgestellt worden waren, zurück und sagte ihnen, dass sie sich zur Gruppe der Kranken stellen müssten. Seine Ehefrau ging daraufhin zu der Gruppe der Kranken hin. Ihre 17jährige Nichte nahm sie mit.
Der Angeklagte Dr. Capesius musterte dann die jüdischen Männer und Frauen, die nicht schon vorher mit den Kranken abgesondert waren, auf ihre Arbeitstauglichkeit. Zuerst rückten die Frauen in Reihen vor und marschierten an dem Angeklagten Dr. Capesius vorbei. Dieser schickte sie mit einer Handbewegung entweder nach rechts oder nach links. Wer nach links geschickt wurde, kam später in das Lager. Alle die nach rechts gewiesen wurden, wurden später mit den Kranken und bereits vorher ausgesonderten Menschen in eine der Gaskammern verbracht und dort mit Zyklon B getötet. Unter den Frauen, die von dem Angeklagten Dr. Capesius auf ihre Arbeitstauglichkeit gemustert wurden, befanden sich auch die Zeugin Dr. Krau., die damals 21 Jahre alt war, und ihre Mutter sowie ihre Schwester, die damals 11 Jahre alt war. Die Zeugin wurde von dem Angeklagten Dr. Capesius nach links geschickt und anschliessend in das Lager aufgenommen. Ihre Mutter, die Ärztin war und eine Arztbinde trug, und ihre Schwester wurden nach rechts geschickt und später in einer der Gaskammern durch Zyklon B getötet. Im gleichen Transport befand sich auch der Vater der Zeugin Dr. Krau. Dieser kannte den Angeklagten Dr. Capesius von früher her. Er marschierte in der Reihe der Männer hinter den Reihen der Frauen. Nachdem Dr. Capesius die Frauen selektiert hatte, musterte er die Männer auf ihre Arbeitstauglichkeit. Als der Vater der Zeugin, der Arzt war und ebenfalls eine Arztbinde trug, vor dem Angeklagten erschien, erkannte er ihn sofort. Er erklärte ihm, dass seine Frau und seine Mutter auf der anderen (rechten) Seite seien. Daraufhin sagte Dr. Capesius: "Dann schicke ich Sie auch dorthin, das ist ein guter Ort." Der Vater der Zeugin wurde daraufhin nach rechts geschickt. Er wurde anschliessend mit den anderen für den Tod bestimmten Menschen in einer der Gaskammern durch Zyklon B getötet.
Von allen vier Transporten sind mindestens je 2000 Menschen durch Zyklon B in einer der Gaskammern in Birkenau getötet worden.
Der Angeklagte Dr. Capesius war sich in allen geschilderten Fällen darüber im klaren, welchen Sinn der Selektionsdienst hatte. Er wusste, dass er in den Fällen 2-4 die Arbeitstauglichkeit der jüdischen Männer und Frauen zu beurteilen hatte und dass nur die, die er als arbeitsfähig zur Aufnahme in das Lager bestimmte, am Leben blieben, während alle anderen, die er nach der anderen Seite stellte, anschliessend durch Zyklon B in einer der Gaskammern getötet wurden. Im Falle 1 war ihm bekannt, dass Dr. Mengele die jüdischen Menschen entweder für die Aufnahme in das Lager oder für den Gastod bestimmte und dass die grössere als arbeitsunfähig beurteilte Gruppe anschliessend in einer der Gaskammern getötet wurde. Er wusste auch, dass die Erklärung des Dr. Mengele, die er anschliessend in die ungarische Sprache übersetzte, es sei noch ein Fussmarsch von mindestens 10 km zurückzulegen, nicht den Tatsachen entsprach, sondern die Opfer nur bestimmen sollte, freiwillig die LKWs zu besteigen, mit denen sie zur Tötung zu einer der Gaskammern gebracht wurden. Schliesslich war dem Angeklagten Dr. Capesius auch bekannt, dass die jüdischen Menschen nur wegen ihrer Abstammung als Angehörige einer sog. "minderwertigen" Rasse unschuldig getötet wurden.
Der Angeklagte Dr. Capesius hat auch mindestens zweimal den ärztlichen Dienst an der Gaskammer verrichtet. Er hat in diesen beiden Fällen den Desinfektoren das Zeichen zum Einwerfen des Zyklon B gegeben und sich dafür bereit gehalten, ihnen im Falle einer Vergiftung ärztliche Hilfe mit dem Sauerstoffgerät zu leisten. Nach dem Einschütten des Zyklon B hat er den Todeskampf der in der Gaskammer eingeschlossenen Menschen beobachtet und das Zeichen für die Öffnung der Gaskammern gegeben, nachdem die Opfer nach seiner Meinung tot waren. Nach der Öffnung der Gaskammer hat er den Tod der Opfer festgestellt und die Leichen für die Verbrennung freigegeben.
III. Einlassung des Angeklagten Dr. Capesius, Beweismittel, Beweiswürdigung
Der Angeklagte Dr. Capesius hat eingeräumt, dass er nach der bereits mehrfach erwähnten Besprechung im Frühjahr 1944 als Apotheker zum Rampendienst eingeteilt worden ist. Er behauptet jedoch, dass der mit ihm befreundete Arzt Dr. Klein stets den Rampendienst übernommen und für ihn den Selektionsdienst auf der Rampe gemacht habe. Er selbst habe nie selektiert. Allerdings sei er oft zur Rampe gegangen, um das Gepäck der mit den RSHA-Transporten angekommenen Ärzte sicher zu stellen. Dr. Wirths habe nämlich angeordnet, dass das Gepäck dieser Ärzte zur Apotheke zu bringen sei. Deswegen habe er sich persönlich darum gekümmert, dass das Gepäck auch tatsächlich zur Apotheke gebracht werde. Bei der Sicherstellung des Gepäcks auf der Rampe sei es vorgekommen, dass er mit Ärzten aus den RSHA-Transporten gesprochen habe oder von diesen angesprochen worden sei.
Die Einlassung des Angeklagten Dr. Capesius, er habe Ärztegepäck auf der Rampe sichergestellt und zur Apotheke bringen lassen, ist zutreffend. Sie wird von einer Reihe von Zeugen bestätigt. So hat der Zeuge Gol., der als Reiniger im SS-Reviergebäude, in dem sich die SS-Apotheke befand, tätig gewesen ist, glaubhaft bekundet, dass der Angeklagte Dr. Capesius jedes Mal, wenn er von der Rampe zurückgekommen sei, viel Gepäck mitgebracht habe. Dafür habe er - der Zeuge - sich interessiert, weil im Gepäck viel Lebensmittel gewesen seien. Auch der Zeuge Sik., der als Häftlingsapotheker in der SS-Apotheke beschäftigt war, hat bestätigt, dass Dr. Capesius oft zur Rampe gefahren und von dort Koffer mitgebracht hat. Der Zeuge Pro., der im SS-Reviergebäude in der der SS-Apotheke angeschlossenen Häftlingsapotheke arbeitete, hat einmal beobachtet, dass der Angeklagte Dr. Capesius von der Rampe Koffer mitgebracht hat. Die Tätigkeit des Angeklagten Dr. Capesius erschöpfte sich jedoch - entgegen seiner Einlassung - nicht in der Sicherstellung von Ärztegepäck. Auf Grund der Beweisaufnahme steht fest, dass er darüber hinaus Rampendienst wie die SS-Ärzte versehen und nach der Ankunft von RSHA-Transporten entweder bei den Selektionen mitgeholfen oder selbst darüber entschieden hat, wer in das Lager aufzunehmen und wer in die Gaskammer zur Tötung mit Zyklon B zu bringen sei.
Im einzelnen konnten die Feststellungen wie folgt getroffen werden:
Zu II.1.
Die Feststellungen unter II.1. beruhen auf der glaubhaften Aussage des Zeugen Dr. Bern. und den glaubhaften Bekundungen der Zeuginnen Dr. Böh. und Sa. Der Zeuge Dr. Bern. ist - wie er glaubhaft bekundet hat - am 29.5.1944 mit einem RSHA-Transport auf der Rampe in Birkenau angekommen. Der Zeuge ist sicher, dass der Ankunftstag der zweite Pfingsttag, und zwar der 29.5.1944 gewesen ist. Das Gericht hat sich davon überzeugt, dass im Jahre 1944 der Pfingstsonntag auf den 29.5.1944 gefallen ist. Der Zeuge hat mit aller Bestimmtheit erklärt, dass sich die Daten in seinem Kopf eingeprägt hätten und er sich dieser Daten ganz sicher sei. Mit dem gleichen Transport sind die Zeuginnen Dr. Böh. und Sa. angekommen. Die Zeuginnen wussten allerdings nicht mehr genau ihren Ankunftstag. Sie waren aber sicher, dass sie im gleichen Transport wie Dr. Bern. nach Auschwitz deportiert worden sind. Die Zeugin Sa. hatte während der Fahrt die beiden Kinder des Dr. Bern. auf dem Schoss. Alle drei Zeugen haben übereinstimmend glaubhaft bekundet, dass der Angeklagte Dr. Capesius auf der Rampe gewesen sei. Alle drei kannten den Angeklagten Dr. Capesius. Die Zeuginnen Dr. Böh. und Sa. hatten ihn in ihrer Heimat kennengelernt. Der Ehemann der Zeugin Dr. Böh. war Arzt gewesen. Er war von dem Angeklagten Dr. Capesius in seiner Eigenschaft als Propagandist einer Tochtergesellschaft der IG-Farbenindustrie, der Firma Bayer, in seiner Praxis aufgesucht worden. Dabei hatten ihn die beiden Zeuginnen gesehen. Die Zeugin Sa., die bei dem damaligen Besuch 12 oder 13 Jahre alt war, konnte sich noch erinnern, dass ihr der Angeklagte Dr. Capesius im Ordinationszimmer ihres Vaters, in das sie hereingerufen worden sei, Löschpapier und ein Notizbuch geschenkt habe, weswegen sie sich noch bei ihren Klassenkameradinnen gerühmt hatte. Der Angeklagte Dr. Capesius hat nicht geleugnet, die beiden Zeuginnen, insbesondere Frau Böh., gekannt zu haben. Er hat noch dafür gesorgt, dass die Zeugin Sa. Verwendung als Stubendienst in einer Häftlingsapotheke fand und so eine grössere Chance zum Überleben hatte. Vor Beginn des Winters 1944/1945 wurden beide Zeuginnen - wahrscheinlich auf Veranlassung des Angeklagten Dr. Capesius - in das Stammlager gebracht, wo sie grössere Überlebenschancen hatten.
Die Zeuginnen haben den Angeklagten Dr. Capesius auf der Rampe - wie sie glaubhaft versichert haben - wiedererkannt. Sie haben ihn zusammen mit zwei Ärzten, die sie bei ihrer Ankunft noch nicht kannten, gesehen. Später im Lager lernten sie die beiden Ärzte als Dr. Mengele und Dr. Klein kennen. Die Zeuginnen haben nicht gesehen und nicht behauptet, dass der Angeklagte Dr. Capesius selbst selektiert habe. Sie haben ihn nur bei Dr. Mengele und Dr. Klein stehen sehen. Auch der Zeuge Dr. Bern. hat nicht behauptet, dass Dr. Capesius selbst selektiert habe. Der Zeuge hat den Angeklagten ebenfalls von früher her gekannt. Der Angeklagte hat ihn als Vertreter der Tochtergesellschaft der IG-Farbenindustrie in seiner Arztpraxis aufgesucht. Der Zeuge hat ihn daher auf der Rampe in Birkenau sofort wiedererkannt. Auch seine Arztkollegen, die mit dem gleichen Transport angekommen und die früher ebenfalls von Dr. Capesius aufgesucht worden waren, erkannten den Angeklagten sofort wieder. Die Ärzte bestätigten sich noch gegenseitig - wie der Zeuge Dr. Bern. weiter glaubhaft bekundet hat -, dass sie erstaunt darüber seien, den Angeklagten Dr. Capesius hier wieder zu treffen, dass er es aber tatsächlich sei.
Das Gericht hat daher keinen Zweifel, dass die drei Zeugen den Angeklagten zutreffend wiedererkannt haben und eine Verwechslungsmöglichkeit ausscheidet. Eine Verwechslung mit Dr. Klein, die der Angeklagte Dr. Capesius immer wieder behauptet hat, scheidet auch schon deswegen aus, weil Dr. Klein selbst mit auf der Rampe gewesen ist.
Der Zeuge Dr. Bern. hat gehört, wie der Angeklagte Dr. Capesius die Anweisungen des Dr. Mengele in die ungarische Sprache übersetzt hat und unter anderen auf ungarisch gesagt hat, dass noch ein weiter Weg von mindestens 10 km zurückzulegen sei und dass die Kranken und müden Ankömmlinge mit LKWs fahren könnten. Der Zeuge Dr. Bern. hat auch gesehen, dass sich der Arzt Dr. Löwenstein auf die Ankündigung des Dr. Mengele hin und der Arzt Dr. Kövarie auf die von Dr. Capesius ins Ungarische übersetzte Ankündigung hin gemeldet haben und dass sie dann von Dr. Mengele auf die andere Seite geschickt worden sind. Er hat beide nie wieder gesehen. Das Gericht hat aus den geschilderten Umständen den Schluss gezogen, dass beide zu der Gruppe der Kranken und nicht Arbeitsfähigen geschickt worden sind und später mit diesen in einer der Gaskammern getötet worden sind.
Der Zeuge Dr. Bern. hat auch über das Schicksal seiner Familie berichtet. Die Feststellungen hierüber beruhen auf seiner glaubhaften Aussage. Es kann kein Zweifel bestehen, dass seine Frau und seine Kinder in einer der Gaskammern durch Zyklon B getötet worden sind. Hierfür spricht allein schon die Tatsache, dass sie zu der Gruppe hingeschickt worden sind, die nicht in das Lager aufgenommen worden ist. Es ergibt sich ferner daraus, dass der Zeuge Dr. Bern. sie später nie wiedergesehen und nie mehr etwas von ihnen gehört hat. Der Zeuge Dr. Bern. hat glaubhaft geschildert dass der Angeklagte Dr. Capesius ihn damit getröstet habe, dass seine Frau und seine Kinder nur gebadet würden und er in einer Stunde wieder mit ihnen vereint sei. Das habe er geglaubt, zumal noch ein Wagen mit dem Roten Kreuz auf der Rampe gestanden habe, was ihm Vertrauen eingeflösst habe. Das Gericht hat keine Veranlassung, an der Richtigkeit der Angaben des Zeugen zu zweifeln. Der Zeuge hat einen glaubwürdigen Eindruck gemacht. Er hat bereits im Jahre 1945 in einem Buch, das er in Dachau geschrieben hat und das den Titel trägt: "Oh, Du mein auserwähltes Volk!", das gleiche wie in der Hauptverhandlung geschildert, ohne allerdings den Namen des Angeklagten Dr. Capesius zu erwähnen. Das mindert jedoch den Wert seiner Aussage nicht. Denn der Zeuge hat eine einleuchtende Erklärung dafür gegeben, dass er den Namen des Angeklagten Dr. Capesius in seinem Buch nicht erwähnt hat: Er habe dem Angeklagten, so hat der Zeuge überzeugend dargetan, kein Denkmal setzen wollen.
Der Angeklagte Dr. Capesius hat geltend gemacht, er sei an Pfingsten 1944 überhaupt nicht in Auschwitz gewesen. Er habe sich vielmehr an den Pfingstfeiertagen in Berlin aufgehalten. Zum Beweis für sein angebliches Alibi hat er sich auf das Zeugnis der Zeugin Lx. berufen. Die Zeugin konnte jedoch den Pfingstbesuch des Angeklagten Dr. Capesius in Berlin nicht bestätigen. Sie hat lediglich von einem Besuch des Angeklagten Dr. Capesius zusammen mit Dr. Klein im Herbst 1944 berichtet und hat gemeint, dass "mit mehr oder weniger Sicherheit" anzunehmen sei, dass Dr. Capesius auch schon Anfang 1944 in Berlin gewesen sei. Auf ein bestimmtes Datum konnte sich die Zeugin jedoch nicht festlegen. Die Zeugin erschien im übrigen unglaubwürdig. Zunächst behauptete sie, dass bei dem Besuch des Angeklagten Dr. Capesius und des Dr. Klein, den sie bis dahin noch nicht kannte, zwar über Auschwitz, jedoch nicht über Details gesprochen worden sei. Auf späteres Befragen erklärte sie jedoch, Dr. Klein habe ihr gesagt, dass er den Dr. Capesius von allen unangenehmen Sachen entlaste, ihm - Dr. Klein - wäre sowieso nicht mehr zu helfen und er möchte nicht, dass sich Dr. Capesius mit irgendwelchen Dinge belaste. Beide hätten erzählt, dass sich in Auschwitz schlimme Sachen abspielten. Details seien jedoch nicht erzählt worden. Dann erklärte die Zeugin jedoch auf Vorhalt und weiteres Befragen, man habe bei diesem Besuch auch erzählt, dass in Auschwitz Leute umgebracht und vergast würden. Es sei auch darüber gesprochen worden, dass das Juden seien. Wie die Menschen in die Gaskammern kämen und wie sie umgebracht würden, das hätten die beiden nicht erzählt. Sie hätten aber erzählt, dass die Leute am Bahnhof ausgeladen würden und in diesem Zusammenhang habe Dr. Klein gesagt, dass er es übernommen habe, den Dr. Capesius von allen unangenehmen Dingen zu entlasten. Man habe davon gesprochen, dass am Bahnhof die Menschen nach ihrem Gesundheitszustand "aussortiert" worden seien.
Abgesehen davon, dass die Aussage der Zeugin in sich widerspruchsvoll ist, fällt auf, dass gerade über die Punkte gesprochen worden sein soll, die für die Entlastung des Angeklagten Dr. Capesius wichtig sind und seine Einlassung, Dr. Klein hätte für ihn Rampendienst übernommen, indirekt bestätigen könnten, während über sonstige Einzelheiten nicht gesprochen worden sein soll. Es erscheint auch unwahrscheinlich, dass Dr. Klein einer ihm fremden Frau gegenüber über Dinge, die der strengsten Geheimhaltung unterlagen, gesprochen haben soll. Zieht man noch in Betracht, dass die Zeugin, deren Mann Sturmbannführer der Waffen-SS im Sanitätslager der Waffen-SS gewesen ist, mit einem Bekannten des Angeklagten Dr. Capesius namens Eisler, der für den Angeklagten Entlastungszeugen gesucht hat, mehrfach zusammengetroffen ist - wie sie einräumen musste - so verdient ihre Aussage keinen Glauben. Im übrigen könnten die präzisen Angaben der drei genannten Zeugen auch nicht durch die von der Zeugin behauptete Erzählung des Dr. Klein in Berlin erschüttert werden.
Zu II.2.
Die Feststellung unter II.2. beruhen auf der glaubhaften Aussage der Zeugin Ne. Auch diese Zeugin hat den Angeklagten Dr. Capesius von früher her gekannt. Nach ihrer glaubhaften Bekundung hat sie in den Jahren 1935 bis 1938 bei einem Herrn Rota im Parterre eines Hauses in Bukarest als dessen Gesellschafterin gewohnt. Im zweiten Stock des gleichen Hauses wohnte damals der Angeklagte Dr. Capesius. Die Zeugin hat den Angeklagten vom Ansehen und dem Namen nach gekannt. Sie hat damals auch mit ihm und seiner Ehefrau gesprochen. Der Angeklagte Dr. Capesius hat bestätigt, dass er tatsächlich im gleichen Hause wie die Zeugin gewohnt habe. Er hat auch eingeräumt, den Herrn Rota gekannt zu haben. Wahrscheinlich habe er auch - so hat er ferner gemeint - seine Gesellschafterin gekannt. Die Zeugin hat dann weiter bekundet, dass sie im Jahre 1939 den Angeklagten Dr. Capesius und seine Ehefrau noch einmal in Bistritz zufällig getroffen habe. Beide hätten sie freundschaftlich gegrüsst. Dann seien sie zusammen in den Park gegangen und hätten noch ein Bier zusammen getrunken. Letzteres hat der Angeklagte Dr. Capesius allerdings in Abrede gestellt. Insoweit glaubt das Gericht jedoch der Zeugin. Denn es ist nicht ersichtlich, warum die Zeugin eine solche Nebensächlichkeit erfunden haben sollte. Möglicherweise hat der Angeklagte dieses zufällige Treffen auch vergessen. Es kann somit kein Zweifel bestehen, dass die Zeugin den Angeklagten Dr. Capesius genau gekannt hat.
Die Zeugin hat glaubhaft geschildert, dass sie nach ihrer Ankunft auf der Rampe in Birkenau in einem der SS-Führer sofort den Angeklagten Dr. Capesius wiedererkannt habe. Sie habe sich zuerst gefreut, als sie ihn gesehen habe. Denn sie habe gedacht, er würde sie wegen ihrer früheren Bekanntschaft mit ihrer Familie zusammenlassen. Sie habe aber keinen Mut mehr gehabt, ihn zu fragen, weil er so kalt nach ihrem Alter gefragt und sie anscheinend nicht erkannt habe.Das erscheint nach der gegebenen Situation einleuchtend und glaubhaft. Ebenso ist es verständlich, dass die Zeugin, nachdem sie bereits zu der Gruppe der Arbeitsfähigen geschickt worden war, noch einmal zu Dr. Capesius zurückeilen wollte. Es erscheint nur natürlich, dass sie recht bald den Schock über die Kälte und die Gleichgültigkeit des Angeklagten Dr. Capesius überwunden und sich aus Sorge um ihre Familienangehörigen wieder aufgerafft hat, den Angeklagten Dr. Capesius im Hinblick auf ihre frühere Bekanntschaft anzusprechen und zu bitten, sie mit ihren Familienangehörigen zusammenzulassen. Der Verteidiger des Angeklagten Dr. Capesius will aus der Frage der Zeugin an den SS-Mann mit dem Gewehr, der plötzlich vor ihr stand und sie an einer Rückkehr zu Dr. Capesius hinderte, auf eine Unsicherheit der Zeugin in Bezug auf die Person des SS-Führers schliessen. Die Frage der Zeugin an den SS-Mann: "Sagen Sie bitte, ist das nicht der Dr. Capesius?" ist in der gegebenen Situation jedoch eine verständliche Frage. Sie deutet keineswegs auf eine Unsicherheit der Zeugin hin, sondern resultiert nur aus dem verständlichen Erstaunen der Zeugin, dass sie in einer für sie schrecklichen Situation einen Menschen getroffen hat, mit dem sie nicht gerechnet hat und dass sie nur, bevor sie zu dem ihr bekannten SS-Führer zurückkehren wollte, eine Bestätigung ihrer Überzeugung von der Identität des SS-Führers gesucht hat, weil der Angeklagte sie wie eine Fremde behandelt hatte. Der SS-Mann hat dann auch nach der glaubhaften Aussage der Zeugin bestätigt, dass der SS-Führer, der selektiert hat, der Apotheker Dr. Capesius sei. Der Wachtposten war noch verwundert, dass die Zeugin ihn kannte. Die Zeugin brachte das dadurch zum Ausdruck, dass sie sagte "der Soldat habe grosse Augen gemacht". Die Verteidigung des Angeklagten Dr. Capesius will aus dieser Erklärung herleiten, dass die Zeugin unglaubwürdig sei, weil nicht ersichtlich sei, wie sie habe feststellen können, dass der Posten "grosse Augen" gemacht habe. Insoweit handelt es sich jedoch nur um eine jedermann geläufige Redewendung der Zeugin, mit der sie das Erstaunen des SS-Mannes kennzeichnen wollte. Dass jemand das Erstaunen eines anderen an dessen Gesicht oder dessen sonstigem Verhalten feststellen kann, ist selbstverständlich und bedarf keiner näheren Erläuterung. Auch erscheint es naheliegend, dass der SS-Mann erstaunt darüber war, dass eine jüdische Frau, die gerade mit dem RSHA-Transport angekommen war, den Apotheker und Hauptsturmführer Dr. Capesius gekannt hat.
Der Angeklagte Dr. Capesius hat nach der Vernehmung der Zeugin behauptet, er sei nie nachts auf der Rampe gewesen. Auch wenn alle seine Landsleute dies behaupteten, dann stimme es nicht. Denn sie hätten in Rumänien eine Art Komplott gegen ihn geschmiedet. Im übrigen sei er in der Nacht vom 3. zum 4.6.1944 überhaupt nicht in Auschwitz gewesen. Er habe dieses Wochenende bei den Eheleuten Stoff. auf deren Hofgut in der Nähe von Auschwitz verbracht. Die Zeugen Stoff., auf deren Zeugnis sich der Angeklagte Dr. Capesius zum Beweise für sein angebliches Alibi berufen hat, haben diese Einlassung jedoch nicht bestätigt. Beide haben übereinstimmend bekundet, dass der Angeklagte Dr. Capesius zu dem Wochenende, das dem Geburtstag des Ehemannes Stoff. unmittelbar gefolgt sei, eingeladen gewesen sei. der Geburtstag des Zeugen Stoff. ist am 7.6. Im Jahre 1944 war dieser Tag ein Mittwoch. Der Samstag fiel auf den 10.6. Nach der Bekundung der Zeugen Stoff. war der Angeklagte Dr. Capesius somit am 10.6.1944 auf ihrem Hofgut zur Geburtstagsfeier, die nachgefeiert wurde. Ob der Angeklagte Dr. Capesius schon vor der Geburtstagsfeier bei den Zeugen Stoff. auf dem Hofgut gewesen ist, wusste die Zeugin Stoff. nicht mehr. Auch der Ehemann Stoff. konnte sich daran nicht mehr mit Bestimmtheit erinnern. Nach der Darstellung der beiden Zeugen haben sie den Angeklagten erst im April 1944 in der Stadt-Apotheke in Auschwitz bei den Eheleuten Rump kennengelernt. Dann hätten sie ihn - so haben sie weiter bekundet - im Mai bei den Eheleuten Rump erneut getroffen. Etwa eine Woche vor dem Geburtstag des Ehemannes Stoff. hätten sie mit den Eheleuten Rump und dem Angeklagten Dr. Capesius die Einladung zum Wochenende am 10.6.1944 besprochen.
Danach erscheint es unwahrscheinlich, dass der Angeklagte das Wochenende vom 3. zum 4.6.1944 auf dem Hofgut der Eheleute Stoff. verbracht hat. Vor allem ergibt sich aus der Vernehmung der beiden Zeugen Stoff. nicht der geringste Anhaltspunkt dafür, dass er in der Nacht vom 3. zum 4.6.1944 von Auschwitz abwesend gewesen ist.
Die Aussage der Zeugin Ne. wird somit durch die Aussagen der Zeugen Stoff. nicht widerlegt. Dass Gericht hat der Zeugin Ne., die ihre Aussage schlicht, klar und bestimmt gemacht hat, vollen Glauben geschenkt. Irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass die Zeugin sich mit anderen verabredet hätte, den Angeklagten Dr. Capesius zu Unrecht zu belasten, bestehen nicht. Es wäre hierfür auch kein Grund ersichtlich. Denn die Zeugin hat durch den Angeklagten Dr. Capesius vor ihrer Deportation keine Nachteile erlitten. Irgendwelche Hass- oder Rachegefühle scheiden aus. Wenn er in der betreffenden Nacht nicht auf der Rampe gewesen wäre, hätte sie ihn in Auschwitz kaum sehen können, weil sie nur drei Tage in Auschwitz geblieben ist. Es wäre daher nicht verständlich, warum sie ihn zu Unrecht belasten sollte.
Die Zeugin hat mit aller Bestimmtheit erklärt, dass der Angeklagte Dr. Capesius den an ihm vorbeigehenden jüdischen Menschen gezeigt hat, wohin sie zu gehen hätten, nach rechts oder nach links. Daraus folgt, dass er in dieser Nacht selbst selektiert, d.h. darüber bestimmt hat, wer von den jüdischen Menschen in das Lager aufzunehmen und wer zur Gaskammer zur Tötung zu bringen sei.
Zu. II.3.
Die Feststellungen unter II.3. beruhen auf der glaubhaften Aussage des Zeugen Pajo. Dieser Zeuge hatte in Oradea eine Apotheke an einer Strassenecke. Nach der glaubhaften Bekundung des Zeugen hat ihn der Angeklagte Dr. Capesius mehrfach als Propagandist der Firma Bayer besucht. Der Angeklagte Dr. Capesius hat zugegeben, dass ihm die Apotheke des Zeugen bekannt gewesen sei. Er hat auch eingeräumt, dass er ihn wohl besucht und mit ihm auch gesprochen haben müsse. Damit hat er bestätigt, dass der Zeuge ihn schon vor seiner Deportation nach Auschwitz gekannt hat.
Die Bekundung des Zeugen, dass er den Angeklagten Dr. Capesius auf der Rampe sofort wiedererkannt hat, ist glaubhaft. Eine Verwechslungsmöglichkeit scheidet aus. Denn nach der glaubhaften Bekundung des Zeugen hat ihn der Angeklagte Dr. Capesius auf ungarisch gefragt, ob er ein Apotheker sei und ob er aus Nemvorosch (rumänisch Oradea) sei. Auf seine bejahende Antwort hat der Angeklagte Dr. Capesius noch auf ungarisch etwas vor sich hingemurmelt, was der Zeuge als "am Eck" verstanden hat. Da sich die Apotheke des Zeugen an einer Strassenecke befand, ist dieser Bemerkung des Angeklagten Dr. Capesius zu entnehmen, dass er den Zeugen ebenfalls wiedererkannt und sich daran erinnert hat, dass der Zeuge eine Apotheke an einer Strassenecke in Oradea gehabt hat. Auch erscheint es ausgeschlossen, dass der Zeuge den Angeklagten Dr. Capesius mit dem Arzt Dr. Klein verwechselt haben könnte. Denn der Zeuge kannte weder den Dr. Klein, noch hat der Dr. Klein den Zeugen Pajo. vor dessen Deportation nach Auschwitz gekannt. Die Fragen an den Zeugen wären nicht zu erklären, wenn sie von Dr. Klein gestellt worden wären.
Der Angeklagte Dr. Capesius hat auch eingeräumt, dass die Angaben des Zeugen "plausibel" klängen.
Schliesslich hat der Zeuge bereits im Jahre 1946 - wie er weiter glaubhaft bekundet hat - einem Journalisten von diesem Zusammentreffen mit dem Angeklagten Dr. Capesius auf der Rampe in Birkenau erzählt, um darzutun, was es doch im Leben für Zufälle gäbe. Der Journalist hat diese Begebenheit in einen Buch niedergelegt.
Der Zeuge Pajo. hat ebenfalls mit aller Bestimmtheit erklärt, dass der Angeklagte Dr. Capesius den an ihm vorbei marschierenden Menschen gezeigt habe, ob sie nach rechts oder nach links zu gehen hätten. Der Zeuge selbst ist von dem Angeklagten Dr. Capesius nach rechts zu der Gruppe, die in das Lager aufgenommen werden sollte, geschickt worden. Es bestehen somit keine Zweifel, dass der Angeklagte Dr. Capesius in dieser Nacht den Selektionsdienst gemacht und darüber entschieden hat, wer in das Lager aufzunehmen und wer durch Gas zu töten sei.
Zu. II.4.
Die Feststellungen unter II.4. beruhen auf den glaubhaften Aussagen des Zeugen Dr. Schli. und der Zeugin Dr. Krau. Auch der Zeuge Dr. Schli. kannte den Angeklagten Dr. Capesius bereits vor seiner Deportation. Er hat nach seiner glaubhaften Bekundung den Angeklagten Capesius in Clausenburg sowohl auf der Strasse als auch im Büro und Magazin der Firma Bayer, wohin der Zeuge mehrfach wegen irgendwelcher Medikamente hingegangen ist, gesehen. Ausserdem hat ihn der Angeklagte Dr. Capesius als Propagandist der Firma Bayer mehrfach in seiner Arztpraxis aufgesucht.
Der Zeuge hat in der Hauptverhandlung eine Visitenkarte des Angeklagten Dr. Capesius vorgelegt, auf der einige Grussworte zum Jahreswechsel stehen. Der Zeuge hat erklärt, dass der Angeklagte diese Grussworte in seiner Praxis in seiner - des Zeugen - Gegenwart auf die Visitenkarte geschrieben habe. Der Angeklagte hat zunächst, als er die Visitenkarte in Augenschein genommen hat, zugegeben, dass es sich um seine Handschrift handele. Später hat er dies widerrufen und verlangt, dass ein Sachverständiger die Schriftzüge prüfe. Der vom Gericht vernommene Sachverständige hat es als unwahrscheinlich bezeichnet, dass die Schriftzüge auf der Visitenkarte von dem Angeklagten Dr. Capesius stammten. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass eine andere Person die Grussworte auf die Visitenkarte geschrieben hat und sich der Zeuge insoweit irrt, als er meint, der Angeklagte habe in seiner Gegenwart die Visitenkarte beschrieben. Durch diesen Irrtum ist seine Aussage jedoch nicht wertlos. Es erscheint durchaus verständlich, dass die Erinnerung des Zeugen in einem so unwichtigen Punkt nicht mehr ganz zuverlässig ist. Es ist von geringer Bedeutung und war für den Zeugen bisher auch nebensächlich, ob der Angeklagte Dr. Capesius in seiner Gegenwart die Visitenkarte beschrieben oder ob er ihm die bereits von einem anderen beschriebene Visitenkarte nur überreicht hat. Die Tatsache, dass der Zeuge im Besitz der Visitenkarte des Angeklagten Dr. Capesius ist, spricht dafür, dass der Angeklagte Dr. Capesius den Zeugen besucht und ihm auch die Visitenkarte überreicht haben muss. Der Angeklagte hat auch nicht in Abrede gestellt, dass er den Zeugen in seiner Praxis besucht hat. Daraus folgt, dass der Zeuge den Angeklagten bereits vor seiner Deportation gekannt hat. Wenn sich der Zeuge in einem nebensächlichen Punkt geirrt hat, so besagt das nicht, dass seine Aussage auch in den entscheidenden Punkten falsch sie.
Der Zeuge hat glaubhaft geschildert, dass er grosse Freude empfunden habe, als er den Angeklagten Dr. Capesius als einen Bekannten aus Siebenbürgen gesehen habe. Er ist - wie er weiter bekundet hat - dann zu ihm hingelaufen und hat ihn gefragt, wo sie seien und was mit ihnen werde. Der Angeklagte hat darauf geantwortet, dass sie in Mitteldeutschland seien und dass alles gut werde. Auf den Hinweis, dass seine Frau nicht ganz gesund sei, habe dann der Angeklagte Dr. Capesius - so hat der Zeuge weiter ausgesagt - seine Frau durch ihn zu der Gruppe der Kranken bringen lassen, indem er auf den Platz, an dem diese Gruppe gestanden habe gezeigt habe und ihm gesagt habe, sie solle sich dort hinstellen. Der Zeuge hat später seine Frau und seine 17jährige Nichte nicht mehr wiedergesehen. Er hat mit aller Bestimmtheit erklärt, dass er den Dr. Capesius wiedererkannt habe.
Seine Aussage ist glaubhaft. Hier scheidet ein Irrtum des Zeugen aus. Denn bei dem Geschehen auf der Rampe handelte es sich um für den Zeugen tief empfundene und erschütternde Erlebnisse, die man erfahrungsgemäss nicht wieder vergisst. Nach einem tagelangen qualvollen Transport in Viehwaggons sah er plötzlich in einer für ihm unbekannten und fürchterlichen Situation, von feindlichen SS-Männern umgeben und in Ungewissheit über sein eigenes und das Schicksal seiner Familie einen früheren Bekannten. Es ist selbstverständlich, dass er hierbei grosse Freude empfunden haben muss und dass er dieses Empfinden sein ganzes Leben nicht vergessen wird. Dann hat er sich mit diesem Bekannten noch unterhalten. Spätestens in diesem Augenblick hätte es der Zeuge bemerken müssen, wenn er sich in der Person des Angeklagten Dr. Capesius geirrt hätte. Der Zeuge war sich aber ganz sicher, dass er mit dem Angeklagten Dr. Capesius gesprochen hat. Das Schwurgericht hält es für ausgeschlossen, dass sich die Erinnerung des Zeugen an dieses für ihn entscheidende Erlebnis auf der Rampe getrübt hat oder dass er sich nach zwanzig Jahren guten Glaubens bezüglich des Geschehens auf der Rampe irren könnte. Dafür, dass der Zeuge wider besseres Wissen den Angeklagten Dr. Capesius hätte belasten wollen, liegen keine Anhaltspunkte vor. Der Zeuge ist nur sechs Tage in Auschwitz geblieben. Von dem Angeklagten Dr. Capesius hat er weder vor seiner Deportation noch im Lager irgendwelche Nachteile gehabt. Es wäre daher nicht verständlich, warum der Zeuge den Angeklagten wider besseres Wissen belasten sollte, wenn der Angeklagte Dr. Capesius gar nicht auf der Rampe gewesen wäre.
Im übrigen wird die Aussage des Zeugen Dr. Schli. von der Zeugin Dr. Krau. bestätigt. Die Zeugin ist in der gleichen Nacht wie der Zeuge Dr. Schli. auf der Rampe in Birkenau angekommen. Sie hat zwar den Angeklagten Dr. Capesius vor ihrer Deportation nicht gekannt. Sie wurde aber - wie sie glaubhaft bekundet hat - von ihrer Mutter auf den Angeklagten Dr. Capesius, den diese damals bereits kannte, aufmerksam gemacht. Ihre Mutter habe - so hat die Zeugin glaubhaft ausgesagt - spontan erklärt: "das ist ja der Dr. Capesius aus Clausenburg." Die Zeugin hat weiter - ebenso wie der Zeuge Dr. Schli. - mit voller Bestimmtheit erklärt, dass der SS-Führer, den ihre Mutter als den Dr. Capesius bezeichnet habe, mit der Hand den jüdischen Menschen gewinkt habe, wohin sie zu gehen hätten. Ihre Aussage stimmt insoweit völlig mit der Aussage des Zeugen Dr. Schli. überein. Es besteht daher kein Zweifel, dass der Angeklagte Dr. Capesius auch diesen RSHA-Transport selektiert hat.
Von dem Vater einer Freundin hat die Zeugin Dr. Krau. dann erfahren, dass Dr. Capesius ihren Vater, der ihn erkannt und ihm gesagt habe, seine Frau und seine Mutter seien auf der anderen Seite, auf die andere Seite zu seiner Frau und seiner Mutter geschickt habe mit den Worten: "Dann schicke ich Sie auch dorthin, das ist ein guter Ort."
Wenn die Zeugin dies auch nicht selbst miterlebt hat und nicht als Augen- bzw. Ohrenzeugin darüber hat berichten können, so hat das Gericht keinen Zweifel, dass sich alles so abgespielt hat, wie es der Zeugin Dr. Krau. von dem Vater ihrer Freundin berichtet worden ist. Denn es ist nicht ersichtlich, warum ihr der Vater ihrer Freundin unmittelbar nach dem Geschehen auf der Rampe etwas Falsches über das Schicksal ihres Vaters hätte berichten sollen. Gestützt wird der Bericht des Bekannten der Zeugin durch die Tatsache, dass der Vater der Zeugin Arzt war und somit an sich in das Lager hätte aufgenommen werden müssen. Denn Ärzte wurden grundsätzlich schon vor der eigentlichen Selektion herausgerufen und wurden anschliessend in das Lager aufgenommen. Nach der Selektion hat die Zeugin ihren Vater jedoch nicht mehr gesehen. Auch später hat sie nichts mehr von ihm erfahren. Daraus ist zu schliessen, dass er in die Gaskammer verbracht und dort getötet worden ist. Da der Vater der Zeugin nicht krank war, muss ein besonderer Grund hierfür vorgelegen haben, dass der Angeklagte Dr. Capesius ihn in die Gaskammer geschickt hat. Der Bericht des Gewährsmannes der Zeugin, dass ihr Vater den Angeklagten Dr. Capesius darauf hingewiesen habe, seine Frau und seine Mutter seien auf der anderen Seite und dass Dr. Capesius ihn daraufhin mit der zitierten Bemerkung zu ihr geschickt habe, erscheint daher überzeugend und zutreffend.
Die Feststellung, dass der Angeklagte Dr. Capesius Rampendienst verrichtet und auch RSHA-Transporte selektiert hat, wird ferner zumindest mittelbar durch die Zeugen Sze., Gol. und Lil. gestützt.
Der Zeuge Sze., der ab September 1943 als Apotheker in der SS-Apotheke beschäftigt worden ist und somit den Angeklagten Dr. Capesius gekannt hat, hat glaubhaft bekundet, dass der Angeklagte Dr. Capesius im Sommer 1944 wiederholt in seiner Gegenwart geäussert habe, dass er am Vormittag nicht in der Apotheke sei, weil er "Dienst auf der Rampe" habe. Das spricht dafür, dass der Angeklagte, wenn er zum Rampendienst eingeteilt worden ist, zur Rampe gefahren und dort auch den Dienst verrichtet hat. Wenn stets Dr. Klein für ihn selektiert hätte und wenn er nur zur Sicherung des Gepäcks auf die Rampe gefahren wäre, hätte er nicht vom "Dienst auf der Rampe" zu sprechen brauchen.
Der bereits erwähnte Zeuge Gol. konnte sich genau erinnern, dass der Angeklagte Dr. Capesius oft auf der Liste der diensthabenden Ärzte zum Rampendienst eingeteilt gewesen sei. Der Zeuge ist zwar selbst nicht auf der Rampe gewesen und konnte daher den Angeklagten Dr. Capesius nicht selektieren sehen. Er hat aber wiederholt gesehen, - wie er glaubhaft geschildert hat - dass der Angeklagte den Sanitätswagen bestiegen hat und mit den SS-Männern, die das Gas in die Gaskammern einzuwerfen hatten, weggefahren ist. Auch das ist ein sicheres Beweisanzeichen dafür, dass der Angeklagte Dr. Capesius zum Rampendienst gefahren ist und auch Dienst an der Gaskammer verrichtet hat.
Die Behauptung des Angeklagten Dr. Capesius, die Zeugen, die ihn belastet hätten, hätten ihn sicher mit Dr. Klein verwechselt, entbehrt jeder Grundlage. Der Zeuge Lil., der beide gekannt hat, hält es für unmöglich, dass man beide hätte miteinander verwechseln können. Das gleiche haben die Zeugen O., Sze. und Rad. geäussert. Auch die Zeugin Dr. Böh. hat die Auffassung vertreten, dass man Dr. Klein und Dr. Capesius "absolut nicht hätte verwechseln können". Ferner hat der Zeuge Dr. Loeb. eine Verwechslung zwischen beiden für kaum möglich gehalten. Beide hätten ein verschiedenes Auftreten und auch verschiedene Figuren gehabt. Nur die Zeugin Dr. Li. hat gemeint, beide hätten in der Grösse und Figur eine gewisse Ähnlichkeit gehabt. Aber in den Gesichtszügen hätten sie sich unterschieden. Im Gesicht hätte überhaupt keine Ähnlichkeit zwischen beiden bestanden. Auch ihre Sprache sei nicht ähnlich gewesen. Dr. Klein habe ein akzentfreies Hochdeutsch gesprochen, während Dr. Capesius deutsch wie ein Rumäne gesprochen habe. Demgegenüber hat Dr. M. gemeint, dass beide den gleichen Jargon gesprochen hätten. Dr. Klein hätte einen Akzent wie ein Siebenbürger Schwabe gehabt.
Wenn auch zwischen den Aussagen der Zeugen Dr. Li. und Dr. M. gewisse Unterschiede bzgl. der Ähnlichkeit der Aussprache der beiden Vergleichspersonen bestehen, die auf der subjektiven Auffassung und dem Empfinden der beiden Zeugen beruhen mögen, so ergibt sich doch aus den Aussagen sämtlicher genannter Zeugen, dass zwischen Dr. Capesius und Dr. Klein keine Ähnlichkeit bestanden hat, die zu einer Verwechslung hätte führen können.
Die Feststellung, dass der Angeklagte Dr. Capesius auch mindestens zweimal Dienst an der Gaskammer gemacht hat, beruht auf der Aussage des Zeugen Pa. Der Zeuge hat den Namen des Angeklagten Dr. Capesius allerdings in Auschwitz nicht gekannt.
Er hat den Angeklagten jedoch bei der Gegenüberstellung in der Hauptverhandlung wiedererkannt und hat erklärt, dass dieser Angeklagte Arzt sei. Er hat ihn bei der Gaskammer aus dem Sanka aussteigen sehen. Hätte der Zeuge den Angeklagten bewusst zu Unrecht belasten wollen, wäre es ihm ein leichtes gewesen, den Namen des Angeklagten Dr. Capesius und auch zu erfahren, dass er nicht Arzt, sondern Apotheker gewesen ist. Gerade daraus, dass er den Angeklagten Dr. Capesius nicht als Apotheker, sondern als Arzt bezeichnet hat, hat das Gericht die Überzeugung gewonnen, dass der Zeuge die Wahrheit gesagt und entsprechend seiner Erinnerung ausgesagt hat. Der Zeuge hat einen Vorfall geschildert, der sehr aufschlussreich ist und den der Zeuge kaum erfunden haben kann. Der Zeuge hat gesehen, wie der Angeklagte Dr. Capesius, den er damals dem Namen nach nicht kannte, mit dem Wagen, der ein Rotes Kreuz trug (Sanka) angefahren kam und aus dem Wagen ausgestiegen ist. Wie der Zeuge weiter bemerkt hat, hat der Angeklagte dann festgestellt, dass eine Büchse Zyklon B gefehlt hat. Er hat nämlich - wie der Zeuge gehört hat - gefragt, wo die zweite Büchse Zyklon B sei. Er hat dann den Fahrer des Wagens zum Holen dieser Büchse zurückgeschickt. Auf Grund dieses Vorfalles hat sich dem Zeugen das Erscheinungsbild des Angeklagten Dr. Capesius eingeprägt. Das Gericht hat daher keinen Zweifel, dass der Zeuge den Angeklagten zutreffend wiedererkannt hat.
Die Aussage des Zeugen wird gestützt durch die Aussage des Zeugen Gol. Wie schon ausgeführt, hat der Zeuge Gol. den Angeklagte Dr. Capesius wiederholt den Sanka besteigen und mit den SS-Angehörigen, die das Gas in die Gaskammer einzuwerfen hatten, wegfahren sehen. Zieht man weiter in Betracht, dass die Ärzte, Zahnärzte und Apotheker nicht nur Rampendienst, sondern auch Gaskammerdienst zu verrichten hatten, so besteht kein Zweifel, dass der Angeklagte Dr. Capesius, wenn er zum Rampendienst eingeteilt war, zumindest ab und zu auch Dienst an der Gaskammer zu verrichten hatte, wie es bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Dr. L. näher beschrieben worden ist.
Die Feststellung, dass Dr. Capesius nicht nur einmal, sondern mindestens zweimal Dienst an der Gaskammer verrichtet hat, beruht auf der Aussage des Zeugen Pa. Dieser Zeuge hat sich dahin ausgedrückt, dass er den Angeklagten Dr. Capesius mit dem Sanka zur Gaskammer habe kommen sehen und dass er ihn einmal gesehen habe, als die Büchse Zyklon B auf Veranlassung des Angeklagten hätte nachgeholt werden müssen. Daraus folgt, dass der Zeuge den Angeklagten mehrmals gesehen hat, nämlich einmal während des geschilderten besonderen Vorfalles und sonst ohne besondere Vorkommnisse oder Beobachtungen. Mindestens muss er daher den Angeklagten Dr. Capesius zweimal bei der Gaskammer gesehen haben.
Zusammenfassend konnte daher festgestellt werden, dass der Angeklagte Dr. Capesius in einer unbestimmten Anzahl von Fällen Selektionen auf der Rampe in Birkenau durchgeführt hat. Auf jeden Fall hat er mindestens in drei Fällen selbst RSHA-Transporte selektiert (am 3.6., 4.6., 11. oder 12.6.1944) und hat in mindestens einem weiteren Fall den Selektionsdienst des Dr. Mengele dadurch unterstützt, dass er dessen Anweisungen ins Ungarische übersetzt hat (29.5.1944). Der Dienst an der Gaskammer ist möglicherweise nach von ihm selbst durchgeführten Selektionen erfolgt. Zu Gunsten des Angeklagten muss daher davon ausgegangen werden, dass die beiden Fälle des Gaskammerdienstes mit zwei Fällen des Selektionsdienstes identisch sind bzw. sich auf die gleichen RSHA-Transporte beziehen.
Die Feststellung, dass von jedem der vier Transporte mindestens je zweitausend Menschen durch Zyklon B getötet worden sind, beruht auf folgendem: Nach der Aussage der Zeugin Dr. Böh. waren in jedem der Eisenbahnwaggons des Transportzuges, der am 29.5.1944 in Auschwitz-Birkenau angekommen ist, über achtzig Personen. Der Zeuge Dr. Bern. hat die Anzahl der Personen in einem Waggon auf über siebzig Personen geschätzt. Jeder Zug hatte nach Aussage des bereits erwähnten Zeugen Hi., wenn er voll ausgelastet war, sechzig Waggons. Mit den Zügen aus Siebenbürgen wurden nach den übereinstimmenden Aussagen vieler Zeugen und der Angeklagten grosse Judentransporte nach Auschwitz gebracht. Es kann daher mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass der Zug mindestens vierzig Waggons gehabt hat. Mit ihm sind daher, wenn man die Mindestzahl von siebzig Menschen pro Waggon zugrunde legt, mindestens zweitausendachthundert Menschen nach Auschwitz transportiert worden. Da nie mehr als 25% in das Lager aufgenommen worden sind, kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass von diesem Transport mindestens zweitausend Menschen in der Gaskammer durch Zyklon B getötet worden sind.
Für den Transport, der am 3.6.1944 in Auschwitz-Birkenau ankam, gilt das gleiche. Der Transport, der am 4.6.1944 in Auschwitz-Birkenau einlief, hatte nach der Schätzung des Zeugen Pajo. 40 bis 50 Waggons. In jedem Waggon waren nach der Bekundung des gleichen Zeugen siebzig bis achtzig Personen. Auch in diesem Fall kann daher mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass mindestens zweitausendachthundert Personen nach Auschwitz deportiert worden sind. Zieht man hiervon die Menschen, die in das Lager aufgenommen worden sind ab - höchstens 25% -, so ergibt sich mit Sicherheit ebenfalls eine Mindestzahl von zweitausend Menschen, die durch Zyklon B getötet worden sind.
In dem Transport, der am 11. oder 12.6.1944 in Auschwitz-Birkenau ankam, waren nach der Bekundung der Zeugin Dr. Krau. dreitausendfünfhundert Personen. Auch hier kann daher von einer Mindestzahl von zweitausend Personen, die durch Gas getötet worden sind, ausgegangen werden, da auch in diesem Fall nicht mehr als 25% in das Lager aufgenommen worden sind.
Den Angeklagten Dr. Capesius haben noch weiter die Zeugen Glü., von Sebe., Ehe. und die Zeugin Sza. belastet. Alle wollen den Angeklagten Dr. Capesius nach ihrer Ankunft auf der Rampe von Birkenau gesehen haben. Wenn auch sehr viel dafür spricht, dass der Angeklagte Dr. Capesius auch die Transporte, mit denen die Zeugen angekommen sind, selektiert hat, so hat das Gericht auf Grund der Aussagen dieser Zeugen keine Feststellungen getroffen, weil die Zeugen nicht zuverlässig genug schienen.
Der Zeuge Glü., der am 11.6.1944 in Auschwitz angekommen sein will, kannte den Angeklagten Dr. Capesius vor seiner Deportation nur sehr flüchtig. In der Hauptverhandlung hat er sich in Widersprüche zu seiner Aussage im Ermittlungsverfahren verwickelt. So hat er in der Hauptverhandlung bekundet, der Angeklagte Dr. Capesius sei auch mit in den Waschraum hineingekommen. Er - der Zeuge - habe sich im Waschraum nicht schnell genug ausziehen können, dafür sei er geschlagen worden. Dass der Angeklagte jemanden geschlagen hätte, das habe er jedoch nicht gesehen. Im Ermittlungsverfahren hat der Zeuge dagegen angegeben - was ihm in der Hauptverhandlung vorgehalten worden ist - dass der Angeklagte Dr. Capesius mit einer Peitsche auf die Häftlinge eingeschlagen habe. Das wisse er mit "absoluter Sicherheit". Nach dem Vorhalt in der Hauptverhandlung erklärte der Zeuge: Der Angeklagte sei nicht der Schläger gewesen. Er habe die Häftlinge nur so "angetippt". Im Ermittlungsverfahren hat der Zeuge ferner ausgesagt, er wisse mit "absoluter Sicherheit", dass der Angeklagte Dr. Capesius bei der Räumung des Zigeunerlagers dabeigewesen sei, während er in der Hauptverhandlung erklärt hat, er habe nicht gesehen, wer bei der Verladung der Zigeuner dabei gewesen sei. Es sei Blocksperre gewesen und sie hätten nur durch die Löcher der Baracken sehen können. Bei diesen Widersprüchen kann die Aussage des Zeugen Glü. nicht als zuverlässig angesehen werden, zumal es auch unwahrscheinlich erscheint, dass der Angeklagte Dr. Capesius als Apotheker und Hauptsturmführer die Häftlinge im Waschraum beaufsichtigt haben soll. Das war Aufgabe der unteren SS-Dienstgrade. Das Schwurgericht hat daher die Aussage des Zeugen insgesamt nicht verwertet.
Der Zeuge von Sebe., der am 5. oder 6.8.1944 in Birkenau angekommen sein will, hat in der Hauptverhandlung erklärt, er habe den Angeklagten Dr. Capesius schon vor seiner Deportation gekannt. Er sei in Clausenburg Eigentümer eines Mietshauses gewesen, in dem acht bis zehn Ärzte gewohnt hätten. Dr. Capesius, den er zunächst nicht gekannt und mit dem er auch nie persönlich gesprochen habe, sei in dieses Mietshaus zum Besuch der Ärzte gekommen. Er - der Zeuge - habe sich für die Menschen interessiert, die in seinem Hause ein- und ausgegangen seien. Daher habe er den Portier gefragt, wer der Herr sei, der immer die Ärzte besuche. Der Portier habe ihm geantwortet: "Das ist der Apotheker Dr. Capesius." Auf der Rampe in Birkenau habe ihm ein Bekannter namens Farkas zugerufen: "Schau, der Apotheker Capesius!" Daraufhin habe er - der Zeuge - ihn auch erkannt. Der Zeuge will somit nach seiner Aussage in der Hauptverhandlung den Angeklagten Dr. Capesius bereits auf der Rampe erkannt haben.
In einem Brief vom 3.9.1960 an den Zeugen La., den damaligen Generalsekretär des internationalen Auschwitzkomitees, hat der Zeuge jedoch angegeben, dass er auf der Rampe in Birkenau von einem Offizier angesprochen worden sei, von dem er nachträglich erfahren habe, dass es der Dr. Capesius sei. Nach dieser früheren Erklärung kann der Zeuge daher entgegen seiner Bekundung in der Hauptverhandlung bei seiner Ankunft in Auschwitz den Angeklagten Dr. Capesius überhaupt noch nicht gekannt haben. Da im übrigen auch die Erklärung des Zeugen, auf welche Weise er in Clausenburg den Angeklagten Dr. Capesius kennengelernt haben will, nicht recht überzeugend ist und er sich bezüglich einer Aktion gegen Kinder im Zigeunerlager, an der auch der Angeklagte Dr. Capesius beteiligt gewesen sein soll, in erhebliche Widersprüche zu seiner früheren Darstellung im Ermittlungsverfahren verwickelt hat, hat das Schwurgericht die Aussage des Zeugen insgesamt nicht verwertet.
Der Zeuge Eh. konnte ebenfalls nicht als ein zuverlässiger Zeuge angesehen werden. In der Hauptverhandlung hat er bekundet, er habe nach seiner Ankunft an der Rampe in Birkenau am 10., 11., oder 12.6.1944 einen SS-"Offizier" gesehen, der nach rechts und links gezeigt habe. Später habe er von einem Bekannten namens Gabor Deutsch erfahren, dass dies Dr. Capesius sei. Deutsch habe ihn auf Dr. Capesius aufmerksam gemacht und ihn gefragt, ob er den Mann nicht kenne. Er habe geantwortet: "Woher soll ich den Offizier kennen?" Deutsch habe ihm dann gesagt, dass dies der Dr. Capesius sei. Deutsch sei dann zu Dr. Capesius hingegangen und habe mit ihm gesprochen. Bei seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter hat der Zeuge ausgesagt, was ihm in der Hauptverhandlung vorgehalten worden ist, dass ihm der SS-Offizier sehr bekannt vorgekommen sei. Deutsch habe ihn darauf hingewiesen, dass es sich bei dem SS-Offizier um den früheren Propagandisten der IG-Farben handele. Daraufhin habe er ihn auch erkannt. Der Zeuge hat ferner bei dem Untersuchungsrichter angegeben, dass er (vor der Deportation) mit Dr. Capesius weniger in Kontakt gekommen sei, dass er aber mit Sicherheit sagen könne, dass er ihn in Auschwitz als den früheren Propagandisten wiedererkannt habe. Er habe es zunächst gar nicht glauben können, dass er Dr. Capesius in Auschwitz in einer SS-Uniform begegne. Schliesslich hat der Zeuge bei dieser Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter noch behauptet, dass zwei Herren aus der Firma Royal namens Hartmann und Abraham im Alter von 42 oder 43 Jahren, die gesund und von kräftiger körperlicher Konstitution gewesen seien, von Dr. Capesius ins Gas geschickt worden seien und zwar nach seiner Meinung aus Rache, weil diese Herren sich wegen seiner - des Angeklagten Dr. Capesius - antisemitischen Propaganda im Jahre 1943 bei der Firma des Angeklagten beschwert hätten und der Angeklagte deswegen eine Rüge seiner Firma erhalten habe. In der Hauptverhandlung hat der Zeuge diese Behauptung nicht aufrecht erhalten können. Er hat auf Vorhalt eingeräumt, dass er die Herren Hartmann und Abraham nur beim Einsteigen in den Transportzug gesehen habe. Er musste zugeben, dass er sie auf der Rampe in Birkenau überhaupt nicht mehr gesehen hat. Wenn er früher gemeint habe, Dr. Capesius habe die beiden aus Rache ins Gas geschickt, so sei das nur eine Schlussfolgerung, eine Hypothese, von ihm gewesen. Aus den unterschiedlichen
Aussagen des Zeugen vor dem Untersuchungsrichter und in der Hauptverhandlung ergibt sich, dass der Zeuge zu Übertreibungen neigt und aus Überlegungen und Schlussfolgerungen Tatsachen ableitet, die er als wirklich geschehen hinstellt. Das Gericht konnte daher nicht die Überzeugung gewinnen, dass das, was er in der Hauptverhandlung bekundet hat, den Tatsachen entspricht, insbesondere, ob er tatsächlich den Angeklagten Dr. Capesius auf der Rampe in Birkenau einwandfrei gesehen bzw. wiedererkannt hat. Seine Aussage hat das Gericht daher insgesamt nicht verwertet.
Auch die Aussage der Zeugin Sza. hat das Gericht nicht verwertet, weil nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte, ob die Zeugin den Angeklagten Dr. Capesius zutreffend identifiziert hat. Auch sonst bestehen Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Erinnerungsvermögens der Zeugin. Die Zeugin Sza. will im gleichen Transport wie die Zeuginnen Dr. Böh. und Sa. angekommen sein. Die Zeugin Sa. hat jedoch mit Bestimmtheit erklärt, dass die Zeugin Sza. nicht in ihrem Transport gewesen sei. Nach der Häftlingsnummer der Zeugin Sza. kann sie mit grosser Wahrscheinlichkeit erst am 26.7.1944 in Auschwitz angekommen sein. Die Zeugin kannte den Angeklagten Dr. Capesius vor ihrer Deportation nicht. Sie will auf der Rampe nach ihrer Ankunft einen Offizier gesehen haben, der so schön auf ungarisch gesprochen habe. Bei ihrer früheren Vernehmung hat sie von mehreren Offizieren gesprochen. In der Hauptverhandlung hat die Zeugin bekundet, dass dieser Offizier mit der Hand gezeigt habe, wohin sie treten soll. Nachträglich habe sie erfahren, dass dieser Offizier der Angeklagte Dr. Capesius sei.
Bei ihrer früheren Vernehmung hat sie erklärt, sie könne nicht sagen, ob sich der Angeklagte Dr. Capesius an der Ausmusterung beteiligt habe. Nach der Aussage der Zeugin in der Hauptverhandlung sollen die Zeuginnen Frau Böh. und Sa. vor ihr - der Zeugin Sza. - auf der Rampe gegangen sein. Die Zeugin Sa. hat jedoch mit Bestimmtheit erklärt, - wie schon ausgeführt -, dass die Zeugin Sza. überhaupt nicht in ihrem Transport gewesen sei. Schon diese Widersprüche und Unstimmigkeiten lassen Zweifel an der Zuverlässigkeit des Erinnerungsvermögens der Zeugin aufkommen. Möglicherweise haben sich Dinge, die sie gelesen oder in Gesprächen mit anderen früheren Häftlingen erfahren hat, in der Erinnerung der Zeugin mit tatsächlich Erlebtem vermischt, ohne dass sich die Zeugin dessen bewusst ist.
Die Zeugin hat weiter geschildert, dass der Angeklagte Dr. Capesius wegen eines Margarinediebstahls mit dem Personal der Küche "Sport" getrieben habe. Dabei soll er ausgerufen haben: "Ich bin der Dr. Capesius aus Siebenbürgen, ihr werdet der Teufel in mir kennen lernen."
Es erscheint jedoch unwahrscheinlich, dass der Angeklagte Dr. Capesius als Apotheker und Hauptsturmführer sich um Margarinediebstähle in der Küche des Frauenkonzentrationslagers in Birkenau gekümmert und deren Aufklärung betrieben hat. Ebenso unwahrscheinlich erscheint es, dass er wegen solcher Diebstähle Strafen verhängt habe und selbst "Sport" mit den Häftlingsfrauen getrieben hat. Die Aufklärung solcher Diebstähle war Sache des Lagers- und Rapportführers bzw. der Angehörigen der politischen Abteilung. Das "Sportmachen" überliessen die SS-Führer niederen SS-Dienstgraden, insbesondere den Blockführern bzw. den SS-Aufseherinnen. Auch Kapos und Blockälteste wurden mit "Sportmachen" beauftragt. Ebenso unwahrscheinlich erscheint es, dass der Angeklagte Dr. Capesius bei dieser Gelegenheit seinen Namen genannt haben soll. Im übrigen ist nicht ausgeschlossen, dass irgendein anderer SS-Führer oder SS-Unterführer Missbrauch mit dem Namen des Angeklagten Dr. Capesius getrieben hat. Das "Sportmachen" passt auch nicht zu dem allgemeinen Verhalten des Angeklagten Dr. Capesius in Auschwitz gegenüber Häftlingen, wie es von anderen Zeugen geschildert worden ist. So hat die Zeugin Ad. den Angeklagten als einen gemütlichen, liebenswürdigen und jovialen Menschen geschildert. Der Zeuge Lil. hat ihn ebenfalls als jovial und umgänglich charakterisiert. Er habe sich - so hat der Zeuge ausgesagt - mit den Häftlingen wie mit Kollegen unterhalten. Der Zeuge Sik. hat den Angeklagten Dr. Capesius als einen guten Chef bezeichnet, der sich um die Häftlinge gekümmert und für sie gesorgt habe. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Zeugin Sza. aus nicht näher zu erforschenden Gründen den Vorfall nach dem Margarinediebstahl unbewusst, aber zu Unrecht auf den Angeklagten Dr. Capesius projiziert hat.
Die Zeugin Ad. hat den Angeklagten ebenfalls nach ihrer Ankunft auf der Rampe in Birkenau gesehen. Sie wusste damals seinen Namen nicht, hat ihn aber von ihrer Freundin Lilli erfahren, die ihn gekannt hat. Die Zeugin hat gehört, wie der Angeklagte Dr. Capesius auf ungarisch erklärt hat, dass die müden Ankömmlinge auf die andere Seite treten sollten, dort sei ein Schonungslager.
Die Zeugin wusste den Tag ihrer Ankunft in Auschwitz nicht mehr. Sie konnte sich nur noch erinnern, dass sie im Juni 1944 auf der Rampe in Birkenau angekommen sei. Es ist daher nicht auszuschliessen, dass sie mit einem der oben bereits angeführten drei Transporte angekommen ist, so dass nicht festgestellt werden konnte, dass der Angeklagte auch noch bei der Selektion eines fünften Transportes dabeigewesen ist.
Die Feststellung, dass der Angeklagte Dr. Capesius über den Sinn des Selektionsdienstes unterrichtet war und gewusst hat, dass nur ein kleiner Teil der jüdischen Menschen in das Lager aufgenommen und die Mehrzahl in einer der Gaskammern durch Zyklon B getötet wurde, beruht auf seiner eigenen Einlassung. Er hat eingeräumt, dass ihn Dr. Klein bereits vor seiner Einteilung zum Rampendienst über den Selektionsdienst und die gesamten Vorgänge auf der Rampe und in der Gaskammer aufgeklärt habe. Es kann auch nicht zweifelhaft sein, dass der Angeklagte Dr. Capesius gewusst hat, dass die jüdischen Menschen nur wegen ihrer Abstammung getötet wurden. Denn das war allen SS-Angehörigen bekannt. Der Angeklagte bestreitet es auch nicht.
IV. Rechtliche Würdigung
Der Angeklagte Dr. Capesius hat in den geschilderten Fällen die Massentötung der jüdischen Menschen, somit die Mordtaten der Haupttäter, durch eigene Handlungen gefördert.
Im Falle II.1. hat er durch die Übersetzung der von Dr. Mengele gegebenen Bekanntmachung, dass die Kranken und müden Menschen wegen des weiten Weges mit LKWs fahren könnten, zur Täuschung der Opfer beigetragen. Er hat hierdurch zum Tode aller, die sich auf seine in ungarischer Sprache gegebene Ankündigung hin ahnungslos zu den LKWs begaben und diese bestiegen, einen kausalen Tatbeitrag geleistet. Besonders augenfällig ist dies im Fall des Apothekers Kövarie, der bereits bei der Gruppe der herausgerufenen Ärzte und Apotheker stand und ohne die Täuschung durch den Angeklagten Dr. Capesius in das Lager aufgenommen worden wäre.
Er hat ferner zum Tode der Ehefrau und der Kinder des Zeugen Dr. Bern. beigetragen, indem er sie wieder durch den Zeugen Dr. Bern. zu der Gruppe der für den Gastod bestimmten Menschen hinbringen liess, wobei er den Zeugen Dr. Bern. noch täuschte und ihn in seiner Ahnungslosigkeit bestärkte, indem er ihm vorspiegelte, seine Frau und seine Kinder würden nur gebadet, er sei in einer Stunde wieder mit seiner Familie zusammen. Im übrigen hat der Angeklagte Dr. Capesius als SS-Apotheker und SS-Hauptsturmführer die niederen SS-Dienstgrade durch seine Anwesenheit auf der Rampe und durch seine allen erkennbare Mithilfe bei der Selektion psychisch gestärkt und dazu beigetragen, dass sie ihre Hemmungen leichter überwinden und ihr Gewissen zum Schweigen bringen konnten. Insoweit kann auf die Ausführungen unter L.IV. verwiesen werden.
In den Fällen II.2. - 4. liegt es auf der Hand, dass der Angeklagte Dr. Capesius die Vernichtungsaktionen durch die von ihm selbst durchgeführten Selektionen gefördert hat. Unter L.IV. ist bereits ausgeführt worden, dass diese Selektionen mitursächlich für den Tod der als arbeitsunfähig beurteilten Menschen gewesen sind und nicht einseitig nur als Errettung der als arbeitsfähig beurteilten Menschen vor dem Tode angesehen werden können.
Auf diese Ausführungen kann Bezug genommen werden.
Im Falle II.4. hat der Angeklagte Dr. Capesius zudem die Opfer durch eigene Erklärungen getäuscht und sie in ihrer Arglosigkeit bestärkt, indem er dem Dr. Schli. vorspiegelte, es werde alles gut, und danach seine Ehefrau zur Gruppe der Kranken und für den Gastod bestimmten schickte, und indem er den gesunden und arbeitsfähigen Vater der Zeugin Dr. Krau. zu der Gruppe der dem Tode geweihten Opfer mit der Erklärung, er schicke ihn an einen guten Ort, brachte. In diesem Fall ist es besonders augenfällig, dass die Selektionen durch die Ärzte, Zahnärzte und Apotheker nicht nur die Bewahrung eines Teiles der an sich für den Tod bestimmten Menschen vor dem Tode gewesen sind. Denn als Arzt hätte der Vater der Zeugin Dr. Krau. an sich in das Lager aufgenommen werden müssen. Zumindest hätte der Angeklagte ihn ohne weiteres für die Aufnahme in das Lager auswählen können. Dass der Angeklagte Dr. Capesius im übrigen auch durch den Dienst an der Gaskammer die Vernichtung von mindestens zwei RSHA-Transporten gefördert hat, bedarf keiner weiteren Begründung. Insoweit kann auf die Ausführung unter L.IV. verwiesen werden.
Nach der gesamten Sachlage kann es nicht zweifelhaft sein, dass der Angeklagte Dr. Capesius sich darüber im klaren gewesen ist und das Bewusstsein gehabt hat, durch den geschilderten Rampendienst im Falle II.1., durch den Selektionsdienst in den Fällen II.2. - 4., durch die Täuschung der Opfer und durch den Gaskammerdienst in mindestens zwei Fällen die Vernichtungsaktionen zu fördern und kausale Tatbeiträge für den reibungslosen Ablauf der Aktionen zu leisten. Er beruft sich auch nicht darauf, dass ihm dieses Bewusstsein gefehlt hätte. Vielmehr leugnet er, sich überhaupt in der geschilderten Weise betätigt zu haben. Schon daraus ist ersichtlich, dass ihm sehr wohl bewusst gewesen ist, dass er durch die geschilderte Mitwirkung die Vernichtungsaktionen gefördert und zum Tode der Opfer beigetragen hat. Im übrigen liegt es für jedermann so klar auf der Hand, dass die festgestellten Handlungen des Angeklagten Dr. Capesius auf der Rampe und an der Gaskammer mitursächlich für den Tod der Opfer gewesen sind, dass es auch dem Angeklagten Dr. Capesius nicht verborgen geblieben sein kann und nach der Überzeugung des Gerichts auch nicht verborgen geblieben ist.
Der Angeklagte Dr. Capesius hat den Rampendienst, den Selektionsdienst und den Dienst an der Gaskammer auf Befehl seines Vorgesetzten Dr. Wirths verrichtet. Da er Angehöriger der Waffen-SS gewesen ist, findet §47 MStGB Anwendung. Auch der Angeklagte Dr. Capesius hat - wie alle anderen SS-Angehörigen - klar erkannt, dass die Tötung unschuldiger jüdischer Menschen ein allgemeines Verbrechen war und dass die Befehle, die seine Mithilfe bei den Vernichtungsaktionen anordneten, ein allgemeines Verbrechen bezweckten. Wenn sich der Angeklagte Dr. Capesius dahin eingelassen hat, er habe die Tötung der jüdischen Menschen für rechtmässig gehalten, weil sie von dem Inhaber der höchsten Staatsgewalt ausgegangen sei, so ist das nur eine Schutzbehauptung. Der Angeklagte will sich damals gegenüber seinen Bekannten mehrfach dahin geäussert haben, dass die Deutschen "harte Gesetze" hätten. Das hat er zur Begründung seines angeblichen irrigen Glaubens an die Rechtmässigkeit der Massenvernichtung jüdischer Menschen mehrfach vorgetragen. In Wirklichkeit wusste aber der Angeklagte Dr. Capesius, dass die Judenvernichtung nicht durch ein Gesetz oder eine veröffentlichte Verordnung oder einen schriftlichen Erlass angeordnet worden war. Er war - wie alle anderen SS-Angehörigen - zur strengsten Geheimhaltung über alles, was mit den Vernichtungsaktionen zusammenhing, verpflichtet worden und nahm bei seiner Anwesenheit auf der Rampe Kenntnis von den Täuschungsmanövern, mit denen die Opfer in die Gaskammern geführt wurden. Die strenge Geheimhaltung der Aktionen, die Täuschung der Opfer, an der er sich - wie sich aus den obigen Feststellungen ergibt - aktiv beteiligte, die grausame Art, wie die jüdischen Menschen umgebracht wurden und schliesslich die Tatsache, dass auch kleine Kinder und alte gebrechliche Menschen, die dem Deutschen Reich auf keinen Fall mehr gefährlich werden konnten, getötet wurden, mussten ihm den Gedanken aufdrängen, dass es sich hier nicht um "gesetzliche Massnahmen" oder um "harte Gesetze" der Deutschen handeln konnte.
Nach der Überzeugung des Gerichts hat er daher - wie alle anderen SS-Angehörigen in Auschwitz - entgegen seiner Einlassung, die nur als eine Schutzbehauptung anzusehen ist, das Bewusstsein gehabt, dass hier Unrecht geschah. Zur weiteren Begründung dieser Überzeugung kann ferner auf die Ausführungen unter A.V.2. Bezug genommen werden. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass der Angeklagte Baretzki, der ebenfalls Volksdeutscher aus Rumänien war, freimütig eingeräumt hat, dass er die Judenvernichtung als Unrecht erkannt hat. Wenn schon dieser primitive Angeklagte das Unrechtmässige der Judenvernichtung erkannt hat, kann bei dem Angeklagten Dr. Capesius, der als Akademiker wesentlich intelligenter und gebildeter als der Angeklagte Baretzki ist und ausserdem noch mit einer Halbjüdin verheiratet ist, kein Zweifel bestehen, dass er erkannt hat, dass die Befehle, die auf die Massenvernichtung von unschuldigen jüdischen Menschen hinzielten, ein allgemeines Verbrechen bezweckten, auch wenn er damals "nur" ein Volksdeutscher gewesen ist. Bei dem Ausmass und der Ungeheuerlichkeit der Verbrechen hält es das Gericht auch für ausgeschlossen, dass er irrig angenommen hat, er müsse die als rechtswidrig erkannten Befehle trotz ihres verbrecherischen Charakters als bindend befolgen. Hierzu kann im übrigen auf die bei anderen Angeklagten (insbesondere A.V.2.) zu dieser Frage gemachten Ausführungen Bezug genommen werden.
Der Angeklagte Dr. Capesius ist daher für seine Mitwirkung an den Vernichtungsaktionen strafrechtlich verantwortlich. Es konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass der Angeklagte Dr. Capesius die Vernichtungsaktionen zu seiner eigenen Sache gemacht und innerlich bejaht, somit mit Täterwillen gehandelt hat. Er ist als Rumäniendeutscher erst im Jahre 1943 zur Waffen-SS gekommen. Es konnte ihm nicht widerlegt werden, dass er gegen seinen Willen zur Waffen-SS eingezogen worden ist. Dass er ein überzeugter Nationalsozialist gewesen sei und sich in Übereinstimmung mit den weltanschaulichen und rassebiologischen Anschauungen der NS-Machthaber befunden hätte, hat die Beweisaufnahme nicht ergeben. Dagegen spricht auch, dass er mit einer Halbjüdin verheiratet war, von der er sich bis zum heutigen Tage nicht getrennt hat. Im KL Auschwitz ist er nicht als Rassenfanatiker, Eiferer oder Judenhasser in Erscheinung getreten. Nach dem von ihm auf Grund der Hauptverhandlung gewonnenen Eindruck hat er sich für diese Fragen wenig interessiert. Häftlingen gegenüber hat sich der Angeklagte nach den oben bereits ausgeführten Zeugenaussagen anständig verhalten. Den Zeuginnen Dr. Böh. und Sa., die ebenfalls Jüdinnen waren, hat er geholfen, dass sie das Lager überleben konnten. Vor der Einteilung zum Rampendienst im Frühjahr 1944 hat er sich nach den getroffenen Feststellungen nicht bei den Vernichtungsaktionen betätigt.
Es ist auch nicht ersichtlich, dass er ein eigenes persönliches Interesse an der Vernichtung der Juden gehabt hätte.
Allerdings hat sich der Angeklagte Dr. Capesius an Wertsachen und sonstigen Gegenständen, die den jüdischen Menschen nach ihrer Ankunft in Auschwitz abgenommen worden waren, bereichert.
Der Zeuge Sik. hat glaubhaft geschildert, dass ihm der Angeklagte Dr. Capesius einmal 15 Koffer mit Zähnen auf den Boden des SS-Reviergebäudes gezeigt habe. Ein Häftling namens Sulikowski habe diese Zähne sortieren und dann das in ihnen befindliche Zahngold einschmelzen müssen. Das sei eine Nebenarbeit des Sulikowski für den Chef (Dr. Capesius) gewesen. Der Zeuge Sik. hat ferner bekundet, dass der Angeklagte Dr. Capesius einmal mit einem Häftling eine Brosche gegen 3-4 Liter Spiritus eingetauscht habe.
Auch der Zeuge Sze. hat glaubhaft bekundet, dass das Sanitätsauto in einigen Fällen Koffer mit Zahnprothesen zum SS-Reviergebäude gebracht habe. Für die Zähne und Zahnprothesen sei an sich die SS-Zahnstation zuständig gewesen. Ein Häftling namens Sulikowski habe auf Anweisung des Angeklagten Dr. Capesius die Sachen sortiert und ihm jeden Tag Bericht darüber erstatten müssen. Er habe dem Angeklagten Dr. Capesius alle Goldteile geben müssen. Dr. Capesius habe Sulikowski die Anweisung gegeben, das geheim zu halten. Der Zeuge wusste zwar nicht, was der Angeklagte Dr. Capesius mit den Goldsachen gemacht hat. Das Gericht ist aber davon überzeugt, dass der Angeklagte Dr. Capesius das Gold für sich behalten hat. Denn ein anderer Grund, warum der Angeklagte durch Sulikowski das Gold hat einschmelzen lassen, ist nicht ersichtlich. Als Apotheker war er für das Einschmelzen des Goldes nicht zuständig. Die Zähne und Zahnprothesen waren an die SS-Zahnstation abzuliefern, die ein besonderes Schmelzkommando hatte. Der Angeklagte Dr. Frank war für die Ablieferung des Goldes verantwortlich. Dass der Angeklagte Dr. Capesius das geschmolzene Gold auch behalten hat, ergibt sich eindeutig daraus, dass er Sulikowski gebeten hat, das Einschmelzen des Goldes und die Ablieferung desselben an ihn geheim zu halten. Hätte er das Gold nicht für sich behalten, sondern abliefern wollen, wäre diese Anweisung auf Geheimhaltung nicht erforderlich gewesen.
Der Zeuge Sze. hat weiter glaubhaft bekundet, dass er einmal auf Anweisung des Angeklagten Dr. Capesius einige Lederkoffer aus dem Sanka in das Magazin der Apotheke hätte tragen müssen. Der Angeklagte Dr. Capesius habe dann den Raum von innen abgeschlossen und mit ihm zusammen die in den Koffern befindlichen Sachen sortiert. Der Angeklagte habe die besten Stücke in einen besonderen Koffer hineingelegt und gesagt, das bleibe zu seiner Verfügung. Das Geld in fremder Währung habe er gleich in seine Tasche gesteckt, während er das deutsche Geld in den Koffern gelassen habe. Wertgegenstände und Uhren habe er ebenfalls an sich genommen, indem er sie teils in seine Tasche gesteckt, teils in die besonderen Koffer, die zu seiner Verfügung bleiben sollten, gelegt habe.
Auch hieraus ergibt sich, dass der Angeklagte Dr. Capesius einen Teil des Häftlingsgutes an sich gebracht und für sich behalten hat. Denn wenn er alle Gegenstände hätte abliefern wollen - wie es vorgeschrieben war - hätte er sie nicht erst in die besonderen Koffer packen oder in seine Taschen stecken brauchen. Die Tatsache, dass er die Tür abgeschlossen hat, spricht dafür, dass er nicht hat überrascht werden wollen, woraus sich ergibt, dass er etwas tun wollte, was verboten war.
Ferner hat der Zeuge Pro. glaubhaft geschildert, dass er einmal dabeigestanden habe, wie der Angeklagte Capesius zwei neue Lederkoffer auf ihren Inhalt untersucht habe. Der Angeklagte habe sich die in den Koffern befindlichen Anzüge, Wäschestücke, Schuhe usw. angesehen und dann wieder in die Koffer zurückgelegt. Dabei habe er ihm gedroht, indem er ihn darauf hingewiesen habe, dass er ein Kandidat des Todes sei und damit rechnen müsse, vorzeitig sein Leben zu verlieren, wenn er irgendetwas über das, was er gesehen habe, verlauten lasse und zu jemandem darüber spreche. Anschliessend habe er die Koffer wieder verschlossen und ihm - dem Zeugen - befohlen, die Koffer so beiseite zu stellen, dass sie niemand sehen könne. Am nächsten Tage seien die Koffer verschwunden gewesen.
Auch aus diesen vom Zeugen glaubhaft geschilderten Umständen ergibt sich nach Auffassung des Schwurgerichts eindeutig, dass sich der Angeklagte Dr. Capesius die in den Koffern befindlichen Sachen angeeignet hat.
Schliesslich hat der Zeuge Bar. erklärt, dass in Auschwitz darüber gesprochen worden sei, dass der Angeklagte Dr. Capesius sich Sachen "organisiert" habe. Nach den im Lager umlaufenden Gerüchten soll er sogar Sachen an seine Schwester in Wien geschickt haben.
Aus all diesen Zeugenaussagen ergibt sich, dass sich der Angeklagte Dr. Capesius - wie viele andere SS-Angehörigen - an den den jüdischen Menschen abgenommenen Wertgegenständen, Kleidungsstücken, Geldern und sonstigen Sachen bereichert hat. Gleichwohl kann hieraus nach Auffassung des Gerichts noch nicht der Schluss gezogen werden, dass der Angeklagte Dr.
Capesius an der Tötung der jüdischen Menschen ein eigenes persönliches Interesse gehabt hat. Denn er konnte sich die Sachen auch aneignen, ohne dass die Juden getötet wurden. Auf der Rampe in Birkenau wurden allen Juden, auch denen, die in das Lager aufgenommen wurden, die persönlichen Sachen abgenommen. Wer in das Lager aufgenommen wurde, erhielt später seine persönlichen Sachen nie wieder zurück. Das gesamte Gepäck - auch das der Überlebenden - sollte in das Lager Kanada gebracht, dort sortiert und dann nach Berlin geschickt werden. Nach Auffassung des Gerichts hat der Angeklagte Dr. Capesius - wie viele andere SS-Angehörigen - nur die Gelegenheit, die sich ihm bot, ausgenutzt, um sich Sachen anzueignen. Dabei mag der Gedanke eine Rolle gespielt haben, dass die Habe der jüdischen Menschen sowieso dem Deutschen Reich verfallen sei und es für die Opfer gleichgültig sein müsse, ob ihre persönlichen Gegenstände in den Besitz des Reiches oder in seinen eigenen Besitz übergingen. Die Tatsache, dass er sich an dieser Habe bereichert hat, die - aus seiner Sicht gesehen - bereits dem Deutschen Reich verfallen war, zwingt daher nicht zu dem Schluss, dass er die Tötung der jüdischen Menschen aus eigenem persönlichen Interesse, nämlich, um in den Besitz dieser Habe zu kommen, gewollt hat.
Andererseits hat der Angeklagte Dr. Capesius nicht nur widerstrebend den Rampendienst verrichtet. Hätte er den Vernichtungsaktionen innerlich ablehnend gegenüber gestanden, hätte er sich auf der Rampe eine grössere Zurückhaltung auferlegt. Die Tatsache, dass er die Opfer in schamloser Weise getäuscht hat, indem er ihnen vorspiegelte, sie würden es gut haben, sie kämen an einen guten Ort, und dass er den Vater der Zeugin Krau. zu den dem Tode geweihten Menschen geschickt hat, obwohl er ihn ohne weiteres hätte vor dem Tode bewahren können, zeigt, dass er die gegebenen Befehle bereitwillig ausgeführt hat und die Vernichtungsaktionen ohne sittliche und moralische Hemmungen unterstützen wollte. Im Falle des Vaters der Zeugin Krau. liegt es sogar nahe, auf einen Täterwillen des Angeklagten Dr. Capesius zu schliessen. Wenn das Schwurgericht trotzdem auch in diesem Falle einen Täterwillen des Angeklagten nicht angenommen hat, so deswegen, weil nicht hat festgestellt werden können, dass der Angeklagte Dr. Capesius ein eigenes persönliches Interesse am Tode gerade dieses Mannes gehabt hat. Persönliche Motive, wie Rache oder Vergeltung für früheres Verhalten dieses Mannes ihm gegenüber sind nicht erkennbar geworden. Möglicherweise hat er ihm den Wunsch, mit seiner Familie zusammenbleiben zu können, aus einer gewissen Bequemlichkeit heraus erfüllt, um weiteren Diskussionen aus dem Wege zu gehen und um nicht erkennbar werden zu lassen, welches Schicksal den anderen, die in der Gruppe der für den Gastod Bestimmten standen, bevorstand.
Das Gericht hat daher auch bei dem Angeklagten Dr. Capesius nur feststellen können, dass er durch seine geschilderten Handlungen auf der Rampe und an der Gaskammer die Mordtaten der Haupttäter als Gehilfe hat fördern und unterstützen wollen. Da der Angeklagte Dr. Capesius - wie oben schon ausgeführt - das Bewusstsein gehabt hat, die Mordtaten der Haupttäter zu fördern und auch die gesamten Tatumstände gekannt hat, die den Beweggrund der Haupttäter für die Massentötung der jüdischen Menschen als niedrig und die Art ihrer Tötung als heimtückisch und grausam kennzeichnen - was sich aus den getroffenen Feststellungen und daraus, dass er die Opfer auf der Rampe selbst täuschte und in zwei Fällen den Todeskampf der Opfer in der Gaskammer miterlebte, ergibt -, hat er auch vorsätzlich gehandelt.
Irgendwelche Rechtfertigungs- oder Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich. Der Angeklagte Dr. Capesius ist nicht durch Drohung mit einer gegenwärtigen auf andere Weise nicht abwendbaren Gefahr für Leib oder Leben zum Rampendienst gezwungen worden. Auch hat er nicht den Rampendienst in einem unverschuldeten, auf andere Weise nicht zu beseitigenden Notstand zur Rettung aus einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben verrichtet.
Der Angeklagte Dr. Capesius hat sich selbst nicht darauf berufen, dass sein Wille gebeugt worden sei oder dass er Rampendienst und Gaskammerdienst verrichtet habe, um sein eigenes Leben zu retten. Das konnte er auch nicht, weil er geleugnet hat, an den Vernichtungsaktionen in irgend einer Weise beteiligt gewesen zu sein. Die Tatsache, dass er wahrheitswidrig die Mitwirkung an den Vernichtungsaktionen in Abrede gestellt hat, spricht an sich schon dafür, dass die tatsächlichen Voraussetzungen für einen sog. Befehlsnotstand oder einen allgemeinen Notstand im Sinne des §54 StGB nicht vorgelegen haben. Denn anderenfalls hätte er wahrheitsgemäss zugeben können, Rampendienst und Dienst an der Gaskammer versehen zu haben, um gleichzeitig die Tatsachen anzuführen, aus denen sich das Vorliegen eines Nötigungsnotstandes oder eines allgemeinen Notstandes ergeben hätten.
Gleichwohl hat das Gericht die Möglichkeit einer Zwangslage im Sinne der §§52 oder 54 StGB untersucht.
Der Angeklagte Dr. Capesius hat bei seiner Einlassung zur Sache behauptet, er habe sich nach der Besprechung im Frühjahr 1944 bei Dr. Wirths gemeldet und habe ihn gebeten, ihn vom Rampendienst zu befreien, da er das nicht könne. Dr. Wirths habe ihm daraufhin erregt geantwortet, das sei Befehlsverweigerung, er werde ihn erschiessen lassen, wenn er darauf beharre. Er - Dr. Wirths - habe Sondervollmachten im KL. Daraufhin habe er - der Angeklagte - sich noch am gleichen Tag telefonisch an seinen Freund, den SS-Sturmbannführer Becker in Berlin gewandt und ihm mitgeteilt, dass er mit Mord bedroht werde. Becker sei einige Tage darauf nach Auschwitz gekommen. Er habe aber nicht mehr einzugreifen brauchen, da er - der Angeklagte - sich bereits mit dem SS-Arzt Dr. Klein über den Rampendienst geeinigt habe.
Becker habe dann in Berlin seinen Fall dem SS-Standartenführer Dr. Lolling (Chef des Amtes D III im WVHA und unmittelbarer Vorgesetzter des Dr. Wirths) weiter erzählt, und veranlasst, dass dieser zusammen mit ihm nach einiger Zeit nach Auschwitz gekommen sei, um zwischen ihm - dem Angeklagten - und Dr. Wirths zu vermitteln. Bei einem Abendessen hätte Dr. Lolling in Auschwitz erklärt, dass Dr. Wirths zu weit gegangen sei und dass er - der Angeklagte - die Drohung des Dr. Wirths entschuldigen solle. Dr. Wirths solle seinen Befehl zurücknehmen. Dr. Wirths habe daraufhin gesagt, Befehle müssten zwar befolgt werden, da er - der Angeklagte - sich aber mit Dr. Klein wegen des Rampendienstes geeinigt habe, sei dagegen nichts einzuwenden.
Folgt man dieser Einlassung des Angeklagten, so bestand für ihn, auch wenn ihm Dr. Wirths ursprünglich mit Erschiessen gedroht haben sollte, kein Zwang mehr, Selektionsdienst und Dienst an der Gaskammer zu machen. Gleichwohl hat er - wie auf Grund der Beweisaufnahme feststeht - Rampendienst und Dienst an der Gaskammer verrichtet. Nach seiner eigenen Einlassung kann er sich hierbei nicht in einem Befehlsnotstand oder einem allgemeinen Notstand befunden haben.
Sieht man einmal von der Einlassung des Angeklagten Dr. Capesius ab, so liegen ebenfalls keine Anhaltspunkte dafür vor, dass er sich in einem Notstand im Sinne der §§52 oder 54 StGB befunden habe.
Bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Dr. L. ist bereits ausgeführt worden, dass es dem Zeugen Dr. M. als Unterscharführer und ohne Beziehungen in Berlin gelungen ist, durch eine Vorsprache bei Dr. Lolling Befreiung vom Rampendienst zu erreichen. Dr. Wirths hat die Weisung des Dr. Lolling, den Zeugen Dr. M. vom Rampendienst freizustellen, ohne weiteres befolgt. Nach der Überzeugung des Gerichts wäre es dem Angeklagten Dr. Capesius ebenfalls ohne weiteres gelungen, vom Rampendienst freigestellt zu werden, wenn er sich ernstlich darum bemüht hätte. Denn seine Situation war wesentlich günstiger als die des Dr. M. Er war nicht Arzt, sondern nur Apotheker, also weniger für den Rampendienst geeignet als der Zeuge Dr. M. Ferner hat er einen Bekannten des Dr. Lolling als Freund, nämlich den SS-Sturmbannführer Becker, gehabt, der im Rang höher als Dr. Wirths stand und den er um Vermittlung bei Dr. Wirths hätte bitten können. Schliesslich hätte der Angeklagte Dr. Capesius gegenüber seinem Freund Becker und Dr. Lolling noch in die Waagschale werfen können, dass er mit einer Halbjüdin verheiratet sei und ihm daher nicht zugemutet werden könne, an den Vernichtungsaktionen teilzunehmen. Dass Dr. Lolling sich gegenüber solchen Argumenten aufgeschlossen zeigte und bereit war, Ärzte, die sich dem Rampendienst nicht gewachsen fühlten, von diesem Dienst freizustellen, zeigt der Fall des Zeugen Dr. M.
Ferner spricht auch das Verhalten des Angeklagten Dr. Capesius auf der Rampe eindeutig gegen eine wirkliche oder vermeintliche Zwangslage. Wäre sein Wille tatsächlich gebeugt worden, hätte er nach der Überzeugung des Gerichts die jüdischen Menschen nicht in der geschilderten Weise über ihr bevorstehendes Schicksal getäuscht, auch hätte er nicht den Vater der Zeugin Krau. in den Tod geschickt. Dann hätte er nur das getan, was unumgänglich notwendig war und hätte im übrigen versucht, so viel Menschen wie nur irgend möglich zu retten. Schliesslich kann in diesem Zusammenhang nicht unberücksichtigt bleiben, dass sich der Angeklagte Dr. Capesius am Häftlingsgut bereichert hat. Auch das spricht dagegen, dass er den Rampendienst nur in einer Notstandslage verrichtet hat.
Sonstige Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich.
Der Angeklagte Dr. Capesius war daher wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zu gemeinschaftlichem Mord in mindestens vier Fällen (§§47, 49, 211, 74 StGB), begangen jeweils in gleichartiger Tateinheit (§73 StGB) an je mindestens zweitausend Menschen, zu verurteilen.
V. Hilfsbeweisanträge
Der Antrag des Verteidigers des Angeklagten Dr. Capesius auf Vernehmung des Generalstaatsanwaltes Dr. Streit (Ostberlin), dass die Verhinderung der Eheleute Rump nur vorübergehend ist, war abzulehnen.
Dieser Antrag stellt keine für die Aufklärung der Schuld oder Nichtschuld der Angeklagten erheblichen Tatsachen unter Beweis. Durch die Vernehmung des Generalstaatsanwaltes Streit soll nur ermittelt werden, ob die in der Sowjetzone wohnenden Eheleute Rump, die bisher auf die Ladungen des Gerichts hin nicht in der Hauptverhandlung erscheinen konnten, weil sie keine Ausreisegenehmigung bekommen haben, in absehbarer Zeit vor Gericht vernommen werden können, ob also ihre Verhinderung nur eine vorübergehende ist. Diese Frage hat das Gericht im Wege des sog. Freibeweisverfahrens von Amts wegen zu prüfen.
Das Gericht hat bereits festgestellt, dass die Eheleute Rump in absehbarer Zeit nicht in der Hauptverhandlung vernommen werden können. Nach den bisherigen Bemühungen der Staatsanwaltschaft und den Erfahrungen des Gerichts steht fest, dass die Eheleute Rump am Erscheinen in der Hauptverhandlung verhindert sind und auch in absehbarer Zeit mit ihrem Erscheinen in der Hauptverhandlung nicht gerechnet werden kann. Auf die erste Ladung der Eheleute Rump durch die Staatsanwaltschaft, die nur über den Generalstaatsanwalt Streit in Ostberlin erfolgen konnte, ist den Eheleuten Rump keine Ausreisegenehmigung aus der Sowjetzone zur Vernehmung in der Hauptverhandlung erteilt worden. Auf eine spätere erneute Ladung der Eheleute Rump durch die Staatsanwaltschaft, die ebenfalls wieder über den Generalstaatsanwalt Streit zur Weiterleitung an die Eheleute Rump gerichtet worden ist, hat der Generalstaatsanwalt Streit keine Antwort mehr erteilt. Er hat auch keine Zustellungsurkunde zum Nachweis der Ladung der Zeugen zurückgeschickt. Daraus ist ersichtlich, dass die zuständigen Behörden der Sowjetzone nicht gewillt sind, in Zukunft den Eheleuten Rump eine Ausreise für die Vernehmung in der Hauptverhandlung zu gestatten. Irgendeine Möglichkeit, das Erscheinen der Eheleute Rump in der Hauptverhandlung zu erzwingen, besteht nicht. Eine Vorladung des Generalstaatsanwaltes Streit vor das Schwurgericht zur Vernehmung über das von dem Verteidiger des Angeklagten Capesius angegebene Beweisthema erscheint von vornherein zwecklos. Nach den bisherigen Erfahrungen würde er einer solchen Vorladung keine Folge leisten. Auch eine
schriftliche Anfrage an den Generalstaatsanwalt Streit über das von dem Verteidiger angegebene Beweisthema erscheint aussichtslos. Sie würde nach den bisherigen Erfahrungen des Gerichts nicht beantwortet werden. Da somit bereits jetzt feststeht, dass die Eheleute Rump am Erscheinen in der Hauptverhandlung verhindert sind, bedarf es der Erhebung des vom Verteidiger des Angeklagten Dr. Capesius beantragten Beweises nicht mehr.
Die weiteren Hilfsbeweisanträge des Verteidigers des Angeklagten Dr. Capesius,
1. den Leiter der Kreissparkasse Göppingen als Zeugen darüber zu vernehmen, dass Dr. Capesius im Jahre 1950 von der Kreissparkasse einen Kredit im Gesamtbetrage von 45000 DM zu 9 3/4% Zinsen erhalten hat, der zum Jahresbeginn 1956 gänzlich zurückgezahlt war,
2. den die Betriebsprüfung der Markt-Apotheke in Göppingen im Jahre 1959 leitenden Beamten des Finanzamtes in Göppingen darüber zu vernehmen, dass
a. die Prüfung ohne Beanstandungen durchgeführt worden ist,
b. sich aus der Prüfung ergeben hat, dass der Aufbau der Apotheke insgesamt etwa 90000 DM an Geldmitteln erfordert hat, die aus den Überschüssen in der Apotheke aus den Jahren 1951-1956 bestritten worden sind, wie sich das aus der laufenden Aufzeichnung der Ein- und Ausgaben ergibt,
3. einen Buchsachverständigen darüber zu vernehmen, dass sich aus den für die Markt-Apotheke in Göppingen für die Jahre 1950-1959 geführten Büchern folgendes ergibt:
a. der Aufbau der Apotheke hat etwa 90000 DM an Geldmitteln erfordert,
b. sämtliche Mittel sind aus den Überschüssen in der Apotheke laufend in den Jahren 1951-1956 bestritten worden,
4. einen Sachverständigen darüber zu vernehmen, dass der Aufbau der Marktapotheke in Göppingen in den Jahren 1950-1956 keinen höheren Betrag als 90000 DM erfordert hat,
5. den Verkäufer des Kosmetiksalons in Reutlingen darüber zu vernehmen, dass er im Jahre 1955 diesen Kosmetiksalon zu einem Preis von 11000 DM an Dr. Capesius verkauft hat,
6. eine Auskunft vom Finanzamt in Göppingen über die von Dr. Capesius in den Jahren 1951-1959 versteuerten Einkommensbeträge einzubeholen, woraus sich ergeben werde, dass Dr. Capesius aus diesen Einnahmen in der Lage gewesen sei,
a. eine Eigentumswohnung zu einem Preise von 35000 DM zu erwerben,
b. gemeinsam mit anderen Pächtern eine Jagd zu pachten,
c. an einer Safari nach Afrika teilzunehmen,
d. ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel sich eines Verteidigers seiner Wahl zu normalen Bedingungen zu bedienen,
waren gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da die unter Beweis gestellten Tatsachen so behandelt werden können, als wären sie wahr. Auch wenn alles stimmt, was in den Hilfsbeweisanträgen behauptet worden ist, wird dadurch nicht die Feststellung des Gerichts erschüttert oder widerlegt, dass sich der Angeklagte Dr. Capesius im Konzentrationslager Auschwitz am Häftlingsgut bereichert hat. Das Gericht hat nicht festgestellt, dass der Angeklagte mit dem Gold oder dem Geld oder sonstigen Gegenständen, die er sich in Auschwitz angeeignet hat, die Apotheke aufgebaut oder den Kosmetiksalon erworben habe. Der Antrag des Verteidigers des Angeklagten Dr. Capesius, durch eine Auskunft bei dem Finanzamt in Göppingen die Höhe des von Dr. Capesius erklärten Vermögens festzustellen, war ebenfalls gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da es für die Entscheidung ohne Bedeutung ist, welches Vermögen der Angeklagte Dr. Capesius zur Zeit besitzt.
Die Hilfsbeweisanträge des Verteidigers des Angeklagten Dr. Capesius,
den bereits vernommenen Zeugen Wö. eidlich darüber zu vernehmen, dass ihm persönlich aus eigenem Wissen nichts darüber bekannt ist, dass im Auftrag des Dr. Capesius irgendwelche Geldbeträge für den Fall einer Aussage in Aussicht gestellt oder angeboten worden sind,
den Kaufmann Hermann Eisler aus Göppingen als Zeugen darüber zu vernehmen, dass er in der Unterhaltung mit Personen, die als Zeugen für Dr. Capesius in Frage kommen konnten, niemals auch nur angedeutet hat, für den Fall der Bereitschaft stehen Geldbeträge zur Verfügung,
den Bauingenieur Letzt, wohnhaft in München, als Zeugen darüber zu vernehmen, dass die Mutter der Frau Gisela Böh. seiner Mutter gegenüber geäussert hat: "Nur dem Dr. Capesius habe sie es zu verdanken, dass sie heute noch eine Tochter und ihre Enkel habe",
die Frau Girscht, wohnhaft in Winnenden, als Zeugin darüber zu vernehmen, dass sich Frau Böh. ihr gegenüber in dem gleichen Sinne geäussert habe,
waren gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da die in das Wissen der Zeugen gestellten Tatsachen zu Gunsten des Angeklagten so behandelt werden können, als wären die behaupteten Tatsachen wahr.
Der Antrag des Verteidigers des Angeklagten Dr. Capesius, das Protokoll über die Vernehmung des Zeugen Dr. Bern. durch die Polizeibehörde in Jerusalem vom 3.7.1962 (Blatt 13032 der Gerichtsakten) zu verlesen, war abzulehnen, da die Vernehmung des Zeugen nicht durch die Verlesung des über eine frühere Vernehmung aufgenommenen Protokolls oder einer schriftlichen Erklärung ersetzt werden darf (§250 Satz 2 StPO). Der Zeuge Dr. Bern. ist in der Hauptverhandlung vernommen worden. Seinem erneuten Erscheinen in der Hauptverhandlung stehen keine Hindernisse entgegen. Seine erneute Ladung hätte daher beantragt werden können. Die Voraussetzung für die Verlesung eines polizeilichen Protokolls über eine frühere Vernehmung des Zeugen im Sinne des §251 StPO liegt nicht vor.
Im übrigen befand sich das Protokoll über die frühere Vernehmung des Zeugen Dr. Bern. bereits in den Gerichtsakten und war dem Verteidiger des Angeklagten Dr. Capesius bekannt, als der Zeuge Dr. Bern. in der Hauptverhandlung vernommen worden ist. Der Verteidiger und der Angeklagte haben somit die Möglichkeit gehabt, dem Zeugen aus diesem früheren Protokoll Vorhalte zu machen. Das haben sie jedoch nicht getan. Das Gericht hat keine Veranlassung gehabt, dem Zeugen aus diesem Protokoll Vorhalte zu machen. Es besteht auch keine Veranlassung, von Amts wegen (§244 Abs.II StPO) den Zeugen erneut zu laden, um ihm Vorhalte aus dem genannten Protokoll zu machen. Wenn es die Verteidigung des Angeklagten Dr. Capesius für notwendig gehalten hat, dem Zeugen nachträglich Vorhalte aus dem früheren Protokoll zu machen, hätte es die erneute Ladung und Vernehmung beantragen müssen.
Der Antrag des Verteidigers des Angeklagten Dr. Capesius, das über die Vernehmung des Zeugen Dr. Bern. in der Hauptverhandlung aufgenommene Tonband ablaufen zu lassen, war als unzulässig zurückzuweisen, da das Tonband, das Teile der Hauptverhandlung aufgenommen hat, kein Beweismittel im Sinne des §244 StPO ist. Es ist nur eine Ergänzung der Notizen des Berichterstatters und dient nur zur Stütze des Gedächtnisses des Gerichts. Die Notizen des Berichterstatters werden den Prozessbeteiligten ebenfalls nicht zur Verfügung gestellt und brauchen in der Hauptverhandlung nicht verlesen zu werden. Im übrigen ist es richtig, dass der Zeuge Dr. Bern. auf einen Vorhalt des Vorsitzenden, dass der Angeklagte Dr. Capesius am 29.5.1944 in Berlin gewesen sein wolle, erklärt hat - wie der Verteidiger des Angeklagten Dr. Capesius behauptet - "wenn er beweisen kann, dass er an diesem Tag nicht in Auschwitz auf der Rampe war ...." ohne den Satz zu vollenden.
Das Gericht hat dies bei seiner Beweiswürdigung berücksichtigt. Auf Vorhalt des Verteidigers des Angeklagten Dr. Capesius, der diesen begonnenen Satz noch einmal aufgegriffen und den Zeugen gefragt hat, was der Zeuge denn habe sagen wollen, hat der Zeuge erklärt, dass es dann die Sache des Gerichts sei, die Beweise zu prüfen. Hieraus folgt, dass der Zeuge weiterhin mit Sicherheit davon ausgegangen ist, dass er am 29.5.1944 in Auschwitz angekommen ist. Er blieb auch auf weiteren Vorhalt des Verteidigers mit aller Bestimmtheit dabei, dass es sich bei seinem Ankunftstag in Auschwitz um den 29.5.1944 gehandelt habe und dass er den Dr. Capesius erkannt habe und eine Verwechslung ausgeschlossen sei.
Der Antrag, das Buch des Zeugen Dr. Bern., und zwar die Seiten 29 bis 33 in die deutsche Sprache übertragen zu lassen zum Beweise dafür, dass der Zeuge den Angeklagten Dr. Capesius in seinem Buch nicht erwähnt hat, war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da auf Grund der Aussage des Zeugen Dr. Bern. bereits erwiesen ist, dass der Zeuge den Namen des Angeklagten Dr. Capesius in seinem Buch nicht erwähnt hat. Das Gericht ist - wie sich aus seiner Beweiswürdigung ergibt (vgl. oben III.) - von dieser Tatsache ausgegangen. Der Zeuge hat auch eine überzeugende Erklärung dafür gegeben, warum er den Namen des Angeklagten Dr. Capesius nicht erwähnt hat. Wie bereits ausgeführt, hat der Zeuge dem Angeklagten in seinem Buch kein Denkmal setzen wollen.
Der weitere Antrag, das Buch des Zeugen Dr. Bern. nach Übersetzung in die deutsche Sprache zu verlesen zum Beweise dafür, dass der Zeuge Namen in seinem Buche genannt hat, war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da zu Gunsten des Angeklagten Dr. Capesius als wahr unterstellt werden kann, dass der Zeuge Namen von anderen Personen in seinem Buche genannt hat. Der Zeuge hat zwar auf Befragen erklärt, er habe auch sonstige Namen in seinem Buche nicht erwähnt. Das hat er aber nach der Überzeugung des Gerichts nur im Zusammenhang mit der Schilderung des Vorfalls auf der Rampe gemeint. Wenn er daher in sonstigen Teilen seines Buches Namen, z.B. Dr. Mengele genannt hat, so steht das nicht in Widerspruch zu seiner Aussage in der Hauptverhandlung. Dass der Zeuge Namen bei Schilderung seiner Erlebnisse auf der Rampe in Birkenau genannt habe, behauptet der Verteidiger in seinem Beweisantrag nicht. Die Glaubwürdigkeit des Zeugen wird daher durch die Tatsache, dass er in sonstigen Teilen seines Buches Namen von Personen genannt hat, nicht erschüttert.
Die unter den Ziffern 18 bis 31 im Schriftsatz vom 22.Juli 1965 aufgeführten Beweisanträge, die vom Verteidiger des Angeklagten Dr. Capesius in der Hauptverhandlung mündlich gestellt worden sind, brauchten nicht beschieden zu werden, da sie sich auf die Zeugen Glü., Eh. und von Sebe. beziehen, deren Aussagen das Schwurgericht nicht verwertet hat und die nicht Grundlage für die getroffenen Feststellungen sind. Das Urteil beruht in keiner Weise auf den Aussagen dieser drei Zeugen. Die Anträge sind nur hilfsweise für den Fall gestellt, dass das Gericht den Aussagen dieser Zeugen irgendeine Bedeutung beimessen sollte. Eine Entscheidung über diese Anträge war daher nicht erforderlich.
Die Hilfsanträge, folgende Urkunden zu verlesen:
1. Den Brief der Zeugin Dr. Böh. vom 16.8.1962 an den Untersuchungsrichter Dr. Dü.
2. Den Brief des Zeugen Pajo. vom 15.9.1963 an den Untersuchungsrichter Dr. Dü.
3. Den Brief des Zeugen Pajo. vom 10.11.1962 an den Untersuchungsrichter
4. Die schriftliche Erklärung der Zeugin Ad. vor dem Staatsnotariat des Bezirkes Crisana der Volksrepublik Rumänien vom 20.2.1963
5. Den Brief des Zeugen Sebe. an den Zeugen La. vom 3.9.1960
6. Das Protokoll über die Vernehmung der Zeugin Sza. vor dem Landesgericht für Strafsachen in Wien vom 24.9.1962
7. Das Protokoll über die Vernehmung des Zeugen Pro. vom 11.8.1962 vor dem Kreisgericht in Wodzislaw
8. Das Protokoll über die staatsanwaltschaftliche Vernehmung des Zeugen Sik. vom 16.5.1960
9. Den Brief des Zeugen La. vom 15.2.1962 an den Untersuchungsrichter Dr. Dü.
waren gemäss §244 Abs.III Satz I StPO abzulehnen, da die Verlesung der genannten Urkunden unzulässig ist. Die Zeugen Böh., Pajo., Ad., von Sebe., Sza., Sik., Pro. und La. sind sämtlich in der Hauptverhandlung vernommen worden. Die genannten Briefe und Vernehmungsprotokolle waren im Zeitpunkt der Vernehmung der Zeugen bereits in den Akten enthalten. Sie waren den Angeklagten und den Verteidigern bekannt. Das Gericht hat keine Veranlassung gehabt, über die gemachten Vorhalte hinaus, aus den genannten Urkunden weitere Vorhalte zu machen. Der Verteidiger des Angeklagten Dr. Capesius und der Angeklagte selbst haben das Recht und die Möglichkeit gehabt, ihrerseits Vorhalte aus diesen Urkunden zu machen. Nach der Entlassung der Zeugen ist diese Verlesung der genannten Briefe und Protokolle nicht zulässig. Denn sie enthalten Erklärungen, die die Zeugen in diesem Verfahren zu Beweiszwecken an den Untersuchungsrichter gemacht haben. Ebenso enthalten die Vernehmungsprotokolle Aussagen der Zeugen, die sie zu Beweiszwecken in diesem Verfahren gemacht haben. Durch die Verlesung der genannten Urkunden soll nachträglich die unmittelbare Vernehmung der Zeugen in der Hauptverhandlung ersetzt werden. Durch die Urkunden soll bewiesen werden, dass die von den Zeugen in der Hauptverhandlung geschilderten Vorgänge sich nicht so abgespielt haben, wie es die Zeugen in der Hauptverhandlung dargestellt haben. Das ist nach §250 Satz 2 StPO nicht zulässig.
Die Voraussetzungen für eine Verlesung der genannten Urkunden nach §251 StPO liegen nicht vor. Dem erneuten Erscheinen der Zeugen in der Hauptverhandlung standen keine Hindernisse entgegen. Die Verteidiger hätten, wenn sie nachträglich weitere Vorhalte an die Zeugen aus den genannten Urkunden für erforderlich gehalten haben sollten, die erneute Vernehmung der Zeugen beantragen müssen, um ihnen aus den Urkunden die versäumten Vorhalte machen zu können.
Das Gericht hat keine Veranlassung gehabt, von Amts wegen gemäss §244 Abs.II StPO die Zeugen erneut zu laden, um ihnen Vorhalte aus den genannten Briefen und Protokollen zu machen, da keine Anhaltspunkte gegeben sind, dass die Angaben der Zeugen Böh., Pajo., Ad., Sik., La. und Pro. unglaubhaft sind. Bezüglich der Zeugen von Sebe. und Sza. ist darauf hinzuweisen, dass ihre Aussagen nicht verwertet worden sind, so dass das Urteil gegen den Angeklagten Dr. Capesius nicht auf den Aussagen dieser Zeugen beruht. Daher war die Verlesung der Urkunden, die irgendwelche Erklärungen oder Bekundungen dieser beiden Zeugen enthalten schon aus diesem Grunde nicht erforderlich.
Der Antrag, den von der Zeugin Dr. Böh. dem rumänischen Untersuchungsausschuss eingereichten Bericht beizuziehen, war abzulehnen, da es sich bei diesem Antrag nicht um einen Beweisantrag sondern um einen Beweisermittlungsantrag handelt. Die Verteidigung hat nicht die Verlesung, sondern nur die Beiziehung des Berichtes beantragt. Irgendwelche erheblichen Tatsachen, zu deren Zweck der beigezogene Bericht evtl. verlesen werden soll, sind nicht angegeben. Offenbar soll die Beiziehung des Berichtes erst dazu dienen, festzustellen, ob in ihm beweiserhebliche Tatsachen enthalten sind.
Der Antrag, ein Sachverständigengutachten darüber einzuholen, dass die Zeugin Sza. mit der Häftlingsnummer A 11937 nicht am 29.5.1944 in Auschwitz eingetroffen sein kann, war ebenfalls abzulehnen, da das Urteil nicht auf der Aussage der Zeugin Sza. beruht und das Gericht im übrigen davon ausgegangen ist, dass die Zeugin nicht am 29.5.1944 in Auschwitz eingetroffen ist.
Der Antrag, Blatt 12432 der Gerichtsakten zu verlesen, war ebenfalls abzulehnen. Dem Zeugen Bar. sind bereits in der Hauptverhandlung Vorhalte aus Blatt 12432 der Gerichtsakten gemacht worden. Aus dem Schriftstück auf Blatt 12432 d.A., das als Durchschlag eines Originals erscheint, ergibt sich im übrigen nicht, wer der Urheber des Schreibens ist. Auch wenn man unterstellt, dass es von dem Zeugen La. oder einer ihm bekannten Person stammt und dass es Erklärungen des Zeugen Bar. enthält, ist eine Verlesung nicht zulässig (§250 StPO). Denn durch die Verlesung dieser schriftlichen Erklärung des Zeugen Bar. bzw. einer mündlichen Erklärung des Zeugen, die er gegenüber dem Zeugen La. oder gegenüber einer anderen Person gemacht hat und die schriftlich festgehalten worden ist, würde in unzulässiger Weise die Vernehmung des Zeugen Bar. in der Hauptverhandlung ersetzt.
Der Antrag,
a. den Zeugen La. darüber zu vernehmen, dass die Aufzeichnung Blatt 12432 der Gerichtsakten von einer ihm bekannten Person stammt, eventuell von ihm selbst,
b. den Zeugen Bar. darüber zu vernehmen, dass er die Angaben, er habe selbst gesehen, dass Dr. Capesius selektiert habe und dass sich Dr. Capesius Häftlingsgut in grossem Massstab angeeignet habe, zu keiner Zeit gemacht hat,
war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da die in das Wissen der Zeugen gestellten Tatsachen so behandelt werden können, als wären sie wahr. Oben ist bereits ausgeführt worden, dass die Verlesung von Blatt 12432 auch dann nicht zulässig wäre, wenn sie von dem Zeugen La. oder einer ihm bekannten Person stammt.
Das Gericht ist nicht davon ausgegangen, dass der Zeuge Bar. selbst gesehen hat, dass Dr. Capesius selektiert und sich Häftlingsgut in grossem Massstab angeeignet hat. Es ist auch nicht davon ausgegangen, dass der Zeuge jemals eine solche Angabe gemacht hat. Der Zeuge Bar. hat in der Hauptverhandlung lediglich erklärt, dass in Auschwitz darüber gesprochen worden sei, dass der Angeklagte Dr. Capesius sich Sachen "organisiert" habe. Nur von dieser Aussage des Zeugen ist das Schwurgericht ausgegangen.
Der Antrag, Blatt 11600-11614 der Gerichtsakten zu verlesen, braucht nicht beschieden zu werden, da das Urteil gegen den Angeklagten Dr. Capesius nicht auf der Aussage des Dr. Loeb. beruht. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, dass das Protokoll über eine frühere Vernehmung des Zeugen Dr. Loeb. nicht zulässig ist (§250 StPO). Es kann auf die obigen Ausführungen verwiesen werden.
Der Antrag, Blatt 13534 (Schreiben des Untersuchungsrichters vom 17.9.1962 an einen Polizeimajor in Israel) zu verlesen, war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da als wahr unterstellt werden kann, dass der Untersuchungsrichter mit diesem Schreiben dem israelischen Polizeimajor die Übersendung von Bildmaterial angekündigt hat.
Der Antrag, das Tonband, das die Aussage der Zeugin Sza. in der Hauptverhandlung aufgenommen hat, abspielen zu lassen, braucht nicht beschieden zu werden, da das Urteil nicht auf der Aussage der Zeugin Sza. beruht. Im übrigen ist das Tonband, das Teile der Hauptverhandlung aufgenommen hat, kein Beweismittel im Sinne der Strafprozessordnung, da es nur als Teil der Notizen des Berichterstatters zur Stützung des Gedächtnisses des Gerichtes dient.
Der Antrag, Blatt 13087 zu verlesen, war ebenfalls abzulehnen.
Bei diesem Blatt handelt es sich um einen mit der Überschrift "Auszug aus zwei Briefen des Zeugen Pro." versehenen Durchschlages irgend eines Originals. Aus dem Durchschlag ergibt sich nicht, wer die Auszüge gemacht hat, ob die Auszüge richtig gemacht worden sind und ob es tatsächlich Auszüge aus Briefen des Zeugen Pro. sind. Blatt 13087 kann daher nicht als Beweisurkunde im Sinne der Strafprozessordnung angesehen werden. Im übrigen wäre die Verlesung dieses Schriftstückes, auch wenn man davon ausginge, dass es schriftliche Erklärungen des Zeugen Pro. in zwei Briefen richtig und zutreffend wiedergibt, nicht zulässig, da diese schriftlichen Erklärungen des Zeugen Pro. in diesem Verfahren zu Beweiszwecken gemacht worden sind. Die Verlesung dieser Erklärungen soll die unmittelbare Vernehmung des Zeugen in der Hauptverhandlung ersetzen. Das ist nach §250 StPO nicht zulässig. Im übrigen kann auf die obigen Ausführungen zu diesem Punkt verwiesen werden.
Der Antrag, die Kostenbände II Seite 360, III Seite 22, IV Seite 38, VI Seite 26, VI Seite 203, VI Seite 205, V Seite 26, VI Seite 188, VI Seite 205 zu verlesen zum Beweise dafür, dass Dr. Sehn in den Zeiten 29.2.1960 - 10.3.1960, vom 18.6.1960 - 29.6.1960, vom 18.11.1960 - 25.11.1960, vom 5.7.1961 - 16.7.1961, vom 26.11.1962 - 7.12.1962, vom 18.11.1963 - 29.11.1963 in Frankfurt gewesen ist, und für diese Besuche ständig steigende Entschädigungen entgegengenommen hat, war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da die behaupteten Tatsachen für die Entscheidung völlig ohne Bedeutung sind. Dr. Sehn ist in der Hauptverhandlung nicht als Zeuge vernommen worden. Es ist in keiner Weise ersichtlich, warum dieser Antrag gestellt worden ist.
VI. Weitere Hilfsbeweisanträge des Verteidigers Dr. Latern. für sämtliche von ihm vertretenen Angeklagten (Dylewski, Broad, Dr. Frank, Dr. Capesius)
1. Der Hilfsantrag (Ziffer I), eine Auskunft des polnischen Justizministeriums darüber einzuholen, dass die Bewilligung der Ausreise für polnische Zeugen in diesem Verfahren auf folgende Weise gehandhabt worden sei:
a. Die Zeugen seien vor ihrer Abreise jeweils mehrere Male in das Justizministerium bestellt (dort durchschnittlich zwei- bis dreimal, bisweilen jedoch vier-, fünf-, sechs-, siebenmal und bis 11 Tage Aufenthalt in Warschau) worden,
b. die Zeugen seien während ihres Aufenthaltes im Justizministerium einer Vorvernehmung unterzogen worden,
c. die polnischen Zeugen hätten über Warschau ausreisen müssen,
d. vor ihrer Ausreise hätten die Zeugen ihren eigenen Pass im Justizministerium abgeben müssen und hätten dort einen Ausreisepass erhalten,
e. die Zeugen hätten sich nach ihrer Rückkunft in Polen wiederum im Justizministerium in Warschau melden müssen; dort hätten sie den Ausreisepass abgeben müssen und hätten ihren alten Pass wieder zurückerhalten,
war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da zu Gunsten der Angeklagten die behaupteten Tatsachen als wahr unterstellt werden können.
Die Tatsache, dass polnische Zeugen mehrfach in das Justizministerium bestellt worden sind und dort über ihre Erlebnisse im KL Auschwitz vernommen worden sind, besagt nicht, dass sie von den vernehmenden Personen in irgendeiner Weise zum Nachteil der Angeklagten beeinflusst oder sogar zu einer falschen Aussage verleitet worden sind. Irgendwelche Anhaltspunkte hierfür liegen nicht vor.
2. Der Antrag (Ziffer II), die Reisekostenabrechnungen sämtlicher polnischer und tschechischer Zeugen zu verlesen zum Beweise dafür,
a. dass jeder polnische Zeuge mindestens zweimal in Warschau gewesen sei,
b. dass die unter Ziffer IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV und XVII des Schriftsatzes des Rechtsanwaltes Latern. vom 29.6.1965 (=Anlage zum Protokoll vom 1.7.1965 = Protokollbd. Nr.18, Seite 1557a ff.) aufgeführten polnischen und tschechoslowakischen Zeugen die unter diesen Ziffern behaupteten Verdienstausfälle und Reisekosten geltend gemacht und auch erhalten hätten,
war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da zu Gunsten der Angeklagten als wahr unterstellt werden kann, dass die aufgeführten Zeugen die in den genannten Ziffern behaupteten Verdienstausfälle und Reisekosten geltend gemacht und auch erhalten haben.
3. Der Antrag (Ziffer III), eine Auskunft des statistischen Bundesamtes in Wiesbaden darüber einzuholen, dass der durchschnittliche Monatsverdienst in Polen etwa 2000.- Zloty beträgt, war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da die behauptete Tatsache zu Gunsten des Angeklagten als wahr unterstellt werden kann.
4. Der Antrag (IX), einen mit den wirtschaftlichen Verhältnissen in Polen vertrauten Wirtschaftssachverständigen darüber zu vernehmen, dass die von der überwiegenden Mehrzahl der polnischen Zeugen in Ansatz gebrachten Sätze für Verdienstausfall um mehr als 100%-300% übersetzt sind, weil Beträge in der geltend gemachten Höhe in Polen nicht gezahlt werden, war ebenfalls gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da die behaupteten Tatsachen als wahr unterstellt werden können. Der Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Latern., geht ersichtlich von einem Umrechnungskurs 6 Zloty = 1.- DM (6:1) aus. Der Verteidiger verkennt jedoch, dass in den Ländern Polen, Tschechoslowakei und Rumänien ein "differenziertes Kurssystem" besteht. Nach der schriftlichen Auskunft der Deutschen Bundesbank vom 19.7.1965, die in der Hauptverhandlung verlesen worden ist, lautet in Polen der offizielle Kurs für Zloty zu D-Mark 1:1, während ein Spezialkurs für bestimmte, nicht kommerzielle Zahlungen im Verhältnis 6:1 besteht. Den Zeugen wurden daher die in der Bundesrepublik erhaltenen DM-Beträge in Polen im Verhältnis 1:1 in Zloty umgetauscht. Die Gerichtskasse hat den Zeugen jedoch die in Zloty geltend gemachten Reisekosten und Verdienstausfälle nur im Verhältnis 6:1 umgerechnet. Hätten die Zeugen ihre tatsächlichen Verdienstausfälle in Zloty angegeben, so hätten sie eine erhebliche Einbusse erlitten. Das zeigt folgendes Beispiel: Bei einem Verdienstausfall von 60 Zloty pro Tag erhielten die Zeugen von der Gerichtskasse bei einem Verhältnis 6:1 nur 10.- DM pro Tag für erlittenen Verdienstausfall. Wenn die Zeugen nach ihrer Rückkehr nach Polen diese 10.- DM wieder in Zloty offiziell umtauschen wollten, erhielten sie bei dem offiziellen Kurs von 1:1 nur 10.- Zloty für 10.- DM, erlitten also eine finanzielle Einbusse von 50.- Zloty.
Wenn die Zeugen im Hinblick auf diese unterschiedlichen Zloty-Kurse ihren Verdienstausfall pro Tag gegenüber der Gerichtskasse höher angaben, als er tatsächlich gewesen ist, so mag das gegenüber der Gerichtskasse nicht korrekt gewesen sein, ist aber vom subjektiven Standpunkt der Zeugen aus gesehen verständlich gewesen, da sie nur auf diese Weise eine finanzielle Einbusse vermeiden konnten. Wenn daher die von den Zeugen für Verdienstausfall in Ansatz gebrachten Sätze den tatsächlichen Verdienstausfall um mehr als 100%-300% überstiegen, was der Verteidiger behauptet und was als wahr unterstellt wird, so kann im Hinblick auf den "differenzierten Kurs" daraus allein nicht auf eine generelle Unzuverlässigkeit und Unglaubwürdigkeit der Zeugen geschlossen werden. Der zu diesem Thema weiter von Rechtsanwalt Dr. Latern. gestellte Hilfsantrag, durch Vernehmung der Rechtsanwälte Dr. Ste. und Dr. Egg. festzustellen, dass keinerlei Schwierigkeiten bestanden hätten, in Polen für eine D-Mark 30 Zloty zu bekommen, war ebenfalls gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da auch diese behauptete Tatsache als wahr unterstellt werden kann. Bei diesem Umtauschverhältnis handelt es sich ersichtlich nicht um einen von den polnischen Behörden genehmigten Kurs. Den Zeugen kann nicht zugemutet werden, dass sie in Polen entgegen den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen (etwa auf dem schwarzen Markt) in einem für sie günstigen Verhältnis umtauschen.
5. Der Antrag (VII.1.), bei den für die Zeugen Kam., Mot., Bode. und Krx. zuständigen Finanzämtern eine Auskunft über deren Einkommen einzuholen zum Beweise dafür, dass diese Zeugen bei weitem nicht das Einkommen gehabt haben, das sie berechtigen würde, den beantragten und erhaltenen Verdienstausfall geltendzumachen, war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da es im Hinblick auf den "differenzierten Zloty-Kurs" aus den dargelegten Gründen für die Entscheidung ohne Bedeutung ist, ob die Zeugen "überhöhte Verdienstausfälle" gegenüber der Gerichtskasse geltendgemacht haben.
6. Der Antrag (IX.2.), einen Wirtschaftssachverständigen darüber zu vernehmen, dass der Umrechnungskurs von einer D-Mark zu 6 Zloty den Zeugen weitere zusätzliche Vorteile eingebracht hat, war gemäss §244 Abs.IV StPO abzulehnen, da das Gericht auf Grund der schriftlichen Auskunft der Deutschen Bundesbank selbst die erforderliche Sachkunde besitzt, um beurteilen zu können, dass der Umrechnungskurs 6:1 im Hinblick auf den offiziellen Zloty-Kurs in Polen (1:1), den Zeugen keine zusätzlichen Vorteile erbracht hat.
7. Der Antrag (XV),
a. eine Auskunft bei den für die Zeugen Be., Fa., Philipp Mü. und Fab. zuständigen Finanzämtern über das von ihnen bezogene Einkommen einzuholen zum Beweise dafür, dass die Zeugen ihren Verdienstausfall mindestens zwei- bis dreimal so hoch angegeben haben, als er ihnen überhaupt entstanden ist,
b. einen mit den wirtschaftlichen Verhältnissen in der Tschechoslowakei vertrauten Wirtschaftssachverständigen darüber zu vernehmen, dass die von den vorgenannten Zeugen in Ansatz gebrachten Sätze für Verdienstausfall mit mehr als 100 bis 200% übersetzt seien, weil Verdienste in der geltend gemachten Höhe in der Tschechoslowakei nicht gezahlt würden,
war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da zu Gunsten der Angeklagten als wahr unterstellt werden kann, dass diese Zeugen ihren Verdienstausfall in tschechoslowakischen Kronen zwei- bis dreimal so hoch angegeben haben, als er ihnen tatsächlich entstanden ist.
Auch aus dieser Tatsache allein können keine Schlüsse auf eine Unzuverlässigkeit oder Unglaubwürdigkeit der Zeugen gezogen werden; denn auch in der Tschechoslowakei gibt es einen "differenzierten Kurs" Krone zu D-Mark. Nach der schriftlichen Auskunft der Deutschen Bundesbank vom 19.7.1965 ist der offizielle Kurs in der Tschechoslowakei 100 Kronen = rund 55.- DM. Der Kurs für bestimmte nichtkommerzielle Transaktionen lautet: 100 Kronen = rd. 28.- DM.
Von der Gerichtskasse ist den tschechoslowakischen Zeugen für eine Krone = 0.28 DM gezahlt worden. Wenn diese Zeugen ihren tatsächlichen Verdienstausfall in Kronen richtig angegeben hätten, hätten sie beim Umtausch der erhaltenen DM-Beträge in der Tschechoslowakei zu dem offiziellen Kurs 1 Krone = 0.55 DM (1 D-Mark = 1.80 Kronen) ebenfalls eine finanzielle Einbusse erlitten. Wenn sie daher zur Vermeidung dieser Einbusse ihren tatsächlichen Verdienstausfall höher angegeben haben, als er tatsächlich entstanden ist, so ist das von ihrem subjektiven Standpunkt aus verständlich und kann nicht dazu führen, die Zeugen bezüglich der von ihnen geschilderten Erlebnisse und Beobachtungen im KL Auschwitz als generell unglaubwürdig anzusehen.
8. Der Antrag (XVI), den Ingenieur Paskewitz darüber zu vernehmen, dass sämtliche rumänische Zeugen, die vor dem Schwurgericht in Frankfurt erschienen sind, zuvor vom rumänischen Sicherheitsdienst vernommen worden seien, war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da die in das Wissen des Zeugen gestellten Tatsachen für die Entscheidung ohne Bedeutung sind.
9. Der Antrag (XVIII),
a. eine Auskunft bei den für die Zeugen Böh. und Sa. zuständigen Finanzämtern über deren Einkommen einzuholen zum Beweise dafür, dass die geltend gemachten Beträge für Verdienstausfall bei weitem übersetzt seien,
b. einen mit den Verhältnissen in Rumänien betrauten wirtschaftlichen Sachverständigen darüber zu hören, dass die Einkommen in Rumänien weit unter denjenigen lägen, die die Zeugen Böh. und Sa. als Verdienstausfall geltend gemacht hätten,
war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da die behaupteten Tatsachen zu Gunsten der Angeklagten als wahr unterstellt werden können.
Auch in Rumänien besteht ein "differenziertes Kurs-System"; der offizielle Kurs Leu im Verhältnis zur D-Mark lautet nach der Auskunft der Deutschen Bundesbank vom 29.7.1965: 100 Leu (1) = 66.67 DM. Der Kurs für bestimmte nichtkommerzielle Zahlungen ist: 100 Leu = 33.33 DM.
Zwar hat die Gerichtskasse den rumänischen Zeugen den in Leu geltend gemachten Verdienstausfall nach dem offiziellen Kurs, nämlich 1 Leu = 67 DPf. berechnet. Die rumänischen Zeugen konnten daher bei einem Umtausch der erhaltenen DM-Beträge in Rumänien keine finanzielle Einbusse erleiden. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Zeugen nicht wissen konnten, dass von der Gerichtskasse ein so günstiges Umtauschverhältnis berechnet würde. Sie mussten vielmehr annehmen, dass der Umtausch zu dem Kurs 100 Leu = 33.33 DM erfolgen würde. Wenn sie daher von vornherein ihren Verdienstausfall höher angegeben haben, als sie ihn tatsächlich erlitten haben, so ist das ebenfalls verständlich. Aus dieser Tatsache allein können daher ihre Angaben über ihre Erlebnisse im KL Auschwitz nicht schon als unglaubhaft angesehen werden.
10. Der Antrag (XIX),
a. eine Auskunft des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung einzuholen zum Beweise dafür, dass das durchschnittliche Monatseinkommen des männlichen Arbeiters im deutschen Baugewerbe 841.- DM monatlich beträgt,
b. eine Auskunft der Bundesstelle für Aussenhandelsinformationen in Köln einzuholen zum Beweise dafür, dass
aa. die monatlichen Bruttolöhne in der kollektivierten Bauwirtschaft in Polen etwa umgerechnet 355.- DM betragen,
bb. die monatlichen Bruttolöhne in der kollektivierten Bauwirtschaft der Tschechoslowakei etwa 375.- DM betragen,
cc. der Monatslohn aller Industriearbeiter und Angestellten in Rumänien monatlich zwischen 178.- und 378.- DM beträgt,
war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da die behaupteten Tatsachen für die Entscheidung ohne Bedeutung sind.
11. Der Antrag, durch Anfrage bei den hierfür zuständigen Stellen festzustellen, wieviel jüdische Häftlinge die Lagerzeit im KL Auschwitz überlebt haben, war abzulehnen, da es sich bei diesem Antrag nicht um einen Beweisantrag, sondern um einen Beweisermittlungsantrag handelt. Das Gericht hat keine Veranlassung, von Amts wegen Ermittlungen darüber anzustellen, wieviel jüdische ehemalige Häftlinge aus dem KL Auschwitz das Lager überlebt haben. Dass frühere jüdische Gefangene die Lagerzeit überlebt haben, steht mit Sicherheit fest. Denn das Gericht hat eine Reihe jüdischer Zeugen vernommen, die früher im KL Auschwitz gefangengehalten worden sind. Für die Entscheidung ist es jedoch ohne Bedeutung, wieviel ehemalige jüdische Gefangene das Lager Auschwitz überlebt haben.
VII. Strafzumessung
Der Angeklagte Dr. Capesius gehörte als Apotheker ebenfalls dem ärztlichen Dienst im weiteren Sinne an. Auch er unterstand dem Standortarzt und dem Amt D III im WVHA. Sein Beruf verpflichtete ihn ebenfalls, menschliches Leben zu erhalten und kranken Menschen zu helfen. Er stammte aus einer Arztfamilie, so dass er schon früh mit den Aufgaben und Pflichten eines Arztes und dem von den Ärzten zu fordernden Berufsethos vertraut war. Gleichwohl liess er sich zur Mithilfe bei den Vernichtungsaktionen missbrauchen. Er übte dabei die den Ärzten vorbehaltenen Funktionen, die - wie bereits bei dem Angeklagten Dr. Frank ausgeführt - in diametralem Gegensatz zu den eigentlichen ärztlichen Aufgaben standen, aus. Für den Unrechtsgehalt seiner Beihilfehandlungen gilt daher zunächst das gleiche, was hierzu bereits beim Angeklagten Dr. L. unter VI. ausgeführt worden ist.
Die Tatbeiträge des Angeklagten Dr. Capesius wiegen jedoch erheblich schwerer als die der Angeklagten Dr. L. und Dr. Frank. Denn die jüdischen Menschen, die ihm auf der Rampe begegneten, stammten aus seiner Heimat und waren zum Teil persönlich mit ihm bekannt. Er selektierte nicht nur eine anonyme Masse, sondern schickte seine ihm zum Teil persönlich bekannten Landsleute ins Gas. Er scheute sich nicht, Bekannte aus seiner Heimat, die sich vertrauensvoll an ihn wandten, in zynischer Weise zu täuschen. So spiegelte er dem Zeugen Dr. Bern. vor, er werde in einer Stunde wieder mit seiner Frau und seinen Kindern zusammen sein, obwohl er genau wusste, dass Dr. Bern. bereits in wenigen Stunden von dem wirklichen Schicksal seiner Familie erfahren musste. Besonders gravierend ist, dass er die Frau des Zeugen Dr. Schli., den er von früher her kannte, und der sich vertrauensvoll an ihn wandte, in die Gaskammer schickte, nachdem er dem Zeugen vorgespiegelt hatte, "es werde alles gut". Von Zynismus und Gefühlskälte zeugt auch sein Verhalten gegenüber dem Vater der Zeugin Krau. Die oben zitierte Äusserung, mit der er den Dr. Krau., den er als Arzt ohne weiteres in das Lager hätte aufnehmen können, in das Gas geschickt hat, offenbart nicht nur erhebliche charakterliche Mängel des Angeklagten, sondern lässt auf eine verwerfliche Gesinnung schliessen. Seine Schuld wiegt daher erheblich schwerer als die des Angeklagten Dr. Frank. Strafschärfend fiel bei dem Angeklagten Dr. Capesius ferner noch ins Gewicht, dass er sich nicht gescheut hat, sich in schamloser Weise an der Habe der Opfer zu bereichern. Auch das zeugt von erheblichen charakterlichen Mängeln.
Andererseits hat das Schwurgericht zu seinen Gunsten strafmildernd berücksichtigt, dass er als Auslandsdeutscher gegen seinen Willen zur Waffen-SS eingezogen und schliesslich in das KL Auschwitz versetzt worden ist. Er ist gegen seinen Willen in das furchtbare Geschehen verstrickt worden. In der Atmosphäre des KL Auschwitz fehlte ihm die erforderliche charakterliche Stärke, um sich den Verbrechen zu entziehen. Wenn er sich schliesslich bedenkenlos zu der Mitwirkung bei den Vernichtungsaktionen missbrauchen liess, so mag hierzu vor allem auch das negative Beispiel der deutschen Ärzte und SS-Führer beigetragen haben.
Unter Abwägung der angeführten Gesichtspunkte hielt das Schwurgericht für jeden Fall der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord (mindestens 4 Fälle) Zuchthausstrafen von je 6 Jahren für Schuld und Tat angemessen.
Aus den Einzelstrafen war gemäss §74 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden. Für sie gelten die gleichen Strafzumessungserwägungen wie für die Einzelstrafen. Im Hinblick auf die grosse Zahl der Opfer (mindestens 8000), die unter der Mitwirkung des Angeklagten Dr. Capesius zu Tode gebracht wurden, erschien eine Gesamtstrafe von 9 Jahren Zuchthaus als eine angemessene Sühne.
O. Die Straftaten des Angeklagten Klehr
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Klehr
Der Angeklagte Klehr ist am 17.10.1904 in Langenau/Krs.Leobschütz (Oberschlesien) geboren. Sein Vater war als Erzieher in der Erziehungsanstalt in Wehlau/Oberschlesien tätig. Dort besuchte der Angeklagte Klehr die katholische Volksschule. Nach der Schulentlassung im Jahre 1918 erlernte er das Tischlerhandwerk. Er schloss die Lehre im Jahre 1921 mit der Gesellenprüfung ab. Anschliessend arbeitete er bei mehreren Tischlern als Geselle. Im Jahre 1932 trat er in die NSDAP und die allgemeine SS ein. Als Grund hierfür gibt der Angeklagte die damalige allgemeine wirtschaftliche Notlage an. Er sei - so behauptet er - längere Zeit arbeitslos gewesen. Sein Antrag auf Zahlung einer Unterstützung sei abgelehnt worden. Daher sei er in die Partei und SS eingetreten.
Im Jahre 1934 bewarb sich der Angeklagte als Erzieher bei der Erziehungsanstalt in Wehlau/Oberschlesien. Da eine Stelle als Erzieher nicht frei war, machte er an der Pforte Nachtdienst. Ende 1934 wurde er von der Heil- und Pflegeanstalt in Leubus/Oberschlesien als Pfleger eingestellt. Er war dort bis Mitte 1938 tätig. Dann wurde ihm gekündigt. Er fand nun eine Stelle als Hilfswachtmeister im Zuchthaus Wehlau.
Vor dem Krieg nahm der Angeklagte an zwei Übungen der Wehrmacht teil. Dabei wurde er als Sanitäter ausgebildet. Ende August 1939 wurde er zur Waffen-SS - Oberabschnitt Liegnitz - eingezogen. Er kam zur Wachmannschaft des KZ Buchenwald. Angeblich hat ihm der Wachdienst jedoch nicht zugesagt. Deshalb will er an das Zuchthaus in Wehlau geschrieben haben, man solle ihn bei der SS als uk anfordern. Als dieser Wunsch nicht erfüllt worden sei, habe er sich - so gibt der Angeklagte weiter an - erfolglos an die Front gemeldet.
Im Jahre 1940 wurde der Angeklagte als Sanitätsdienstgrad zum KZ Dachau versetzt. Dort arbeitete er im SS-Revier und im Häftlingskrankenbau. Er wurde alsbald zum SS-Rottenführer und am 30.1.1941 zum SS-Unterscharführer befördert. Er will sich noch einmal zur Front gemeldet haben. Deswegen habe er sogar - so gibt er an - einen Verweis erhalten.
Im Oktober 1941 wurde der Angeklagte zum KZ Auschwitz versetzt. Hier wurde er im HKB als Sanitätsdienstgrad sowie zur Seuchenbekämpfung eingesetzt. Am 1.2.1943 wurde er zum SS-Oberscharführer befördert. Am 20.4.1943 erhielt er das KVK II. Klasse.
Er wurde dann noch im Nebenlager Gleiwitz eingesetzt, wo er bis zur Evakuierung des Lagers im Jahre 1945 blieb. Nach der Räumung des Lagers begleitete er einen Häftlingstransport nach Gross-Rosen. Auf dem Marsch will er jedoch nur Sanitätsdienste gemacht haben.
Von Gross-Rosen aus kam der Angeklagte mit einer in Gross-Rosen zusammengestellten SS-Einheit noch zum Fronteinsatz in der Tschechoslowakei. Er geriet am 2.5.1945 in Österreich in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Über verschiedene Kriegsgefangenenlager kam er schliesslich in das Kriegsgefangenenlager Böblingen. Hier wurde er von der Lagerspruchkammer wegen seiner Zugehörigkeit zur allgemeinen und zur Waffen-SS zu 3 1/2 Jahren Arbeitslager verurteilt. In der Berufungsinstanz wurde die Strafe auf 3 Jahre ermässigt. Der Angeklagte wurde im Jahre 1948 nach Braunschweig entlassen, wo sich inzwischen seine Familie niedergelassen hatte. In den folgenden Jahren arbeitete er wieder als Tischler. Zuletzt war er bei der Firma Büssing tätig. Der nicht vorbestrafte Angeklagte hat im Jahre 1933 geheiratet. Aus seiner Ehe sind zwei Söhne hervorgegangen. Er befindet sich in dieser Sache seit dem 17.9.1960 in Untersuchungshaft.
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Mitwirkung des Angeklagten Klehr bei Selektionen durch den Lagerarzt im HKB und die Tötung der durch den Lagerarzt ausgesonderten Häftlinge durch den Angeklagten Klehr (Eröffnungsbeschluss Ziffer 2)
Der Angeklagte Klehr wurde im Oktober 1941 sofort nach seiner Ankunft im KL Auschwitz als Sanitätsdienstgrad (SDG) im HKB des Stammlagers eingesetzt. SS-Lagerarzt im Stammlager war zu dieser Zeit Dr. Entress. Ihm unterstand der Angeklagte Klehr unmittelbar. Ausser dem Angeklagten Klehr waren im Herbst 1941 noch die SS-Unterscharführer Ulzenhöfer und Sicklinger als SDGs tätig. Beide wurden jedoch bald versetzt. Der Angeklagte Klehr war dann ab Anfang 1942 längere Zeit der einzige SDG im HKB des Stammlagers. Später kamen nacheinander weitere SDGs in den HKB, so die Angeklagten Scherpe und Hantl und der SS-Unterscharführer Nierwicki. Klehr hatte, wenn neben ihm noch andere SDGs im HKB eingesetzt waren, den Rang eines ersten SDG. Seine offizielle Aufgabe als SDG war es, dafür zu sorgen, dass die Anordnungen des SS-Lagerarztes im HKB beachtet und seine Anweisungen durchgeführt wurden. Ferner sollte er auf Ordnung und Sauberkeit im HKB achten. Für alles, was im HKB geschah, war er dem SS-Lagerarzt gegenüber verantwortlich. Schliesslich musste er den SS-Lagerarzt bei "Visiten", Kontrollen und Selektionen begleiten und ihm dabei helfen.
Als der Angeklagte Klehr SDG im HKB war, fanden - wie schon im zweiten Abschnitt unter VII.4 kurz ausgeführt - fast täglich Selektionen durch den Lagerarzt bei den sog. "Arztvorstellern" oder "Arztvormeldern" statt. Häftlinge, die sich krank fühlten, mussten sich entweder beim Abendappell oder beim Morgenappell beim Blockältesten krank melden. Dieser führte die Kranken zu dem Rapportführer, der sie nach dem Appell von Häftlingspflegern auf den Block 28 bringen liess. Dort wurden die Krankmelder von einem Häftlingsarzt untersucht. Der Häftlingsarzt teilte sie in zwei Gruppen ein: Die eine Gruppe durfte zunächst im HKB bleiben und sollte dem Lagerarzt vorgestellt werden. Bei der anderen Gruppe reichte nach der Auffassung des Häftlingsarztes eine ambulante Behandlung aus. Die Häftlinge dieser Gruppe wurden nach Verabreichung von Medikamenten, sofern welche vorhanden waren, oder nach einer sonstigen Behandlung (z.B. Anlegen von Verbänden) wieder auf ihre Blöcke zurückgeschickt.
Die Häftlinge, die sich abends krank meldeten und nach der Untersuchung durch den Häftlingsarzt im HKB bleiben durften, verbrachten die Nacht in der Stube Nr.7 des Blocks 28. Die Häftlinge, die sich morgens krank meldeten, kamen nach der Untersuchung durch den Häftlingsarzt ebenfalls auf diese Stube, sofern der Häftlingsarzt ihre Aufnahme in den HKB für erforderlich hielt. Für jeden Neukranken legte ein Häftlingspfleger eine Karteikarte an, in die der Häftlingsarzt seine Diagnose eintrug.
Im Laufe des Vormittags zwischen 8 und 9 Uhr, erschien der SS-Lagerarzt im Lager. Er begab sich zunächst in das Arztzimmer im Block 21, wo der Angeklagte Klehr auf ihn wartete. Nach der Erledigung von Korrespondenz begab sich der Lagerarzt dann zusammen mit dem Angeklagten Klehr zum Ambulanzzimmer im Block 28. Dort liess er sich die im gegenüberliegenden Zimmer 7 wartenden Neukranken vorstellen. Der Häftlingsarzt gab bei jedem einzelnen Neukranken seine Diagnose an, die er meist seiner Eintragung auf den für die Häftlinge angelegten Karteikarten entnahm. Der SS-Lagerarzt sah sich die Kranken nur flüchtig an. Durch einen Blick auf die Karteikarten, die ihm der Häftlingsarzt oder der Häftlingspfleger überreichte, stellte er fest, ob der Neukranke Jude war oder nicht. Dann entschied er sofort, was mit dem Häftling weiter geschehen solle. Seine Entscheidung lautete entweder auf Aufnahme des Häftlings in den HKB oder auf Rückverschickung des Häftlings in das Lager (eventl. nach ambulanter Behandlung) oder auf "Sonderbehandlung" d.h. auf Tötung des Neukranken durch Phenol. Nur jüdische Häftlinge wurden vom Lagerarzt zur Sonderbehandlung bestimmt und zwar vor allem solche, die schwach aussahen (Muselmänner) oder eine Krankheit hatten, die eine baldige Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit des Häftlings nach Auffassung des Lagerarztes nicht erwarten liess. Der Grund für die Tötung der schwachen und kranken jüdischen Häftlinge war, dass man sie als unnütze Esser loswerden wollte, da sie, weil man sie für den Arbeitseinsatz nicht mehr verwenden konnte, nicht mehr nützlich erschienen.
Die Entscheidung, dass bestimmte jüdische Neukranke durch Phenol zu töten seien, brachte der Lagerarzt dadurch zum Ausdruck, dass er stillschweigend die Karteikarten der betreffenden Häftlinge dem SDG Klehr übergab. Dieser wusste ebenso wie der Häftlingsarzt und der Häftlingspfleger, was das zu bedeuten hatte. Die Karteikarten der anderen Häftlinge erhielt der Häftlingsarzt zurück. Der Angeklagte Klehr achtete stets darauf, dass keiner der für die Tötung bestimmten Häftlinge, deren Karteikarten er in der Hand hielt, anschliessend von einem Funktionshäftling gerettet würde. Manchmal legte der Lagerarzt Dr. Entress die Karteikarten der vorgestellten Neukranken nach ihrer "Untersuchung" auf verschiedene Häufchen. Jeder Eingeweihte, auch der Angeklagte Klehr, wusste, welches Häufchen die Karteikarten der für die Sonderbehandlung bestimmten Häftlinge enthielt.
Nach Abschluss der "Untersuchungen" der Neukranken durch den Lagerarzt, bei denen stets eine grössere Anzahl von jüdischen Häftlingen für die Sonderbehandlung bestimmt wurde, brachte der Angeklagte Klehr die Karteikarten der für die Tötung ausgewählten Häftlinge zur Häftlingsschreibstube des Häftlingskrankenbaus auf Block 21. Dort gab er den Häftlingsschreibern den Befehl, die auf den Karteikarten aufgeführten Häftlinge "vom HKB abzusetzen". Die Schreiber wussten dann, dass sie für diese Häftlinge die Todespapiere auszufertigen und die Todesbescheinigungen für das Standesamt auszuschreiben hatten. Als Todesursache mussten sie beliebige Krankheiten einsetzen, die sie nach freiem Ermessen einer Liste mit einer Anzahl möglicher Krankheiten entnahmen (z.B. Lungenentzündung, Herzschwäche).
Die für die Tötung durch Phenol ausgewählten Häftlinge mussten in der Zwischenzeit auf einem Zimmer im Block 28 warten. Gegen Mittag wurden sie von einem Funktionshäftling vom Block 28 über den Hof zwischen Block 20 und 21 durch den Mitteleingang in den Block 20 geführt. Dort sass auf dem Korridor ein Häftlingsschreiber, dem die Liste der Opfer übergeben wurde. Der Schreiber kontrollierte, ob alle auf der Liste aufgeführten Häftlinge anwesend waren. Die Häftlinge mussten dann entweder in einem im Parterre befindlichen grossen Waschraum oder auf dem Korridor warten. Viele ahnten von ihrem bevorstehenden Tode nichts. Sie glaubten, sie sollten behandelt werden. Andere rechneten damit, dass sie getötet werden sollten. Denn im Lager war es trotz strengster Geheimhaltung durchgesickert, dass durch den Angeklagten Klehr Häftlinge durch Phenolinjektionen im Block 20 getötet würden. Daher meldeten sich viele jüdische Häftlinge nur im äussersten Notfall krank, weil sie befürchteten, getötet zu werden. Die Häftlinge, die mit ihrer Tötung rechneten, waren jedoch infolge Hunger und Krankheit bereits so apathisch, dass sie sich ohne Widerstand in ihr Schicksal ergaben.
Dann kam der Angeklagte Klehr von der Lagerstrasse her durch den Haupteingang auf den Block 20. Er begab sich auf das Zimmer Nr.1 des Blockes 20, das - vom Haupteingang aus gesehen - unmittelbar links neben dem Haupteingang lag. Von den wartenden Häftlingen konnte er nicht gesehen werden, da der Korridor hinter der Tür des Zimmers Nr.1 - vom Haupteingang aus gesehen - durch einen Vorhang abgeteilt war, so dass der vordere Teil des Korridors - vom Haupteingang aus gesehen - von den wartenden Häftlingen nicht eingesehen werden konnte. Im Zimmer Nr.1 fanden sich auch zwei Funktionshäftlinge ein, die dem Angeklagten Klehr bei den Tötungsaktionen assistieren mussten. In das Zimmer Nr.1 wurden dann nacheinander die im Waschraum oder auf dem Korridor wartenden Häftlinge einzeln oder zu zweit hineingeführt. Dort mussten sie sich auf einen Schemel setzen. Der eine der beiden Funktionshäftlinge hob dem Kranken den Arm und zwar so, dass er damit dessen Augen verdeckte, während der andere Funktionshäftling den Kranken im Rücken hielt. Der Angeklagte Klehr füllte eine Rekordspritze mit Phenol und stach dem sitzenden Häftling die Nadel der Spritze unmittelbar in das Herz. Danach spritzte er sofort den Inhalt der Spritze in das Herz des Häftlings. Der kranke Häftling fiel sogleich um. Er starb meist unmittelbar nach der Injektion. Manche Opfer lebten auch noch einige Sekunden oder Minuten. Die Opfer wurden dann von den assistierenden Funktionshäftlingen in den dem Zimmer Nr.1 gegenüberliegenden zweiten Waschraum gebracht, wo die Leichen der Opfer aufgestapelt und später von Leichenträgern weggebracht wurden. Häufig waren die Leichenträger auch schon während der Tötungsaktionen im Waschraum. Sie nahmen dann die Leichen der Opfer von den Funktionshäftlingen an der Tür des Zimmers Nr.1 entgegen und brachten sie zunächst in den Waschraum, wo sie bis zur Beendigung der Aktion liegen blieben.
Der Angeklagte Klehr hat in der Zeit von Frühjahr 1942 bis Frühjahr 1943 dem SS-Lagerarzt Dr. Entress in einer unbestimmten Anzahl von Fällen auf die geschilderte Weise bei der "Untersuchung" der sog. "Arztvorsteller" assistiert und anschliessend die vom Lagerarzt Dr. Entress zur Tötung ausgewählten Häftlinge eigenhändig durch Phenolinjektionen getötet.
Der Angeklagte Klehr hat den SS-Lagerarzt auch bei "Visiten" durch die Krankensäle des HKB (vgl. oben 2. Abschnitt VII.4.b.) begleitet. Bei diesen "Visiten" wurden jüdische Häftlinge, die krank und schwach waren, ebenfalls nur deswegen zur Tötung ausgewählt, weil sie nicht mehr nützlich erschienen. Der Lagerarzt rechnete bei ihnen nicht mehr mit einer baldigen Wiederherstellung der Arbeitskraft. Sie galten nur als unnütze Belastung für das Lager. Ihre Beseitigung erschien daher zweckmässig.
Der Angeklagte Klehr achtete bei den Selektionen im HKB darauf, dass keiner der vom SS-Lagerarzt ausgesonderten Häftlinge von Funktionshäftlingen gerettet werden konnte oder dass er sich auf andere Weise seinem Schicksal entzog. Er sorgte dafür, dass alle für den Tod bestimmten Häftlingen auf den Block 20 gebracht wurden. Da er die Karteikarten der ausgewählten Häftlinge erhielt, konnte er jederzeit überprüfen, dass auch alle selektierten Häftlinge zu Block 20 kamen. Ausserdem wurde anhand der Karteikarten eine Liste aufgestellt, die die Namen und Nummern aller selektierten Häftlinge enthielt.
Der Angeklagte Klehr tötete dann auf Block 20 die im HKB ausgewählten jüdischen Häftlinge auf die gleiche Weise wie die sog. "Arztvorsteller".
Die Anzahl der durch den Angeklagten Klehr nach solchen Selektionen im HKB getöteten Häftlinge ist ebenfalls unbestimmt.
Insgesamt hat der Angeklagte Klehr in der Zeit vom Frühjahr 1942 bis Juli 1942 mindestens 250 Häftlinge, die teils bei den sog. Arztvorstellern, teils im HKB bei kleinen Selektionen vom SS-Lagerarzt für die Tötung ausgewählt worden sind, durch Phenolinjektionen getötet.
In der Zeit vom 1.8.1942 bis Frühjahr 1943 hat der Angeklagte Klehr mindestens weitere sechs Häftlinge, die vom SS-Lagerarzt entweder bei den Arztvorstellern oder im HKB zur Tötung ausgesucht worden waren, eigenhändig durch Phenolinjektionen umgebracht.
Der Angeklagte Klehr wusste, dass die jüdischen Häftlinge nur deswegen getötet wurden, weil sie wegen ihrer Krankheit und körperlichen Schwäche nicht mehr als Arbeitskräfte eingesetzt werden konnten und daher nicht mehr nützlich erschienen. Er hat ihre Beseitigung für richtig gehalten und innerlich bejaht. Ihm bereitete es darüber hinaus unnatürliche Freude, die Häftlinge durch Phenolinjektionen töten zu können. Er war stolz darauf, dass er eine gewisse Fertigkeit im Geben der Phenolinjektionen erlangt hatte. Damit brüstete er sich gelegentlich gegenüber den Häftlingsärzten.
2. Eigenmächtige Selektionen und eigenmächtige Tötungen von Häftlingen durch den Angeklagten Klehr (Eröffnungsbeschluss Ziffer 2, Satz 2, zweite Hälfte)
Der Angeklagte Klehr hat sich nicht darauf beschränkt, nur dem SS-Lagerarzt bei den Selektionen zu assistieren und nur die vom SS-Lagerarzt zur Tötung ausgewählten Häftlinge durch Phenolinjektionen zu töten. Er hat auch eigenmächtig Häftlinge für den Tod ausgesucht und sie anschliessend eigenmächtig durch Phenolinjektionen getötet.
a. Wiederholt kam es vor, dass der SS-Lagerarzt Dr. Entress aus irgendwelchen nicht näher zu erforschenden Gründen morgens nicht zur "Untersuchung" der sog. Arztvorsteller erschien. Er rief dann auf der Häftlingsschreibstube in Block 21, wo das Telefon stand, an und teilte dem damaligen Häftlingsschreiber, dem Zeugen Dr. P. mit, dass er nicht kommen könne. Dr. P. ging dann zu dem Angeklagten Klehr hin und meldete ihm, dass der Lagerarzt nicht zur Untersuchung der Arztvormelder kommen könnte. Klehr erklärte dann, er sei heute Lagerarzt, er mache heute die Arztvormelder. Er zog sich einen weissen Arztkittel an und begab sich in das Ambulanzzimmer des Blockes 28. Dort liess er sich von dem Häftlingsarzt und den Häftlingspflegern die Arztvormelder vorführen. Nach kurzer Musterung der Kranken bestimmte er dann genau wie der SS-Lagerarzt darüber, wer von den Neukranken in den HKB aufgenommen, wer in das Lager zurückgeschickt und wer durch Phenol getötet werden sollte. In mindestens zwei Fällen hat er solche eigenmächtigen Selektionen durchgeführt. In jedem der beiden Fälle hat er eine unbestimmte Anzahl von kranken und schwachen Häftlingen, jedoch mindestens je zwei Menschen für den Tod bestimmt und anschliessend eigenhändig durch Phenolinjektionen auf Block 20 in Zimmer Nr.1 getötet.
b. Der Angeklagte Klehr liebte es, nach der "Untersuchung" der Arztvorsteller durch den Lagerarzt weitere Häftlinge in den Krankensälen des HKB eigenmächtig für die Tötung durch Phenol auszusuchen, nachdem der SS-Lagerarzt den Block 28 und das Lager wieder verlassen hatte. Er ging durch den Block 20 oder die anderen Krankenblocks und wählte willkürlich jüdische Häftlinge, die ihm schwach erschienen, aus und brachte sie zu den im Block 28 wartenden Opfer oder sofort auf den Korridor des Blocks 20, wenn dort bereits die Opfer warteten. Die von ihm ausgewählten Häftlinge wurden dann von ihm durch Phenolinjektionen getötet. In den meisten Fällen wollte der Angeklagte Klehr durch die eigenmächtige Auswahl von Opfern die Zahl der durch den Lagerarzt für die Tötung ausgewählte Häftlinge nach oben "aufrunden" (z.B. von 19 auf 20, von 27 auf 30 oder 38 auf 40). Wie viele Häftlinge er auf diese Weise eigenmächtig für den Tod bestimmt und getötet hat, konnte nicht mehr festgestellt werden. Es war eine unbestimmte Anzahl. Mit Sicherheit hat er mindestens drei kranke Häftlinge im HKB zusätzlich für die Tötung bestimmt, um die Zahl der vom SS-Arzt selektierten Häftlinge nach oben aufzurunden, und hat sie anschliessend eigenmächtig durch Phenolinjektionen im Zimmer Nr.1 des Blockes 20 getötet.
c. Ausser den unter a. und b. geschilderten eigenmächtigen Selektionen ging der Angeklagte Klehr auch sonst häufig durch die Blocks des HKB und suchte kranke jüdische Häftlinge, die er für so krank hielt, dass sie nicht mehr arbeitsfähige zu werden versprachen oder ihm aus einem sonstigen Grunde missliebig waren, aus und bestimmte eigenmächtig, dass sie auf Block 20 zu führen seien. War er nicht sicher, ob ein Häftling Jude sei, fragte er ihn zunächst: "Bist Du Jude?" Bekam er eine bejahende Antwort, dann liess er ihn auf Block 20 bringen. Die ausgesuchten Häftlinge tötete er dann im Zimmer Nr.1 des Blockes 20 durch Phenolinjektionen in das Herz. Die Zahl der auf diese Weise getöteten Menschen ist ebenfalls unbestimmt. Mit Sicherheit hat der Angeklagte Klehr auf diese Weise mindestens an zwei verschiedenen Tagen mindestens je 2 Häftlinge ausgesucht und anschliessend durch Phenolinjektionen getötet. In einem dieser beiden Fälle führte der Angeklagte Klehr die Selektion auf einem Zimmer im ersten Stock des Blockes 21 durch. Er setzte sich in diesem Zimmer auf einen Tisch und liess sich sämtliche Kranken des Blockes 20 (dem benachbarten Block) mit ihren Fieberkurven vorführen. Dabei rauchte er seine Pfeife. Die Häftlinge, die ihm vorgeführt wurden, musterte er wortlos. Mit der Spitze der Pfeife zeigte er auf die Kranken, die anschliessend getötet werden sollten. Die Karteikarten und Fieberkurven dieser Häftlinge liess er auf die Seite legen, während die Karteikarten der anderen Häftlinge, die im HKB verbleiben durften, auf die andere Seite gelegt wurden. Die für den Tod ausgesonderten Häftlinge wurden anschliessend zu Block 20 geführt, wo sie im Zimmer Nr.1 durch Phenol getötet wurden.
d. Am Heiligen Abend des Jahres 1942 kam der SS-Lagerarzt ebenfalls nicht - wie ursprünglich vorgesehen - zur "Untersuchung" der sog. Arztvorsteller. Die Häftlingsärzte und Häftlingspfleger warteten eine Zeitlang vergeblich auf ihn. Dann rief der Zeuge Dr. P. telefonisch im SS-Revier an und fragte, ob der SS-Lagerarzt noch zur Visite käme. Er erhielt die Auskunft, dass der Lagerarzt Dr. Entress bereits in Urlaub gefahren sei und daher nicht mehr kommen könne. Als die Funktionshäftlinge im HKB dies von dem Zeugen Dr. P. erfuhren, atmeten sie auf und hofften, ein ruhiges Weihnachtsfest feiern zu können. Jeder glaubte, dass nun kein Kranker mehr vor oder am Weihnachtsfest getötet würde. Der Zeuge P. meldete dem Angeklagten Klehr, dass der Lagerarzt bereits in Urlaub gefahren sei und nicht mehr zur Visite käme. Der Angeklagte Klehr erklärte daraufhin, dass er die Arztvormelder übernehme. Er begab sich zu Block 28 und liess sich dort im Ambulanzzimmer die Neukranken vorführen, die sich am Abend zuvor oder am Morgen des Heiligen Abend krank gemeldet hatten. Dabei suchte er mindestens 30 Häftlinge für die Tötung mit Phenol aus, indem er ihre Karteikarten in der Hand behielt. Alle, deren Karteikarten er in der Hand behalten hatte, liess er anschliessend durch den Mitteleingang in den Block 20 führen, wo die Häftlinge im Korridor hinter dem bereits erwähnten Vorhang auf ihn warten mussten. Anschliessend ging der Angeklagte Klehr noch durch die Krankenblöcke Nr.19, 20 und 21 und suchte dort aus den in den Krankenbetten liegenden Häftlingen mindestens weitere 170 Häftlinge aus, die er ebenfalls auf den Flur und in den grossen Waschraum im Block 20 führen liess. Dann begab er sich durch den Haupteingang in das Zimmer Nr.1 im Block 20 und liess sich nacheinander die im Flur und Waschraum wartenden 200 Häftlinge in das Zimmer bringen, wo er sie durch Phenolinjektionen tötete.
3. Eigenmächtige Selektionen durch den Angeklagten Klehr im HKB, durch die kranke Häftlinge zur Tötung mit Zyklon B ausgesucht wurden (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1, zweiter Halbsatz)
a. Im Frühjahr 1943 sonderte der Angeklagte Klehr im Block 20 eigenmächtig kranke Häftlinge zur Vergasung aus. Er sass im Flur des Blockes 20 an einem Tisch und sah sich dabei die Karteikarten der im Block 20 befindlichen kranken Häftlinge an. Anhand der Karteikarten entschied er, wer von den kranken Häftlingen zur Tötung durch Zyklon B nach Birkenau gebracht werden sollte, indem er ihre Karteikarten herausnahm und auf ein besonderes Häufchen legte. Die Anzahl der auf diese Weise ausgesuchten Häftlinge ist unbestimmt. Es waren jedoch mindestens 2.
Bei dieser Auswahl anhand der Karteikarten gingen zufällig einige Häftlinge durch den Flur am Angeklagten Klehr vorbei. Klehr sah sich die Häftlinge an und sonderte diejenigen, die ihm durch schlechtes Aussehen auffielen, ebenfalls für die Tötung durch Zyklon B aus. Mit den anderen anhand der Karteikarten ausgewählten Häftlingen liess er sie später nach Birkenau bringen. Die Anzahl der auf diese Weise ausgewählten Häftlinge ist ebenfalls unbestimmt, es waren jedoch mindestens 2 weitere Häftlinge. Alle Häftlinge, die er anhand der Karteikarten und aus den an ihm vorbeigehenden Häftlingen herausgesucht hatte, wurden später zu einer der Gaskammern in Birkenau gebracht und dort durch Zyklon B getötet.
b. Ende April / Anfang Mai 1943 führte der Angeklagte Klehr im Saal Nr.8 im Block 20 eine eigenmächtige Selektion durch. In dieser Zeit wurde eines Tages in Saal Nr.8 des Blockes 20 bekannt gegeben, dass die Häftlinge sich bereit halten sollten, da der SS-Lagerarzt zur Visite käme. Jedem Kranken wurde daraufhin seine Karteikarte in die Hand gegeben. Plötzlich erschien der Angeklagte Klehr. Er begab sich zu dem Stubenältesten, einem Reichsdeutschen namens Wutschke, der im Saal in einem von dem Krankensaal besonders abgetrennten Raum wohnte. Dort wartete der Angeklagte Klehr zusammen mit dem Stubenältesten auf den SS-Lagerarzt. Als dieser nach längerem vergeblichem Warten nicht erschien, wurde der Angeklagte Klehr ungeduldig. Er sprach irgendetwas mit dem Stubenältesten. Dieser zeigte auf die rechte Seite des Saales. Dort waren inzwischen die kranken Häftlinge aufgestellt worden. Klehr begab sich nun zu den wartenden Häftlingen und sonderte 70 von den Kranken aus, wobei er anordnete, dass sie nach Birkenau zu "überstellen" seien. Die 70 waren holländische Juden. Die "Überstellung" nach Birkenau bedeutete, was jeder Eingeweihte, auch der Angeklagte Klehr, wusste, Vergasung in einer der Gaskammern in Birkenau. Die 70 ausgesonderten Menschen wurden noch am gleichen Tag nach Birkenau gebracht. In der Schreibstube des HKB wurden sie von der Stärke als nach Birkenau "überstellt" abgesetzt. In Birkenau wurden die 70 jüdischen holländischen Häftlinge in einer der Gaskammern durch Zyklon B getötet.
4. Die Mitwirkung des Angeklagten Klehr bei der Tötung von 280 Schonungskranken aus dem Block 20 des Häftlingskrankenbaues (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1a)
Im April 1942 gehörte der Block 20 im Stammlager bereits zu dem HKB. Er diente zur Unterbringung von Infektionskranken. Im Saal Nr.10 des Blockes 20 lagen zu dieser Zeit sog. Schonungsfälle. Es waren Kranke, die schon wieder auf dem Weg der Besserung waren, jedoch noch nicht für Arbeiten im Lager eingesetzt werden konnten. Von irgendeiner Stelle wurde eines Tages der Befehl gegeben, dass diese Schonungskranken nach Birkenau zu bringen und dort zu liquidieren seien. Zwei Tage vor dem 20.4.1942 erschien der Angeklagte Klehr auf Block 20 und verlas die Nr. und Namen von 15-20 Häftlingen, die auf dem Saal Nr.10 lagen. Die aufgerufenen Häftlinge mussten vortreten und sich dem Angeklagten Klehr vorstellen. Dieser musterte sie kurz und liess dann einige von ihnen in das Lager entlassen. Der Rest musste ebenso wie alle anderen im Saal Nr.10 befindlichen dableiben.
Am 20.4.1942 mussten alle im Saal Nr.10 liegenden Schonungskranken aufstehen und vor dem Block Nr.20 antreten. Sie sollten nach Birkenau gebracht und dort durch Hunger und sonstige Schikanen umgebracht werden. Offiziell wurden diese Häftlinge nach Birkenau "überstellt", d.h. sie wurden von der Lagerstärke des Stammlagers abgesetzt und auf ihre Karteikarten wurde vermerkt, dass sie nach Birkenau "überstellt" seien. Die Karteikarten wurden aus der "Lebendenkartei" in die "Totenkartei" abgelegt. Der Angeklagte Klehr wusste, dass "Überstellungen" nach Birkenau Liquidierung bedeutete. Wenn Häftlinge nur in ein anderes Lager versetzt wurden, wurde der Ausdruck "verlegt nach ....." gebraucht. Nachdem die Häftlinge aus dem Saal Nr.10 des Blockes 20 vor dem Block angetreten waren, wurden sie im Beisein des Angeklagten Klehr auf LKWs verladen. Der Angeklagte Klehr wachte darüber, dass alle Häftlinge, die sich im Saal Nr.10 des Blockes 20 befunden hatten, die LKWs bestiegen und dann nach Birkenau gebracht wurden. Es waren insgesamt 300 Personen.
In Birkenau wurden die Häftlinge in die Baracke Nr.4 gebracht, die später die Nr.7 erhielt. Sie ist bereits bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Hofmann erwähnt worden. Bereits im April 1942 hiess diese Baracke im Lagerjargon "Wartesaal des Todes". Damals wurden die Muselmänner und die kranken und schwachen Häftlinge noch nicht - wie später - vergast, weil die Bauernhäuser noch nicht umgebaut und die vier Krematorien in Birkenau noch nicht gebaut waren. Man liess die Häftlinge, die man liquidieren wollte, im Block Nr.4 durch Hunger umkommen und quälte sie durch Appellstehen während des ganzen Tages und während jeder zweiten Nacht. An Verpflegung erhielten die Häftlinge im "Wartesaal des Todes" nur einmal in der Woche einen oder zwei Liter Suppe für drei bis fünf Personen und je einmal in der Woche 1400 g. Brot für acht bis zehn Personen. Infolge des Hungers, des ständigen Appellstehens und auf Grund sonstiger Schikanen starben die Häftlinge nacheinander. Von den 300 Häftlingen starben in der Zeit vom 20.April bis zum 3.Mai 1942 280 Menschen. Unter den 300 Häftlingen, die vom Saal Nr.10 nach Birkenau "überstellt" worden waren, befand sich auch der Zeuge Ga. Er konnte sich nur deswegen im Block 4 in Birkenau am Leben erhalten, weil ihm ein Häftlingsarzt auf der Latrine heimlich Brot zusteckte. Zum Dank trug der Zeuge dem Häftlingsarzt Gedichte vor. Was mit den restlichen 19 Häftlingen, die am 3.5.1942 noch am Leben waren, geschehen ist, konnte nicht festgestellt werden. Wahrscheinlich sind sie nach diesem Zeitpunkt noch umgebracht worden.
Der Häftling Ga. wurde in der Folgezeit durch Bemühungen von Häftlingskameraden im Stammlager vor dem Tode bewahrt. Er kam im September 1942 wieder in das Stammlager zurück. Seine Karteikarte war bereits aus der Kartothek herausgenommen und in der sog. Totenkartei abgelegt worden.
Der Angeklagte Klehr wusste bei der Verladung der 300 Häftlinge auf die LKWs, dass sie wegen ihrer Arbeitsunfähigkeit als unnütze Esser und überflüssige Belastung des Lagers in Birkenau "liquidiert" werden sollten. Wie bereits ausgeführt war ihm der Begriff "Überstellung" bekannt. Er wusste, dass "Überstellung" Tötung bedeutete. Dem Angeklagten Klehr war auch klar, dass er durch die Beaufsichtigung der Verladung der Opfer auf die LKWs einen kausalen Beitrag zu der Tötung der Opfer leistete.
5. Die Mitwirkung des Angeklagten Klehr bei der Tötung von 700 Infektionskranken (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1b)
Im Juli/August 1942 herrschte im Stammlager eine schwere Fleckfieberepidemie. Der Block 20 reichte zur Aufnahme der Fleckfieberkranken nicht mehr aus. Es wurde daher eine besondere Holzbaracke zwischen Block 28 und der Bekleidungskammer (Block 27) errichtet, in der ausschliesslich Fleckfieberkranke untergebracht wurden. Als die Epidemie auch auf die SS-Angehörigen übergriff, kam von Berlin die Anordnung, dass man unter allen Umständen der Epidemie Einhalt gebieten müsse. Zwischen dem SS-Standortarzt und dem WVHA in Berlin wurden mehrere Telefongespräche geführt, in denen darüber gesprochen wurde, was mit den Fleckfieberkranken zu geschehen habe. Schliesslich befahl man in Berlin, dass alle Fleckfieberkranken zu "liquidieren" seien. Der Befehl ging dahin, dass alle im Block 20 und in der Holzbaracke untergebrachten Fleckfieberkranken, auch die Rekonvaleszenten sowie alle Häftlingsärzte und die Häftlingspfleger, die mit den Kranken zu tun gehabt hatten, zu töten seien. Hierdurch wollte man erreichen, dass der Infektionsherd beseitigt und die Möglichkeit einer Ansteckung von SS-Angehörigen ausgeschaltet werde. Auf Grund des Befehls von Berlin wurde dann eine Liste aller im Block 20 und in der zu Block 20 gehörenden Holzbaracke befindlichen Kranken und der mit der Behandlung und Pflege dieser Kranken befassten Häftlingsärzte und Häftlingspfleger aufgestellt. Auf der Liste waren über 1000 Namen. Der Zeuge Dr. F., der Zeuge Dr. Kl. und der Zeuge Glo. erreichten jedoch durch Verhandlungen mit dem Standortarzt und dem Lagerarzt Dr. Entress, dass die Häftlingsärzte und Häftlingspfleger von der Vernichtungsaktion ausgenommen und von der aufgestellten Liste wieder gestrichen wurden.
Am Morgen des 29.8.1942 wurde Lagersperre angeordnet. Bereits gegen 6 Uhr kamen SS-Männer und umzingelten den Block 20 und die Holzbaracke. Alle in dem Block 20 und in der Holzbaracke befindlichen Kranken mussten auf den Hof zwischen Block 20 und 21 antreten. Unter ihnen befanden sich Schwerkranke, die nicht mehr laufen konnten. Sie wurden von den kräftigeren Häftlingen getragen. In Block 20 lagen aber auch Rekonvaleszenten, die bereits ein bis zwei Monate krank im Block 20 gelegen hatten und wieder auf dem Wege der Genesung waren. Im Hof zwischen Block 20 und 21 befanden sich der Lagerarzt Dr. Entress und die Angeklagten Klehr und Scherpe. Der Angeklagte Klehr hatte die Karteikarten sämtlicher im Block 20 befindlichen Kranken dabei. Er kontrollierte, dass alle auf der Liste stehenden Häftlinge auch im Hof antraten. Der Lagerarzt Dr. Entress entschied dann darüber, wer von den Rekonvaleszenten und den übrigen Kranken getötet werden sollte und wer am Leben bleiben konnte. Einige der Kranken nahm er von der Liquidierung aus. Die meisten wurden jedoch für die Tötung durch Zyklon B bestimmt. Die Angeklagten Klehr und Scherpe assistierten dem Lagerarzt Dr. Entress bei dieser Selektion. Sie passten auf, dass keiner der für den Tod bestimmten Häftlinge sich zur Gruppe, die in das Lager entlassen werden sollte, schlich und so der Vergasung entzog. Einige Häftlingsärzte und Häftlingspfleger versuchten, einige der Rekonvaleszenten, die von Dr. Entress für den Tod bestimmt worden waren, zu retten, indem sie sie unter Stroh oder in einem Kanal verstecken wollten. Der Angeklagte Klehr passte jedoch auf und verhinderte dies in den meisten Fällen. Den Häftlingspflegern gelang es nur mit List, unbemerkt von Klehr einige wenige der Opfer zu retten.
Als die Selektion beendet war, ging Dr. Entress weg. LKWs fuhren gegen 9 Uhr rückwärts auf den Hof zwischen Block 20 und 21. Alle Häftlinge, die nicht von Dr. Entress von der Liquidierung ausgenommen waren, mussten LKWs besteigen. Viele waren so schwach, dass sie nicht in der Lage waren, auf die LKWs zu klettern. Andere, die ahnten, was ihnen bevorstand, weigerten sich, die LKWs zu besteigen. Der Angeklagte Klehr, der die Aufsicht hierbei führte, liess die Kranken und Schwachen von anderen Häftlingen auf die LKWs bringen. Die Widerstrebenden zerrte er mit Gewalt auf die LKWs, wobei er auf sie einschlug. Wenn die LKWs mit Menschen vollgestopft waren, fuhren sie weg und brachten die Opfer zu einer der Gaskammern in Birkenau. Die zurückbleibenden Häftlinge wurden von den Angeklagten Klehr und Scherpe überwacht. Beide achteten darauf, dass keiner weglief oder von einem Häftlingsarzt oder Häftlingspfleger gerettet wurde. Klehr erlaubte den wartenden Kranken auch nicht, obwohl es im Verlaufe des Vormittags immer heisser wurde, sich in den Schatten zu stellen. Auch durften sie nicht weggehen, um ihre Notdurft zu verrichten. Viele sanken erschöpft in den Sand. Sie bekamen bis zur Beendigung der Aktion gegen 14 Uhr weder Wasser noch Essen.
Die LKWs kamen, nachdem sie den ersten Teil der Opfer nach Birkenau gebracht hatten, wieder leer zurück und holten die nächsten, die auf die gleiche Weise im Beisein und unter Mitwirkung des Angeklagten Klehr auf die LKWs gebracht wurden, bis alle für den Tod bestimmten Menschen zu der Gaskammer in Birkenau abtransportiert waren. Insgesamt wurden mindestens 700 Menschen zu einer der Gaskammern in Birkenau gebracht und dort durch Zyklon B getötet.
Der Angeklagte Klehr wusste, dass die Infektionskranken nur deswegen unschuldig getötet werden sollten, und getötet wurden, weil man den Herd der Infektionskrankheit beseitigen und eine Ansteckung der SS-Angehörigen verhindern wollte. Ihm war klar, dass alle, die die LKWs besteigen mussten bzw. von ihm auf die LKWs mit Gewalt gezerrt wurden, anschliessend in einer der Gaskammern in Birkenau durch Zyklon B getötet wurden.
6. Die Mitwirkung des Angeklagten Klehr bei der Massentötung der sog. RSHA-Juden (Eröffnungsbeschluss Ziffer 3, Ziffer 1, erster Halbsatz)
Der Angeklagte Klehr war auch an der Massentötung der sog. RSHA-Juden beteiligt. Er wurde zu einem nicht mehr näher festzustellenden Zeitpunkt Leiter des sog. Desinfektionskommandos. Aufgabe des Desinfektionskommandos, das aus mehreren SS-Angehörigen bestand, war es, die Baracken im Stammlager und im Lager Birkenau zu entwesen, d.h. das darin befindliche Ungeziefer, insbesondere Läuse, durch Zyklon B zu töten. Auch die vom Ungeziefer befallenen Kleider der Häftlinge wurden in besonderen Vorrichtungen durch dieses Kommando entwest. Zu dem Desinfektionskommando gehörten SS-Angehörige, die ausserdem das Zyklon B in die Gaskammern hineinzuschütten hatten, um die darin befindlichen Menschen zu töten. Leiter dieser sog. Vergasungskommandos war ebenfalls der Angeklagte Klehr. Er stellte für die ihm unterstellten Angehörigen des Vergasungskommandos einen Dienstplan auf. Jeweils zwei Angehörige des Vergasungskommandos hatten je 24 Stunden Dienst. Sie mussten sich während dieser Zeit für die Vergasung von RSHA-Transporten bereit halten. Wenn RSHA-Transporte ankamen, wurden sie benachrichtigt. Sie begaben sich daraufhin mit den erforderlichen Büchsen Zyklon B zu der Gaskammer, in der gerade die Vergasung durchgeführt werden sollte. Der Angeklagte Klehr hat in einer unbestimmten Anzahl von Fällen teils selbst das Zyklon B in die Gaskammer hineingeschüttet, teils das Einschütten des Zyklon B durch die ihm unterstellten SS-Männer überwacht.
a. In mindestens einem Fall hat er selbst das Zyklon B durch die Einfüllöcher vom Dach des kleinen Krematoriums in die Gaskammer des kleinen Krematoriums hineingeschüttet, nachdem jüdische Menschen, die mit einem RSHA-Transport angekommen waren, in die Gaskammer eingeschlossen worden waren. In diesem Fall sind mindestens 50 jüdische Menschen ohne Gerichtsurteil nur wegen ihrer Abstammung als Angehörige einer sog. minderwertigen Rasse getötet werden.
b. Der Angeklagte Klehr hat ferner die Vergasungen in den Gaskammern von Birkenau überwacht. In mindestens zwei Fällen ist er als Leiter des Vergasungskommandos zu einer der Gaskammern in den umgebauten Bauernhäusern hingefahren und hat dort die ihm unterstellten SS-Angehörigen beim Einschütten des Zyklon B beaufsichtigt, nachdem jüdische Menschen aus RSHA-Transporten in die Gaskammer eingeschlossen worden waren. In jedem dieser beiden Fälle sind mindestens 750 Menschen getötet worden.
Der Angeklagte Klehr war auch in mindestens zwei Fällen im Jahre 1943 bei Selektionen von RSHA-Transporten auf der alten Rampe anwesend. Ärztlichen Rampendienst hatte an diesen beiden Tagen der SS-Lagerarzt Dr. Entress, dem der Angeklagte Klehr als SDG unmittelbar unterstand. Dr. Entress hatte dem Angeklagten Klehr befohlen, mit zur Rampe zur Abwicklung der RSHA-Transporte zu kommen und ihm bei den Selektionen, die er durchzuführen hatte, behilflich zu sein. Der Angeklagte Klehr kam dieser Aufforderung nach. Er gab den ankommenden Menschen, nachdem sie ausgestiegen und getrennt nach Männern und Frauen aufgestellt worden waren, bekannt, dass sich alle, die krank seien, bei ihm melden sollten. Etwa 20 Personen kamen dieser Aufforderung nach und meldeten sich bei ihm als krank. Der Angeklagte Klehr suchte ausserdem alle, die ihm als krank erschienen, heraus und stellte sie zu den Kranken. Mit ihnen und den anderen, die sich auf seine Aufforderung hin krank gemeldet hatten, ging er zu Dr. Entress, der sie kurz ansah und bestimmte, dass sie in die Gaskammer zu bringen seien, indem er sie zu den als arbeitsunfähig beurteilten Menschen Aufstellung nehmen liess. Sie wurden zusammen mit allen anderen, die nicht in das Lager aufgenommen wurden, anschliessend in einer der Gaskammern in Birkenau durch Zyklon B getötet. Insgesamt wurden von jedem der beiden Transporte mindestens 750 Menschen durch Zyklon B getötet.
Der Angeklagte Klehr wusste von vornherein, dass die Kranken, die er aus den beiden Transporten heraussuchte, anschliessend getötet werden sollten. Ihm war auch bekannt, dass alle jüdischen Menschen, die von Dr. Entress bei den Selektionen nicht für die Aufnahme in das Lager bestimmt wurden, wegen ihrer Abstammung als Angehörige einer sog. minderwertigen Rasse getötet werden sollten und anschliessend in einer der Gaskammern in Birkenau auch durch Zyklon B getötet wurden. Wie alle anderen SS-Angehörigen war er bezüglich dieser Vernichtungsaktion zur strengsten Geheimhaltung verpflichtet worden. Er wusste auch, dass die Opfer über ihr bevorstehendes Schicksal auf die unter A.II. geschilderte Weise getäuscht wurden.
Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei diesen beiden RSHA-Transporten um die gleichen gehandelt hat, bei denen der Angeklagte Klehr das Einschütten des Zyklon B beaufsichtigt hat.
7. Die Mitwirkung des Angeklagten Klehr bei der Tötung des jüdischen Sonderkommandos in Stärke von 200 Mann (Eröffnungsbeschluss Ziffer 3)
Der Angeklagte Klehr hat ferner bei folgender Vergasung im kleinen Krematorium mitgewirkt:
Einmal, der Zeitpunkt konnte nicht festgestellt werden, brachte man von SS-Posten bewachte 200 Häftlinge aus dem Lager Birkenau zum Stammlager. Es waren Angehörige des jüdischen Sonderkommandos, das in den Gaskammern von Birkenau die Leichen der getöteten Menschen aus den Gaskammern herauszuziehen und in den Verbrennungsöfen zu verbrennen hatte. Die Häftlinge des Sonderkommandos wurden auf den Hof des kleinen Krematoriums geführt. Dort wurde ihnen befohlen, sich auszuziehen. Da sie ahnten, was ihnen bevorstand, weigerten sie sich, dem Befehl nachzukommen. Daraufhin schlugen die SS-Männer auf die Häftlinge ein und zwangen sie, sich zu entkleiden. Danach führte man die 200 nackten Häftlinge in die Gaskammer des kleinen Krematoriums hinein und verriegelte diese von aussen. Der Angeklagte Klehr war inzwischen mit zwei SS-Angehörigen des Vergasungskommandos am kleinen Krematorium eingetroffen. Nachdem die Gaskammer verriegelt worden war, gab er diesen den Befehl, das Zyklon B in die Gaskammer hineinzuschütten. Beide SS-Männer stiegen nun auf das Dach des kleinen Krematoriums, öffneten unter dem Schutz von Gasmasken mit einem zackigen Schlüssel die Dosen mit Zyklon B und warfen den Inhalt der Büchsen durch die Einfüllöcher in die Gaskammer hinein. Der Angeklagte Klehr stand währenddessen unten und beaufsichtigte die Tätigkeit der ihm unterstellten Männer. Zu gleicher Zeit fuhren mehrere SS-Männer auf Motorrädern um das kleine Krematorium herum, um das Geschrei der in der Gaskammer eingeschlossenen Menschen zu übertönen. Die 200 eingeschlossenen Häftlinge wurden durch die sich entwickelnden Gase in wenigen Minuten getötet. Der Angeklagte Klehr erhielt laufend Zusatzverpflegung in Form von Milch, Butter, Bonbons, Jamaika-Rum, Schnaps und Zigaretten für seine Mitwirkung beim Rampen- und Gaskammerdienst.
8. Einzeltötungen durch den Angeklagten Klehr durch Phenolinjektionen (Ziffer 2 des Eröffnungsbeschlusses)
a. Im Sommer 1942 hatte einmal ein jüdischer Häftlingsarzt namens Fedor sein Bett nicht richtig gemacht. Der Angeklagte Klehr meldete ihn deswegen. Der Häftling wurde auf Grund dieser Meldung mit 14 Tagen Stehbunker bestraft. Er musste die Nächte in einer der Stehzellen im Arrestbunker des Blockes 11 verbringen, wo er weder sitzen noch liegen konnte. Tagsüber musste er im HKB arbeiten. Da er völlig übermüdet war, schlief er tagsüber meist bei der Arbeit ein. Eines Tages musste er während dieser Strafzeit im Röntgenraum im Block 28 arbeiten. Er schlief wiederum vor Übermüdung bei der Arbeit ein. Plötzlich kam der Angeklagte Klehr heimlich in den Röntgenraum herein und überraschte den Schlafenden. Er befahl ihm, sofort in den Operationssaal des Blockes 28 zu gehen. Der Häftlingsarzt Fedor betrat den Operationssaal als gesunder Mensch. Klehr ging anschliessend hinter dem Häftling in den Operationssaal hinein. Dort tötete er den Häftling Fedor mit einer Phenolinjektion. Die Leiche liess er im Operationssaal liegen. Sie wurde abends von Leichenträgern aus dem Operationssaal geholt und zum Krematorium gebracht.
b. (Eröffnungsbeschluss Ziffer 2a) In der Zeit zwischen August und Mitte November 1942 wurde eine Häftlingsfrau aus dem Nebenlager Budy in das Stammlager gebracht. Sie sollte dort getötet werden, weil sie an einer Schlägerei im Nebenlager Budy, bei der jüdische Frauen durch deutsche weibliche Kapos und Arbeitsanweiserinnen (Häftlinge) und SS-Posten getötet worden waren, teilgenommen hatte. Die Häftlingsfrau wurde dem Angeklagten Klehr im Block 28 vorgeführt. Klehr hatte einen weissen Arztkittel an. Er spiegelte der Frau vor, sie sei herzkrank. Deswegen müsse sie eine Spritze bekommen. Tatsächlich wollte er sie jedoch durch eine Phenolinjektion töten. Die Häftlingsfrau glaubte dem Angeklagten Klehr, dass sie eine Spritze für ihre Gesundheit erhalten sollte und leistete keinen Widerstand. Klehr nahm dann die Rekordspritze, die bereits mit Phenol gefüllt war, stiess die Nadel der Spritze der Häftlingsfrau in das Herz und spritzte das Phenol der Frau unmittelbar in das Herz. Die Frau fiel sofort um und starb auf der Stelle. Gegen sie lag, wie der Angeklagte Klehr wusste, kein Todesurteil vor.
c. (Eröffnungsbeschluss Ziffer 2c) Im Sommer 1942 wurde ein russischer Politkommissar in Uniform in einem Sanka auf den Block 20 gebracht. Er wurde in das Zimmer Nr.1 hineingeführt. Dort befand sich der Angeklagte Klehr mit zwei Funktionshäftlingen. Klehr wollte den russ. Kommissar mit einer Phenolinjektion töten. Er befahl ihm, sich auf einen Schemel zu setzen, seinen Uniformrock aufzuknöpfen und die Brust frei zu machen. Als dies geschehen war, bedeckten die beiden Funktionshäftlinge das Gesicht des Mannes und stützten ihn im Rücken. Als ihm der Angeklagte Klehr die Phenolspritze in das Herz hineinstossen wollte, sprang der russ. Kommissar, der plötzlich misstrauisch geworden war, auf, nahm den Hocker und bedrohte damit den Angeklagten Klehr. Einer der Funktionshäftlinge schlug daraufhin den russ. Kommissar von hinten mit dem Schürhaken über den Kopf, so dass er blutend zusammenbrach. Er wurde im Liegen von den Funktionshäftlingen gehalten, während ihm der Angeklagte Klehr die Nadel der Rekordspritze, die mit Phenol gefüllt war, in das Herz stiess und das Phenol in das Herz spritzte. Der russ. Kommissar starb unmittelbar danach. Gegen ihn lag - wie der Angeklagte Klehr wusste - kein Todesurteil vor.
d. (Eröffnungsbeschluss Ziffer 2i) Im Jahre 1942 oder 1943 wurden eines Tages zwei Häftlingsfrauen mit dem Sanka von Birkenau in das Stammlager gebracht. Beide sollten aus nicht näher aufzuklärenden Gründen getötet werden. Die eine Frau war eine Deutsche, die andere eine Polin namens Terlikowska. Beide wurden in den Block 20 hineingeführt. Dort wurden sie auf dem Zimmer Nr.1 von dem Angeklagten Klehr nacheinander auf die übliche Weise durch Phenol getötet. Gegen beide Frauen lag kein Todesurteil vor. Das war dem Angeklagten Klehr bekannt. Die Leichen der beiden Frauen blieben zunächst im Ärztezimmer liegen. Später wurden sie von Leichenträgern abgeholt.
e. (Eröffnungsbeschluss Ziffer 2k) Im HKB war ein holländischer jüdischer Arzt namens Samson als Häftlingspfleger beschäftigt. Eines Tages erregte dieser Häftling aus irgend einem nichtigen Anlass das Missfallen des Angeklagten Klehr. Klehr schlug den Häftling mit dem Schürhaken. Dr. Samson lief weg. Der Angeklagte Klehr lief hinter ihm her und schlug ihn, wohin er ihn gerade traf. Dr. Samson brach schliesslich blutend zusammen. Er lebte aber noch. Der Angeklagte Klehr liess ihn dann von Häftlingen in das Zimmer Nr.1 des Blockes 20 bringen. Dort tötete er den misshandelten Häftling Dr. Samson mit einer Phenolinjektion auf die übliche Weise.
III. Die Einlassung des Angeklagten Klehr, Beweismittel, Beweiswürdigung
1.
Die Feststellungen zum Lebenslauf des Angeklagten Klehr beruhen auf seiner eigenen Einlassung.
2. Zu II.1.
Die Feststellungen unter II.1. beruhen auf der Einlassung des Angeklagten Klehr, soweit ihr gefolgt werden konnte, sowie den glaubhaften Aussagen der Zeugen Dr. Kl., Glo., Dr. F. und Dr. P.
Der Angeklagte Klehr hat eingeräumt, dass er als SDG im HKB dem Lagerarzt Dr. Entress bei der "Untersuchung" der Neukranken, der sog. "Arztvorsteller" oder "Arztvormelder" assistiert hat. Er hat auch zugegeben, dass der Lagerarzt Dr. Entress bei diesen "Untersuchungen" jeweils einen Teil der Neukranken in der geschilderten Weise für die Tötung durch Phenol ausgewählt hat. Schliesslich hat er eingeräumt, zwischen Frühjahr und Juli 1942 eigenhändig die von dem Lagerarzt Dr. Entress zur Tötung ausgewählten Neukranken durch Phenolinjektionen auf dem Zimmer Nr.1 in Block 20 getötet zu haben.
Im übrigen hat er sich wie folgt hierzu eingelassen:
Als er als SDG im HKB eingesetzt worden sei, hätte der Lagerarzt Dr. Entress bereits kranke und schwache Häftlinge zur Tötung ausgesucht und durch Funktionshäftlinge töten lassen. Ursprünglich seien die tödlichen Injektionen in die Armvenen der Opfer gegeben worden. Ein Funktionshäftling namens Werl habe dies im Leichenkeller des Blockes 28 gemacht. Er - der Angeklagte - habe ihn einmal dabei überrascht, als er noch nichts von den Phenolinjektionen gewusst habe. Auf seine Frage, wer ihm das befohlen habe, habe Werl geantwortet: "Der Lagerarzt Dr. Entress." Anschliessend habe er - der Angeklagte - sich bei dem Unterscharführer Ulzenhöfer wegen des Vorfalls erkundigt. Dieser habe ihm geantwortet, er solle sich nicht darum kümmern, das sei von Dr. Entress befohlen und werde schon seit Mitte 1941 so gemacht.
Ab Frühjahr 1942 seien dann die tödlichen Injektionen im Zimmer Nr.1 des Blockes 20 gegeben worden. Er selbst habe die Funktionshäftlinge beaufsichtigen müssen, wenn sie dann die von Dr. Entress ausgesuchten Häftlinge durch Phenolinjektionen getötet hätten.
Einmal habe er beobachtet, wie ein Blockältester einen Häftling aus dem Lager in den Block 28 geführt habe, der nicht dem Lagerarzt vorgestellt worden sei. Er habe dann andere Häftlinge gefragt, was das bedeuten solle. Durch eigene Nachforschungen habe er festgestellt, dass der Rapportführer Palitzsch und der Lagerführer Aumeier Häftlinge, die ihnen missliebig gewesen seien, durch Funktionshäftlinge im HKB durch Phenolinjektionen hätten töten lassen. Er habe sofort dem Lagerarzt Dr. Entress gemeldet, dass im HKB Häftlinge durch Phenolinjektionen getötet würden, die nicht von ihm - dem Lagerarzt - ausgesondert worden seien. Dr. Entress habe ihm daraufhin befohlen, in Zukunft selbst das Phenol zu holen und selbst die von ihm - dem Lagerarzt - ausgesonderten Häftlinge durch Injektionen zu töten. Er - der Angeklagte - habe daraufhin Dr. Entress inständig gebeten, davon abzusehen. Dr. Entress habe ihm jedoch gedroht, er werde ihn an die Schwarze Wand stellen, wenn er seinen Befehl nicht ausführe. Er - der Angeklagte - habe sich daher in einer Zwangslage befunden. In dieser Zwangslage habe er in der Folgezeit während eines Zeitraumes von etwa zwei bis drei Monaten bis Juli 1942 wöchentlich zweimal jeweils 12-15 Menschen, die von Dr. Entress für den Tod ausgewählt worden seien, durch Phenolinjektionen eigenhändig getötet. Insgesamt habe er 250-300 Häftlinge auf diese Weise umgebracht. Während seiner Zeit seien nur jüdische Häftlinge im HKB zur Tötung mit Phenol oder zur Vergasung ausgesondert worden. Im Juli 1942 sei er als SDG im Stammlager abgelöst worden. Danach habe er mit den Selektionen im HKB und den Phenolinjektionen nichts mehr zu tun gehabt.
Die Einlassung des Angeklagten Klehr entspricht nur teilweise der Wahrheit und ist nur zum Teil glaubhaft. Es kann ihm geglaubt werden, dass das geschilderte Verfahren bei den sog. Arztvorstellern bereits vor seiner Versetzung nach Auschwitz in dem HKB des Stammlagers praktiziert wurde. Zutreffend ist auch, dass Funktionshäftlinge bereits vor seinem Eintreffen im HKB die vom Lagerarzt ausgesonderten Kranken und schwachen Häftlinge durch Phenolinjektionen getötet haben. Der Zeuge de Ma. hat bestätigt, dass in der ersten Zeit zwei polnische Häftlinge namens Stössel und Panczyk im Block 28 die vom Lagerarzt zur Tötung ausgewählten Häftlinge getötet haben. Auch der Zeuge Dr. F. hat das gleiche bekundet. Die Häftlinge Panczyk und Stössel hätten sich noch damit gebrüstet - so hat dieser Zeuge ausgesagt - dass sie eine gewisse Fertigkeit im Töten von Häftlingen hätten. Klehr habe teilweise nur die Aufsicht geführt, wenn diese beiden Funktionshäftlinge die kranken und schwachen Häftlinge umgebracht hätten. Der Zeuge Oz., der im Oktober 1941 als Reiniger in den Operationssaal im Block 28 versetzt wurde und dort in dieser Funktion bis zum Februar 1942 blieb, hat wiederholt erlebt, dass Klehr und der Häftling Panczyk in den Operationssaal des Blockes 28 hineingingen und sich Häftlinge in den Operationssaal bringen liessen. Der Zeuge wurde dann - wie er glaubhaft bekundet hat - von dem Angeklagten Klehr aus dem Operationssaal hinausgeschickt. Vorher musste er häufig Spritze, Nadel und Phenol bereitstellen. Nach ein bis zwei Stunden wurden dann die Leichen der Opfer von Leichenträgern weggetragen. Der Zeuge musste den Operationssaal wieder aufräumen. Er hält es ebenfalls für möglich, dass Panczyk, wenn er im Operationssaal anwesend war, unter der Aufsicht des Angeklagten Klehr den Opfern die tödliche Phenolinjektion gegeben hat.
Fest steht jedoch auf Grund der eigenen Einlassung des Angeklagten Klehr, dass er auch eigenhändig Häftlinge durch Phenolinjektionen getötet hat. Seine Einlassung, er sei hierzu durch die angeführte Drohung des Lagerarztes Dr. Entress gezwungen worden, hat ihm das Gericht nicht abgenommen. Sie ist nur eine Schutzbehauptung. Es mag sein, dass der Angeklagte Klehr ungehalten darüber war, dass einige Häftlinge aus dem Lager ohne sein Wissen und ohne Wissen des Lagerarztes auf Anordnung des Lagerführers und des Rapportführers im HKB durch Funktionshäftlinge getötet worden sind. Es mag auch sein, dass er darüber dem Lagerarzt berichtet hat. Sein Unmut bezog sich jedoch nicht darauf, dass überhaupt Häftlinge unschuldig umgebracht wurden, sondern offensichtlich nur darauf, dass die Lagerführung Kompetenzen des Arztes und seine eigenen Kompetenzen nicht respektierte und die Funktionshäftlinge, die im Dienst des HKB standen, als Werkzeuge für die Tötung missliebiger Häftlinge aus dem Lager benutzte. Denn gegen die Tötung von kranken und schwachen jüdischen Häftlingen, die vom Lagerarzt entweder bei der "Untersuchung" der sog. Arztvorsteller oder sonst im HKB für die Tötung ausgesucht worden sind, hatte er nichts einzuwenden. Er hat es vielmehr für richtig gehalten und innerlich bejaht, dass man solche kranken und schwachen Häftlinge beseitigt hat. Das folgt eindeutig daraus, dass er - wie sich aus den getroffenen Feststellungen unter II.3. ergibt und was noch näher auszuführen sein wird - wiederholt eigenmächtig die Zahl der Opfer erhöht oder - wenn der Lagerarzt nicht zur "Untersuchung" der Arztvorsteller erschienen war - selbständig und eigenmächtig Häftlinge für die Tötung durch Phenol bestimmt hat, ohne dass hierfür ein Befehl vorlag. Besonders klar zeigt sich diese innere Einstellung des Angeklagten Klehr zu den Tötungsaktionen bei der von ihm eigenmächtig durchgeführten Selektion am Heiligen Abend 1942. Auch die Tatsache, dass er sich gegenüber Häftlingsärzten - wie der Zeuge Dr. F. glaubhaft bekundet hat - damit gebrüstet hat, eine gewisse Fertigkeit im Töten durch Phenolinjektionen erlangt zu haben und dass er darauf stolz war, zeigt, dass er keineswegs ablehnend diesen Vernichtungsaktionen gegenüberstand und seine Mitwirkung vom Lagerarzt Dr. Entress nicht erzwungen werden brauchte. Wäre er tatsächlich nur durch eine Drohung des Lagerarztes Dr. Entress zur eigenhändigen Tötung von Häftlingen gezwungen worden, wäre nicht verständlich, dass er noch eigenmächtig eine Vielzahl weiterer Häftlinge aus dem HKB ausgesucht und durch Phenolinjektionen getötet hat. Dann hätte er im Gegenteil alles versucht, noch möglichst viele Häftlinge, die bereits von Dr. Entress für die Tötung bestimmt waren, zu retten. Die Möglichkeit hierzu hätte er ohne weiteres gehabt, wenn der Lagerarzt nach den Selektionen den HKB und das Lager verlassen hatte. Denn der Lagerarzt hat die Anzahl der von ihm selektierten Häftlinge nicht gezählt und sich später nicht davon überzeugt, dass auch tatsächlich alle getötet worden sind. Er wusste, dass er sich auf den Angeklagten Klehr "verlassen" konnte.
Widerlegt ist auch die Einlassung des Angeklagten Klehr, dass er nur bis Juli 1942 im HKB tätig gewesen sei und nur bis zu diesem Zeitpunkt Häftlinge im Block 20 getötet habe. Viele Zeugen haben ihn noch nach diesem Zeitpunkt im HKB als SDG erlebt. So hat der Zeuge Rei., der erst im Oktober 1942 in die Häftlingsschreibstube auf Block 21 gekommen ist, glaubhaft bekundet, dass der Angeklagte Klehr zu dieser Zeit SDG im HKB gewesen sei. Er sei auch noch um die Jahreswende 1942/1943 im HKB tätig gewesen. Erst im Spätfrühling oder sogar im Sommer 1943 sei er endgültig weggekommen. Der Zeuge Toc., der erst im Oktober oder November 1942 nach Auschwitz gekommen ist und nach seiner Fleckfiebererkrankung Ende Februar oder Anfang März als Graphiker auf der Schreibstube des Blockes 21 eingesetzt wurde, hat erst im März 1943 den Angeklagten Klehr als SDG im HKB kennengelernt. Er musste - wie er sich noch genau erinnern konnte - im März 1943 eine Zeichnung für den Angeklagten Klehr zu dessen persönlichem Gebrauch anfertigen. Klehr muss daher zu dieser Zeit noch als SDG im HKB gewesen sein. Auch die Zeugen Hol. und Ta. haben übereinstimmend glaubhaft bekundet, dass der Angeklagte Klehr noch Anfang 1943 als SDG im HKB gewesen sei. Der Zeuge Glo., der als Schreiber auf dem Block 20 ständig mit dem Angeklagten Klehr zu tun hatte und ihn fast täglich gesehen hat, hat gemeint, dass Klehr bis ungefähr Mitte 1943 die Funktionen eines SDG im HKB ausgeübt habe. Das gleiche haben die Zeugen Sta., der als Pfleger im Stammlager bis Sommer 1943 eingesetzt war, und der Zeuge Wei., der dem Angeklagten Klehr im Zimmer Nr.1 im Block 20 wiederholt bei der Tötung von Häftlingen assistieren musste, bekundet.
Der Zeuge Fa. hat ausgesagt, dass der Angeklagte Klehr im Winter 1942/43 zwar Chef des Desinfektionskommandos geworden sei, dass er aber daneben noch als SDG bis zum Frühjahr 1943 im HKB tätig gewesen sei.
Der Zeuge Kark., der erst im Januar 1943 als Typhuskranker in den Block 20 gekommen ist und nach seiner Genesung Hilfspfleger auf Block 19 wurde, hat nach seiner glaubhaften Bekundung ebenfalls noch den Angeklagten Klehr als SDG erlebt. Er hat ihn noch im Februar und März 1943 im HKB gesehen. Allerdings seien zu dieser Zeit - so hat der Zeuge bekundet - auch noch andere SDGs im HKB gewesen, nämlich Nierwicki und der Angeklagte Hantl. Die SDGs hätten sich im Dienst irgendwie abgewechselt.
Schliesslich haben die Zeugen Dr. P., Dr. Kl., Rei. und Glo. übereinstimmend glaubhaft bekundet, worauf noch zurückzukommen sein wird, dass der Angeklagte Klehr am Heiligen Abend 1942 im HKB eine selbständige Selektion in Abwesenheit des Arztes durchgeführt und anschliessend die von ihm ausgesonderten Häftlinge in Block 20 durch Phenol getötet hätte.
Aus all diesen Zeugenaussagen hat das Schwurgericht die Überzeugung gewonnen, dass der Angeklagte Klehr nicht nur - wie er sich einlässt - bis zum Juli 1942, sondern mindestens bis zum Frühjahr 1943 als SDG im HKB tätig gewesen ist, auch wenn er schon vorher Leiter des Desinfektionskommandos geworden ist.
Die Anzahl der von dem Angeklagten Klehr durch Phenolinjektionen eigenhändig getöteten Häftlinge, die vom Lagerarzt Dr. Entress zur Tötung bestimmt worden sind, konnte auch nicht annähernd festgestellt werden. Der Zeuge Glo. schätzt die Zahl der durch Phenol getöteten Menschen auf ca. 30000. Er konnte jedoch aus verständlichen Gründen nicht angeben, wieviel Häftlinge durch Funktionshäftlinge und andere SDGs ohne Anwesenheit des Angeklagten Klehr getötet worden sind. Daher lässt sich schon aus diesem Grunde die Anzahl der von Klehr eigenhändig getöteten Häftlinge nicht ermitteln. Im übrigen hat das Gericht keine Möglichkeit, ob die Schätzung des Zeugen zutreffend ist, zu überprüfen.
Der Zeuge Gl. hat zunächst gemeint, dass der Angeklagte Klehr mehrere 10000 getötet habe. Dann hat er die Anzahl der von Klehr Getöteten auf 18-20000 geschätzt. Schliesslich hat er erklärt, dass er mit voller Bestimmtheit sagen könne, das Klehr mehr als 10000 durch Injektionen "eigenmächtig und eigenhändig" getötet habe. Auch diese Angaben, deren Richtigkeit nicht überprüft werden konnte, erschienen dem Schwurgericht zu unbestimmt, um sie zur Grundlage von sicheren Feststellungen und zur Grundlage des Urteils machen zu können. Der Zeuge Wei. hat zunächst gemeint, dass Klehr in seiner Gegenwart vielleicht 700 bis 1000 Menschen getötet habe. Er hat jedoch hinzugefügt, dass er die Opfer nicht gezählt habe. Dann meinte er, nachdem er erneut nach der Anzahl der von Klehr getöteten Opfer gefragt worden ist, Klehr habe einige "Zehner" getötet, es könnten auch mehr oder weniger gewesen sein. Schliesslich schätzte er die Zahl der von Klehr in seiner Gegenwart getöteten Menschen auf 100 bis 1000. Das gelte jedoch nur für die Zeit von August 1942 bis Sommer 1943.
Das Schwurgericht hat sich, da es unsichere Schätzungen nicht zur Grundlage des Urteils machen durfte, darauf beschränkt, Mindestzahlen festzustellen, wenn auch anzunehmen ist, dass Klehr während der langen Zeit seiner Tätigkeit im HKB mehrere tausend Häftlinge, die vom Lagerarzt bei den sog. "Arztvorstellern" für die Tötung bestimmt worden waren, getötet hat, abgesehen von den im HKB durch den Lagerarzt selektierten und den vom Angeklagten Klehr eigenmächtig ausgesonderten Häftlingen, worauf noch zurückzukommen sein wird.
Mit Sicherheit kann davon ausgegangen werden, dass der Angeklagte Klehr in der Zeit vom Frühjahr 1942 bis Juli 1942 mindestens 250 Häftlinge, die von dem Lagerarzt Dr. Entress zur Tötung bestimmt worden waren, eigenhändig durch Phenolinjektionen getötet hat. Denn der Angeklagte Klehr hat selbst eingeräumt, dass er 250 bis 350 Häftlinge (also mindestens 250) eigenhändig getötet habe.
Mit Sicherheit steht ferner fest, dass der Angeklagte Klehr nach dieser Zeit mindestens noch weitere sechs Häftlinge, die vom Lagerarzt für den Tod bestimmt worden waren, durch Phenolinjektionen getötet hat. Der Zeuge de Ma., der erst am 20.7.1942 als Schreiber in den HKB gekommen ist, hat nach dem 31.7.1942 - wie er glaubhaft geschildert hat - einmal mit eigenen Augen gesehen, wie der Angeklagte Klehr einen Häftling durch eine Phenolinjektion im Zimmer Nr.1 des Blockes 20 getötet hat. Der Zeuge kam gerade in das Zimmer hinein, als ein nackter Häftling vor dem Angeklagten Klehr auf einem Schemel sass. Der Häftling, der zuvor mit anderen vom Lagerarzt Dr. Entress für den Tod bestimmt worden war, wurde von zwei Funktionshäftlingen gehalten. Einer dieser Funktionshäftlinge war der polnische Häftling Panczyk. Der Zeuge de Ma. beobachtete - nach seiner weiteren glaubhaften Schilderung - wie der Angeklagte Klehr die mit Phenol gefüllte Rekordspritze nahm und die Nadel der Spritze dem vor ihm sitzenden Häftling ins Herz stiess und sofort danach das in der Spritze befindliche Phenol dem Häftling in das Herz spritzte. Der Häftling starb unmittelbar danach. Dieser Fall kann nicht in den vom Angeklagten Klehr zugegebenen 250 Fällen enthalten sein, da der Angeklagte Klehr nur bis Juli 1942 im HKB gewesen sein will und nur die Tötungen angegeben hat, die er bis Juli 1942 durchgeführt hat.
Der bereits erwähnte Zeuge Toc. musste - wie er glaubhaft ausgesagt hat - im Frühling 1943 vom Block 21 eine Nachricht zu dem Angeklagten Klehr auf Block 20 bringen. Er betrat den Block 20 durch den Mitteleingang. Dort sah er auf dem Flur mehrere nackte Häftlinge, die zuvor vom Lagerarzt für die Tötung ausgewählt worden waren, stehen. Der Zeuge ging hinter den Vorhang, um dem Angeklagten Klehr die Nachricht in das Zimmer Nr.1 zu bringen. Als er das Zimmer betrat, sah er, wie gerade ein nackter Häftling auf dem Schemel vor dem Angeklagten Klehr sass. Ein Funktionshäftling stand neben dem Schemel. Der Funktionshäftling fragte den nackten Häftling wie er heisse. Dann legte er ihm die Hand vor Augen. Unmittelbar danach spritzte der Angeklagte Klehr dem sitzenden Häftling mit der Rekordspritze Phenol unmittelbar ins Herz. Der Häftling starb auf der Stelle. Danach wurde ein zweiter Häftling nackt hereingerufen. Auch diesen tötete der Angeklagte Klehr im Beisein des Zeugen auf die gleiche Weise. Weitere Tötungshandlungen konnte der Zeuge nicht mehr beobachten, da er das Zimmer auf Befehl Klehrs wieder verlassen musste.
Das Gericht hat keinen Anlass, an der Darstellung des Zeugen Toc., der einen glaubwürdigen Eindruck hinterlassen hat, zu zweifeln. Damit steht fest, dass der Angeklagte Klehr über die von ihm zugegebenen und über den vom Zeugen de Ma. geschilderten Fall hinaus mindestens noch zwei weitere Häftlinge eigenhändig getötet hat.
Schliesslich steht auf Grund der Aussage des Zeugen Wei. fest, dass der Angeklagte Klehr noch mindestens drei weitere vom Lagerarzt Dr. Entress ausgewählte Häftlinge nach dem 31.7.1942 eigenhändig getötet hat. Der Zeuge Wei. konnte sich zwar - wie schon ausgeführt - nicht auf eine bestimmte Zahl festlegen. An eine Tötungsaktion, die am 28.9.1942 stattfand, konnte er sich aber noch konkret erinnern. An diesem Tag wurde nämlich sein Vater durch den Angeklagten Klehr in seinem Beisein getötet. Der Zeuge hat glaubhaft bekundet, dass an diesem Tag ausser seinem Vater noch weitere Häftlinge, nämlich Joseph Grün, Armin Feldbauer und Anton Myjava durch den Angeklagten Klehr mit Phenol getötet worden seien. Diese Tötungshandlungen können nicht mit den vom Angeklagten Klehr zugegebenen 250 Fällen identisch sein, da Klehr nur die bis Juli 1942 durchgeführten Tötungsaktionen zugegeben hat. Es kann sich dabei auch nicht um die vom Zeugen Toc. geschilderten Fälle handeln, da der Zeuge Toc. erst im Frühling
1943 seine Beobachtung gemacht hat.
Zieht man zu Gunsten des Angeklagten Klehr in Betracht, dass der vom Zeugen de Ma. geschilderten Fall mit einer der vier vom Zeugen Wei. am 28.9.1942 beobachteten Tötungshandlungen identisch sein kann, so steht mit jeden Zweifel ausschliessender Sicherheit fest, dass der Angeklagte Klehr über die bereits festgestellten 253 Fälle hinaus noch mindestens drei weitere Häftlinge getötet hat.
Obwohl auf Grund der Aussage des Zeugen Wei. davon ausgegangen werden kann, dass der Angeklagte Klehr noch eine Vielzahl von Häftlingen umgebracht hat, hat sich das Gericht im Hinblick auf die unsicheren Zahlenangaben des Zeugen Wei. auf die Feststellung dieser drei weiteren Fälle beschränkt, da es seinen Feststellungen Schätzungen nicht zugrunde legen durfte.
Nach der Überzeugung des Schwurgericht steht daher mit jeden Zweifel ausschliessender Sicherheit fest, dass der Angeklagte Klehr mindestens 256 Häftlinge, die vom Lagerarzt Dr. Entress zur Tötung bestimmt worden waren, durch Phenolinjektionen getötet hat. Dass der Lagerarzt nur jüdische Häftlinge zur Tötung ausgesucht hat, hat der Angeklagte Klehr selbst erklärt. Der Grund für ihre Tötung liegt auf der Hand. Die Tatsache, dass nur jüdische Häftlinge durch Phenol getötet worden sind, und dass es sich hierbei nur um kranke und schwache Häftlinge gehandelt hat, die nicht mehr als Arbeitskräfte eingesetzt werden konnten, und dass sonst keine anderen Gründe ersichtlich sind und vom Angeklagten Klehr auch nicht behauptet werden, beweist, dass man unnütze, überflüssige Esser loswerden wollte. Man hat die jüdischen Menschen, die an sich im Rahmen der "Endlösung der Judenfrage" sowieso auf Befehl Hitlers liquidiert werden sollten, nur so lange am Leben gelassen, als sie noch Arbeit verrichten konnten. Es kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass der Angeklagte Klehr den Grund für diese Tötungsaktion gekannt hat. Denn er hat die Selektionen selbst mitgemacht und hat gesehen, dass nur kranke und schwache, im Arbeitseinsatz nicht mehr verwendbare jüdische Häftlinge vom Lagerarzt für die Tötung ausgesucht worden sind. Ihm musste es daher klar sein - und war ihm nach der Überzeugung des Gerichts auch klar -, dass die jüdischen Häftlinge nur aus Nützlichkeitserwägungen heraus, weil sie nämlich als überflüssige Esser unnütz erschienen, getötet worden sind, zumal ihm auch keine anderen Gründe für die Tötungsaktionen genannt wurden. Er hat sich auch nicht darauf berufen, den Grund für die Tötungsaktionen nicht gekannt zu haben.
Die Überzeugung und Feststellung des Gerichts, dass es dem Angeklagten Klehr unnatürliche Freude bereitet hat, die jüdischen Häftlinge durch Phenolinjektionen zu töten, beruht darauf, dass der Angeklagte Klehr - wie die Beweisaufnahme ergeben hat und im folgenden noch auszuführen sein wird - ohne Befehl eigenmächtig und selbständig Häftlinge im HKB ausgesucht und von sich aus durch Phenolinjektionen getötet hat und sich darüber hinaus damit gegenüber den Häftlingsärzten gebrüstet hat, eine gewisse Fertigkeit in dieser Tötungsart erlangt zu haben.
Auch die Tatsache, dass er sich in Abwesenheit des Lagerarztes ohne Notwendigkeit als Lagerarzt aufgespielt hat und dessen Funktionen bei den Arztvorstellern übernommen hat, zeigt, dass es ihm unnatürliche Freude gemacht hat, in der Rolle des Lagerarztes seine Macht über Leben und Tod der Häftlinge zu demonstrieren und einen Teil durch Phenolinjektionen zu töten.
3. Zu II.2a.
Der Angeklagte Klehr hat in Abrede gestellt, jemals eigenmächtig im HKB selektiert zu haben. Er wird jedoch durch die glaubhafte Aussage des Zeugen Dr. P. überführt, wiederholt eigenmächtig die Funktionen des Lagerarztes Dr. Entress bei der "Untersuchung" der Arztvorsteller übernommen zu haben. Der Zeuge Dr. P. hat glaubhaft geschildert, dass er als Schreiber im Block 21 benachrichtigt worden sei, wenn der Lagerarzt nicht zur morgendlichen "Untersuchung" der Neukranken hätte kommen können. Er habe dann dem Angeklagten Klehr gemeldet, dass der Lagerarzt nicht komme. Klehr habe dann geantwortet: "Ich bin heute Lagerarzt, ich mache heute die Arztvormelder." Er habe dann die Selektionen bei den Arztvormeldern durchgeführt und jeweils einige Häftlinge - genau wie der Lagerarzt Dr. Entress - zur Tötung ausgesucht. Anschliessend seien dann die Opfer an seinem Fenster vorbei zu Block 20 geführt und dort von Klehr mit Phenolinjektionen getötet worden.
Das Gericht hat keine Veranlassung an der Richtigkeit der Angaben des Zeugen zu zweifeln. Der Zeuge hat einen ausserordentlich zuverlässigen und glaubwürdigen Eindruck gemacht. Wiederholt hat er die Prozessbeteiligten durch sein ausgezeichnetes Gedächtnis verblüfft. Den Angeklagten Klehr kannte er gut. Denn er hatte als Häftlingsschreiber fast täglich mit ihm zu tun. Eine Verwechslungsmöglichkeit scheidet aus.
Das Gericht hat daher dem Zeugen vollen Glauben geschenkt.
Wie oft der Angeklagte Klehr solche selbständige Selektionen bei den Arztvorstellern gemacht hat, konnte der Zeuge allerdings nicht mehr angeben. Er wusste jedoch mit Bestimmtheit, dass es "mehrfach" vorgekommen ist. Das Gericht konnte daher mit Sicherheit feststellen, dass der Angeklagte Klehr mindestens zwei solcher selbständiger Selektionen bei den Arztvorstellern durchgeführt hat.
Der Zeuge wusste aus verständlichen Gründen auch nicht mehr, wieviel Häftlinge der Angeklagte Klehr bei den eigenmächtigen Selektionen für die Tötung ausgesucht und anschliessend getötet hat. Nach seiner glaubhaften Bekundung waren es jedoch stets mehrere. Es konnte daher mit Sicherheit festgestellt werden, dass Klehr bei diesen beiden Selektionen mindestens je zwei Häftlinge, also insgesamt vier Häftlinge selektiert und anschliessend durch Phenolinjektionen getötet hat.
4. Zu II.2b.
Der Angeklagte Klehr hat ferner entschieden in Abrede gestellt, nach den Selektionen der Arztvorsteller durch den Lagerarzt Dr. Entress weitere Häftlinge im HKB für die Tötung ausgesucht und mit anderen - durch den Lagerarzt ausgewählten Häftlingen - anschliessend getötet zu haben. Er wird jedoch insoweit durch die glaubhaften Aussagen der Zeugen Dr. F., Dr. Kl. und Dr. Han. überführt. Der Zeuge Dr. Kl. hat glaubhaft geschildert, dass der Angeklagte Klehr die "abgerundete Zahl" geliebt hat. Er habe häufig die Anzahl der vom Lagerarzt für die Tötung ausgesuchten Häftlinge nach oben "abgerundet", indem er durch die Krankensäle des Blockes 20 und anderer Krankenblocks gegangen sei und weitere Häftlinge für die Tötung mit Phenol ausgesucht habe. Der Zeuge Dr. Kl. war selbst als Häftlingspfleger und später als Häftlingsarzt im Block 20 eingesetzt. Er konnte daher den Angeklagten Klehr gut beobachten. Er hat nach seiner glaubhaften Schilderung wiederholt gesehen, dass Klehr zu den von ihm betreuten Kranken gekommen ist und einigen befohlen hat, sich zu den bereits im Korridor des Blockes 20 befindlichen Opfern, die auf ihre Tötung warteten, zu stellen. Es kann daher kein Zweifel bestehen, dass Klehr diese Häftlinge anschliessend auch - ebenso wie die anderen Opfer - getötet hat.
Die Aussage des Zeugen Dr. Kl. ist durch den Zeugen Han. bestätigt worden. Der Zeuge Han., von Beruf Universitätsprofessor, kam am 8.5.1942 nach Auschwitz. Am 12.5.1942 wurde er im HKB als Pfleger eingesetzt. Ausserdem hatte er die Funktion eines Hilfsleichenträgers. Wiederholt musste der Zeuge die vom Lagerarzt Dr. Entress für die Tötung ausgewählten Häftlinge zu Block 20 führen. Als Pfleger lernte er den Angeklagten Klehr zwangsläufig kennen. Auch dieser Zeuge hat glaubhaft bekundet, dass der Angeklagte Klehr nach Selektionen durch den Lagerarzt bei den Arztvorstellern wiederholt die Zahl der Opfer "aufgerundet" habe, indem er eigenmächtig Häftlinge aus dem HKB ausgesucht und zu den Opfern, die mit Phenol getötet werden sollten, gebracht habe. Schliesslich hat auch der Zeuge Dr. F. glaubhaft geschildert, dass einmal im Jahre 1942 der Angeklagte Klehr im Saal Nr.8 des Blockes 20 erschienen sei und einen Kranken ausgesucht habe. Dann habe er dem Pfleger den Befehl gegeben, den Häftling zu den im Korridor des Blockes 20 wartenden Opfern zu führen. Kurze Zeit später sei die Todesmeldung des betreffenden Häftlings gekommen.
Die Zeugen haben ihre Aussagen zu verschiedenen Zeiten völlig unabhängig voneinander gemacht. Das Gericht hat ihnen vollen Glauben geschenkt.
Die Anzahl der Opfer, die der Angeklagte Klehr auf diese Weise zur Tötung ausgesucht und anschliessend auch getötet hat, konnte nicht mehr festgestellt werden. Auch die Zeugen konnten keine sicheren und genauen Zahlenangaben machen. Da aber die Zeugen Dr. Kl. und Han. bekundet haben, dass Klehr mehrfach solche zusätzlichen Selektionen gemacht und jeweils mehr als einen Häftling zur "Abrundung" der Zahl der Opfer zur Tötung ausgewählt habe, und ausserdem der Zeuge F. unabhängig von den beiden anderen Zeugen die eigenmächtige Auswahl eines Häftlings durch den Angeklagten Klehr beobachtet hat, kann nach Auffassung des Gerichts mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass Klehr nach Selektionen durch den Lagerarzt Dr. Entress bei den Arztvorstellern mindestens weitere drei Häftlinge eigenmächtig getötet hat.
5. Zu II.2c.
Die Feststellungen unter II.2c. beruhen auf den glaubhaften Aussagen der Zeugen Dr. F. und Dr. P. Beide Zeugen haben übereinstimmend und unabhängig voneinander bekundet, dass der Angeklagte Klehr auch sonst durch den HKB gegangen sei und eigenmächtig Häftlinge für die Tötung durch Phenol ausgesucht habe. Einen konkreten Fall hat der Zeuge Dr. P. - so wie er unter II.2c. dargestellt worden ist - geschildert. In diesem Fall hat der Angeklagte Klehr nach Aussagen des Zeugen Dr. P. mehrere Opfer für den Tod bestimmt. Mit Sicherheit kann daher davon ausgegangen werden, dass er in diesem Fall mindestens zwei Häftlinge für die Tötung ausgesucht hat. Nach den gesamten Umständen kann auch nicht zweifelhaft sein, dass diese beiden Häftlinge anschliessend, sei es von Klehr selbst, sei es von einem Funktionshäftling, getötet worden sind. Da nach den Aussagen der Zeugen F. und P. solche eigenmächtige Selektionen durch Klehr mehrfach vorgekommen sind, kann ferner mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass Klehr mindestens in einem weiteren Fall selbständig Häftlinge für den Tod ausgewählt und getötet hat bzw. hat töten lassen. Da er bei solchen Selektionen stets mehr als einen Häftling ausgesucht hat, kann mit Sicherheit festgestellt werden, dass er in diesem zweiten Fall mindestens ebenfalls zwei Häftlinge zur Tötung bestimmt und getötet hat, so dass die Zahl der Opfer mindestens vier beträgt.
6. Zu II.2d.
Der Angeklagte Klehr hat energisch bestritten, am Heiligen Abend 1942 überhaupt im HKB gewesen zu sein. Abgesehen davon, dass er bereits im Juli 1942 als SDG vom HKB weggekommen sein will, hat er noch zusätzlich behauptet, dass er an Weihnachten 1942 in Urlaub gewesen sei. Zum Beweise für sein angebliches Alibi hat er sich auf das Zeugnis seiner Ehefrau berufen. Die Ehefrau des Angeklagten, die in der Hauptverhandlung als Zeugin vernommen worden ist, hat jedoch nicht bestätigt, dass ihr Ehemann an Weihnachten 1942 in Urlaub gewesen sei. Sie konnte sich nur noch erinnern, dass er an Weihnachten 1944 Urlaub gehabt habe.
Die Zeugen Dr. P., Dr. Kl. und Rei. haben übereinstimmend glaubhaft bekundet, dass der Lagerarzt Dr. Entress am Heiligen Abend 1942 bereits in Urlaub gewesen sei. Sie hätten alle im HKB aufgeatmet, weil sie gehofft hätten, dass nun niemand mehr an den Feiertagen auf unnatürliche Weise zu sterben brauche. Dann hätte aber der Angeklagte Klehr selbständig und eigenmächtig eine Selektion im HKB durchgeführt. Der Zeuge Dr. P. hat selbst gesehen, wie der Angeklagte Klehr auf Block 28 von den sog. Arztvorstellern mindestens 30 Menschen für die Tötung ausgesucht hat. Er hat dann weiter beobachtet, wie diese Menschen durch den Seiteneingang auf den Block 20 geführt worden sind. Von anderen Häftlingen hat er erfahren, dass der Angeklagte Klehr dann noch auf den Krankenblöcken Nr.19, 20 und 21 weitere Häftlinge selektiert hätte. Damals habe er von dem Schreiber des Blockes 20 erfahren, dass Klehr die Opfer selbst getötet habe. Der Zeuge Rei. musste den Angeklagten Klehr - wie er glaubhaft ausgesagt hat - am Heiligen Abend 1942 durch den Block 21 begleiten. Er hat selbst gesehen, wie Klehr allein auf Block 21 zwanzig bis dreissig Häftlinge ausgesucht hat. Der Zeuge musste die Nr. der ausgesuchten Häftlinge aufschreiben. Anschliessend wurden sie auf Block 20 geführt. Der Zeuge musste dann für alle, die nach Block 20 geführt worden waren, Todesmeldungen ausschreiben.
Schliesslich hat auch der Zeuge Dr. Kl. bestätigt, dass der Angeklagte Klehr am Heiligen Abend 1942 Dienst im HKB gehabt habe. Er konnte sich zwar nicht mehr mit Sicherheit erinnern, ob er mit eigenen Augen die Selektion am Heiligen Abend gesehen hat. Er wusste jedoch noch mit Bestimmtheit, dass am Heiligen Abend ein Berg von Leichen im Waschraum des Blockes 20 gelegen habe und dass die Leichen von zwei bis drei Rollwagen hätten weggefahren werden müssen. Auch ist damals im HKB darüber gesprochen worden, dass Klehr selektiert habe.
Auch der Zeuge Glo. konnte sich noch erinnern, dass am Heiligen Abend eine Aktion im HKB durchgeführt worden ist. Er sei darüber - so hat er in der Hauptverhandlung erklärt - sehr erschüttert gewesen. Nähere Einzelheiten konnte er allerdings nicht mehr schildern, da er sie nicht mehr im Gedächtnis hatte.
Aus all diesen Zeugenaussagen und den von den Zeugen geschilderten Umständen hat das Gericht die Überzeugung gewonnen, dass der Angeklagte Klehr am Heiligen Abend in Abwesenheit des Lagerarztes eigenmächtig eine Selektion im gesamten HKB durchgeführt und anschliessend im Zimmer Nr.1 des Blockes 20 die ausgesuchten Häftlinge durch Phenolinjektionen getötet hat.
Die Anzahl der Opfer hat der Zeuge Dr. P. mit mindestens 200 angegeben. Der Zeuge hat die Opfer zwar nicht gezählt. Er hat aber in der Häftlingsschreibstube unmittelbar nach der Tötungsaktion die Todesmeldungen der Opfer aus den verschiedenen Blocks bekommen. Der Zeuge konnte sich erinnern, dass es über 200 gewesen seien. Der Zeuge Kl. hat bestätigt, dass damals von ungefähr 200 Opfern die Rede gewesen sei. Das Gericht ist daher überzeugt, dass der Angeklagte Klehr am Heiligen Abend 1942 mindestens 200 kranke und schwache Häftlinge eigenmächtig getötet hat.
7. Zu II.3a.
Die Feststellungen unter II.3a. beruhen auf der Aussage des Zeugen Fie. Der Zeuge konnte allerdings nicht in der Hauptverhandlung vernommen werden. Das Protokoll über seine frühere polizeiliche Vernehmung vom 13.10.1960 wurde in der Hauptverhandlung verlesen. Das Gericht hat keine Veranlassung, an der Richtigkeit der Angaben des Zeugen, die er bei seiner polizeilichen Vernehmung gemacht hat, zu zweifeln. Die vom Zeugen geschilderte Tätigkeit des Angeklagten Klehr - wie sie das Gericht unter II.3a. festgestellt hat - passt in dessen Persönlichkeitsbild und stimmt mit dem sonstigen Verhalten des Angeklagten Klehr im HKB - wie es sich aus den Aussagen anderer Zeugen ergibt - überein.
Der Zeuge Fie. konnte allerdings nicht die Anzahl der vom Angeklagten Klehr ausgesuchten Opfer angeben. Er hat jedoch ausgesagt, dass der Angeklagte Klehr "mehrere" Häftlinge durch Herauslegen der Karteikarten und "mehrere Häftlinge" die an ihm im Flur vorbeigegangen seien, für den Gastod ausgesucht habe. Das bedeutet, dass der Angeklagte Klehr mindestens zwei Menschen durch Herausnehmen der Karteikarten und mindestens zwei Menschen, die an ihm im Flur vorbeigegangen sind, zur Tötung bestimmte.
Dass die Häftlinge anschliessend auch in einer der Gaskammern in Birkenau getötet worden sind, sieht das Gericht als erwiesen an. Denn nach solchen Selektionen zur Vergasung wurden die Häftlinge anschliessend stets in einer der Gaskammern in Birkenau durch Zyklon B getötet.
8. Zu II.3b.
Die Feststellungen unter II.3b. beruhen auf der Aussage des Zeugen Ga. Der Zeuge war im April/Mai 1943 als Gehilfe des Blockschreibers im Block 20 tätig. Es besteht daher kein Zweifel, dass er in dieser Funktion den Angeklagten Klehr gekannt hat. Der Zeuge hat glaubhaft geschildert, dass der Angeklagte Klehr zunächst ungeduldig auf den Lagerarzt gewartet und dann schliesslich selbst 70 holländische jüdische Menschen ausgewählt habe. Der Zeuge hat selbst gesehen, dass die Menschen noch an dem gleichen Tag weggebracht worden sind. Von der Schreibstube des HKB hat er dann erfahren, dass die Häftlinge als "überstellt" von der Lagerstärke abgesetzt worden sind. Der Zeuge Ga. hat einen glaubwürdigen Eindruck gemacht. Das Gericht hat ihm vollen Glauben geschenkt. Nach den vom Zeugen geschilderten Umständen besteht kein Anhaltspunkt dafür, dass der Angeklagte Klehr auf Befehl gehandelt hat. Das Gericht ist vielmehr überzeugt, dass der Angeklagte hier aus eigener Initiative tätig geworden ist. Das ergibt sich daraus, dass er zunächst ungeduldig auf den Lagerarzt gewartet hat. Erst als dieser nicht erschien, ist er tätig geworden. Nach der Beobachtung des Zeugen Ga. ist niemand erschienen, der ihm einen Befehl überbracht hat. Daraus folgt, dass er einfach eigenmächtig die Funktionen des Lagerarztes übernommen hat. Der Zeuge Ga. konnte sich zwar nicht persönlich davon überzeugen, dass die 70 ausgesuchten Häftlinge anschliessend auch tatsächlich getötet worden sind. Aus der Tatsache, dass die 70 Häftlinge nach Birkenau "überstellt" worden sind, ist jedoch gefolgert worden, dass sie in Birkenau durch Gas getötet worden sind. Der Angeklagte Klehr hat selbst eindeutig während der Aussage des Zeugen Ga. erklärt, dass "Überstellung" nach Birkenau "Liquidierung" bedeutet habe. Das Gericht ist daher davon überzeugt, dass der Angeklagte Klehr die 70 Häftlinge in vollem Bewusstsein, dass sie anschliessend getötet würden, ausgesucht hat und dass die 70 noch am gleichen Tage in einer der Gaskammern in Birkenau durch Zyklon B getötet worden sind.
9. Zu II.4.
Die Feststellungen unter II.4. beruhen ebenfalls auf der glaubhaften Aussage des Zeugen Ga. Der Zeuge hat diesen Fall, der zeitlich etwa ein Jahr vor dem unter II.3b. geschilderten Fall liegt, selbst miterlebt. Er befand sich nach seiner glaubhaften Aussage unter den Schonungskranken im Block 20. Er wurde mit nach Birkenau transportiert und in Block 4 (dem späteren Block 7) im Lagerabschnitt B I untergebracht. Die Behandlung der Häftlinge in diesem Block, die der Zeuge so geschildert hat, wie sie unter II.4. dargestellt worden ist, spricht eindeutig dafür, dass es sich bei der Verbringung der 300 Häftlinge nach Birkenau um eine "Überstellung" d.h. um eine Verlegung zum Zwecke der "Liquidierung" gehandelt hat. Damals waren die Gaskammern in den Bauernhäusern noch nicht gebaut und die neuen Krematorien noch nicht errichtet. Daher hat man die Häftlinge durch Hunger, Appellstehen und sonstige Schikanen "liquidiert". Dass der Zweck der Überstellung der 300 Häftlinge ihre Tötung war und dass man in Birkenau Häftlinge durch Hunger, Appellstehen und sonstige Schikanen bewusst töten wollte, folgt auch daraus, dass innerhalb der kurzen Zeit von 13 Tagen (vom 20.4. bis 3.5.1942) 280 Häftlinge gestorben sind. Der Zeuge Ga. wurde nur gerettet, weil er heimlich Brot von einem Arzt zugesteckt bekam. Sonst wäre er auch Hungers gestorben. Sein Leben wurde schliesslich nur gerettet, weil sich andere Häftlinge im Stammlager für seine Rettung eingesetzt haben. Dass die 300 Häftlinge "liquidiert" werden sollten, ergibt sich schliesslich auch daraus, dass die Karteikarten der Häftlinge, insbesondere auch des später geretteten Zeugen Ga. sofort aus der Kartei der Lebenden in die sog. Totenkartei abgelegt worden sind. Man hat im Stammlager also die überstellten Häftlinge bereits als tot gemeldet und als Tote geführt.
Das Gericht ist auch überzeugt, dass der Angeklagte Klehr gewusst hat, dass die 300 Häftlinge "liquidiert" werden sollten. Nach seiner eigenen Einlassung war ihm klar, dass "Überstellung" Tötung bedeutete. Er hat dem Zeugen Ga. nicht glauben wollen, dass er von Birkenau wieder hat nach Auschwitz zurückkommen können. Unmittelbar nach der Schilderung des Zeugen hat er spontan erklärt, dass jemand, der von Auschwitz I nach Birkenau "überstellt" worden sei, nicht mehr hätte zurückkommen können. Das sei unmöglich gewesen. Denn Überstellung sei gleichbedeutend mit "Liquidierung" gewesen. Daraus folgt, dass der Angeklagte Klehr damals genau darüber im Bilde war, dass die 300 Häftlinge getötet werden sollten und dass er in diesem Bewusstsein beim Abtransport der Häftlinge mitgewirkt hat. Andererseits kann aus der Erklärung des Angeklagten Klehr nicht gefolgert werden, dass der Zeuge Ga. unglaubwürdig sei und die Schilderung seines eigenen Schicksals nur erfunden habe. Der Zeuge hat eine einleuchtende Begründung dafür gegeben, dass es für ihn damals möglich gewesen ist, mit dem Leben davonzukommen und wieder nach Auschwitz I zurückzukehren. Es erscheint durchaus glaubhaft, dass Häftlinge es fertig gebracht haben, ihn vor dem Tode zu erretten und wieder nach dem Stammlager zurückzubringen. Im Stammlager konnten Häftlinge durch List und Bestechung von SS-Angehörigen - wie sich aus den Aussagen vieler Zeugen ergeben hat - nicht selten Kameraden vom Tode erretten.
10. Zu II.5.
Der Angeklagte Klehr hat nicht in Abrede gestellt, dass am 29.8.1942 die Infektionskranken aus dem Block 20 und der dazugehörigen Baracke mit LKWs zur Vergasung nach Birkenau gebracht und dort durch Zyklon B getötet worden sind. Er hat sich jedoch dahin eingelassen, dass er bei der Räumung des Blockes 20 nicht als SDG sondern nur als Desinfektor tätig geworden sei. Er habe den Block 20 nach der Räumung desinfizieren müssen. Mit dem Abtransport der Kranken in die Gaskammer habe er nichts zu tun gehabt.
Seine Einlassung wird jedoch widerlegt, durch die glaubhaften Aussagen der Zeugen Barc., Han., P., Glo. und Dr. Kl., auf denen die Feststellungen unter II.5. beruhen. Alle diese Zeugen haben übereinstimmend bekundet, dass der Angeklagte Klehr als SDG dem Lagerarzt Dr. Entress assistiert und scharf aufgepasst habe, dass keiner der für die Vergasung bestimmten Menschen gerettet werde. Der Zeuge P. hat darüber hinaus ausgesagt, dass der Angeklagte Klehr beim Abtransport die Nummern der Opfer überprüft und darauf geachtet habe, dass keiner der für die Vergasung vorgesehenen Häftlinge zurückblieb. Der Zeuge Glo. hat nach seiner glaubhaften Bekundung beobachtet, dass Klehr beim Abtransport der Opfer besonders eifrig gewesen ist und Kranke und Widerstrebende brutal und unmenschlich auf die LKWs gezerrt hat.
Die Anzahl der Opfer betrug nach der Überzeugung des Gerichts mindestens 700. Der Zeuge Dr. P., der nach der Aktion die Todespapiere für die Opfer ausfertigen musste, hat erklärt, dass nach seiner Erinnerung ca. 800 Häftlinge von der Lagerstärke "abgesetzt" worden seien. Der Zeuge Dr. F. hat gemeint, es seien zwischen 700 und 800 Opfer gewesen. Der Zeuge Glo. hat die Anzahl der Toten auf etwa 700 geschätzt. Auch der Zeuge Woy. hat gemeint, dass die Zahl der Opfer 800 betragen habe. Der Zeuge So., der damals als Koch in der Küche beschäftigt gewesen ist, hat mit Bestimmtheit erklärt, dass ihm damals nach der Aktion 832 Portionen in der Küche übrig geblieben seien. In den nächsten Tagen seien dann jeweils täglich 100 Häftlinge von der Verpflegungsstärke abgesetzt worden, bis die Zahl 832 erreicht gewesen sei. Die Aussagen der Zeugen So. und Dr. P. verdienen bezüglich der Anzahl der Opfer den Vorzug vor den Aussagen der übrigen Zeugen, weil sie für ihre Zahlenangaben damals sichere Grundlagen gehabt haben, während die übrigen Zeugen die Opfer nur geschätzt haben. Um jedoch alle möglichen Unsicherheiten auszuschalten, ist das Gericht nur von einer Mindestzahl von 700 Opfern ausgegangen.
Die Feststellung, dass der Angeklagte Klehr gewusst hat, dass die Infektionskranken in einer der Gaskammern getötet werden sollten und dass er auch den Grund für ihre "Liquidierung" gekannt hat, ergibt sich aus der gesamten damaligen Situation. Die genannten Zeugen haben bereits damals als Funktionshäftlinge über die Hintergründe der Vernichtungsaktionen Bescheid gewusst. Sie können daher auch dem Angeklagten Klehr nicht verborgen geblieben sein. Er bestreitet auch gar nicht, bereits damals über den Grund und die Durchführung der Vernichtungsaktion informiert gewesen zu sein. Er leugnet lediglich, daran beteiligt gewesen zu sein.
11. Zu II.6a.
Die Feststellungen unter II.6a. beruhen auf der glaubhaften Aussage des Zeugen Lil. Der Angeklagte Klehr bestreitet, jemals in das kleine Krematorium Zyklon B eingeworfen zu haben, wie er überhaupt in Abrede stellt, jemals etwas mit den Vergasungen zu tun gehabt zu haben. Der Zeuge Lil. hat glaubhaft geschildert, dass er mit eigenen Augen gesehen habe, wie Klehr mit Gehilfen auf das flache Dach des kleinen Krematoriums gestiegen sei, seine Gasmaske aufgesetzt und nach Öffnung der Zyklon B Büchsen deren Inhalt in die Einfüllstützen des Krematoriums hineingeschüttet habe. Jedesmal habe er Sekunden später das erstickte Geschrei der eingeschlossenen Menschen gehört. Das habe er etwa 30 bis 40mal vom Fenster seines Arbeitsraumes aus gesehen. Das Schwurgericht hat dem Zeugen Lil. geglaubt, Er war in der Schreibstube des SS-Reviergebäudes beschäftigt. Das SS-Reviergebäude befand sich unmittelbar gegenüber dem kleinen Krematorium. Das Fenster der Schreibstube, in der der Zeuge tätig war, zeigte auf das kleine Krematorium. Der Zeuge konnte daher die Vorgänge am kleinen Krematorium gut beobachten. Er konnte auch die Menschen, die auf das Dach des kleinen Krematoriums gestiegen sind, erkennen. Denn die Entfernung war gering. Den Angeklagten Klehr kannte der Zeuge aus seiner Tätigkeit in der Schreibstube des Standortarztes gut. Eine Verwechslungsmöglichkeit scheidet aus.
Im übrigen war das Einwerfen des Zyklon B im Jahre 1942, als Klehr noch nicht Leiter des Desinfektionskommandos war und noch kein besonderes Vergasungskommando bestand, Sache des SDGs.
Bei den Vergasungen muss es sich um Aktionen in der ersten Hälfte des Jahre 1942 gehandelt haben. Denn später - ab Sommer 1942 - wurden die jüdischen Menschen in den Gaskammern der umgebauten Bauernhäuser und ab 1943 in den Gaskammern der neuen Krematorien getötet. Die Aussage des Zeugen Lil., dass eine grosse Anzahl von Vergasungen im kleinen Krematorium stattgefunden hätte, findet auch ihre Bestätigung in der Aussage des Zeugen Mü., die bereits bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten St. gewürdigt worden ist. Da der Zeuge Lil. keine präzisen Zahlenangaben machen konnte, sondern die Zahl der von ihm beobachteten Vergasungen, an denen der Angeklagten Klehr beteiligt war, nur geschätzt hat, hat sich das Gericht darauf beschränkt, von einer unbestimmten Anzahl von Vernichtungsaktionen im kleinen Krematorium, bei denen der Angeklagten Klehr selbst das Gas eingeschüttet hat, mindestens eine Vergasung als sicher festzustellen. Bei dieser Vergasung ist eine unbestimmte Anzahl von jüdischen Menschen getötet worden. Mindestens waren es nach der Überzeugung des Gerichts 50. Denn man hat nie weniger als 50 Personen durch das Gas getötet, weil sich nach damaliger Auffassung der erforderliche Aufwand für die "Liquidierung" durch Gas von weniger als 50 Personen nicht "gelohnt" hat. Kleinere Gruppen wurden erschossen.
12. Zu II.6b.
Der Angeklagte Klehr hat eingeräumt, dass er Chef des Desinfektionskommandos gewesen sei. Wie er behauptet, soll ihm die Leitung dieses Kommandos bereits im Juli 1942 übertragen worden sein. Er hat jedoch behauptet, dass das Desinfektionskommando mit der Tötung von Menschen durch Zyklon B nichts zu tun gehabt habe. Allerdings hätten zu seinem Desinfektionskommando - so hat er sich weiter eingelassen - vier SS-Männer gehört, deren Aufgabe es gewesen sei, das Zyklon B in die Gaskammern zu werfen. Dieses Vergasungskommando sei jedoch unabhängig von dem Desinfektionskommando gewesen. Die vier Männer hätten sich im "Vergasungsdienst" automatisch abgewechselt. Je zwei oder vier Männer hätten jeweils 24 Stunden Bereitschaftsdienst gehabt und hätten während dieser Zeit, wenn RSHA-Transporte angekommen seien, das Zyklon B in die Gaskammern einschütten müssen. Die beiden anderen SS-Männer, die frei gehabt hätten, hätten in seinem Desinfektionskommando Dienst verrichten müssen. Dann hätte er - der Angeklagte - wegen irgend eines Zwischenfalles auf Befehl des Spiesses beim Standortarzt, O., für die vier Männer einen Dienstplan aufstellen müssen. Er habe dann die vier Männer auf einem schriftlichen Dienstplan so eingeteilt, dass jeweils zwei SS-Männer Bereitschafts- und Vergasungsdienst während 24 Stunden gehabt hätten, während die beiden anderen in seinem Desinfektionskommando Dienst hätten machen müssen.
Er selbst sei jedoch nie bei den Krematorien gewesen. Nur ein einziges Mal habe er ein Krematorium besichtigt, als es noch nicht in Betrieb gewesen sei.
Die Einlassung des Angeklagten Klehr, er habe mit den Vergasungen in den Gaskammern nichts zu tun gehabt und er sei nie bei den Gaskammern in Birkenau gewesen, ist unglaubhaft. Schon die Tatsache, dass er einen Dienstplan für die Männer des Vergasungskommandos aufstellen musste, beweist, dass ihm das gesamte Vergasungskommando unterstand und dass er für den Einsatz der Männer dieses Kommandos verantwortlich war. Es wäre auch ungewöhnlich, wenn ein aus gleichrangigen SS-Männern bestehendes Kommando ohne Kommandoführer gewesen wäre. In jedem militärischen oder militärähnlichen Verband hat jede, auch die kleinste Einheit einen Führer, der dem nächst höheren Vorgesetzten gegenüber für die Durchführung der von der Einheit auszuführenden Aufträge verantwortlich ist. Es liegt auch nahe, dass man den Angeklagten Klehr, der als Chef des Desinfektionskommandos im Umgang mit Zyklon B besonders erfahren war, da die Baracken ebenfalls mit Zyklon B entwest wurden, auch zum Chef des Vergasungskommando bestimmt hat.
Dass der Angeklagte Klehr Chef des Vergasungskommandos gewesen ist und wiederholt in dieser Funktion auch zur Vergasung von Menschen zu den Gaskammern gefahren ist, um dort die Arbeit der ihm unterstellten Männer zu beaufsichtigen, wenn nicht sogar, um selbst das Zyklon B einzuwerfen, ergibt sich im übrigen aus folgendem:
In seinem bereits mehrfach erwähnten Bericht aus dem Jahre 1945 hat der Angeklagte Broad bei der Schilderung einer Fahrt der Desinfektoren im Sanka zu einer Vergasung in einem der umgebauten Bauernhäuser den Namen des Angeklagten Klehr ausdrücklich angeführt. Nach der Schilderung des Angeklagten Broad sass Klehr vorne neben dem Fahrer des Sanka, während die anderen Desinfektoren auf den Seitenbänken im hinteren Raum des Sanka mitfuhren. Mit dem Sanka wurden nach dem Bericht des Angeklagten Broad auch die Büchsen Zyklon B befördert. Das Gericht ist überzeugt, dass die Schilderung des Angeklagten Broad zutreffend ist. Es ist kein Grund ersichtlich, warum Broad im Jahre 1945, als er die Geschehnisse in Auschwitz noch in guter Erinnerung gehabt haben muss, den Angeklagten Klehr wahrheitswidrig belastet haben sollte.
Die Tatsache, dass der Angeklagte Klehr in dem Sanka, in dem die Büchsen Zyklon B befördert wurden und in dem die Angehörigen des Vergasungskommandos zu einer Vergasung in Birkenau gebracht wurden, gefahren ist und zudem neben dem Beifahrer gesessen hat, spricht eindeutig dafür, dass er Chef des Vergasungskommandos gewesen ist und auch mit zu den Vergasungen zur Beaufsichtigung der ihm unterstellten SS-Männer, die das Gas einzuschütten hatten, gefahren ist.
Die Überzeugung des Gerichts von der Funktion des Angeklagten Klehr bei Vergasungen von Menschen wird auch noch durch folgendes gestützt: Der Zeuge Dr. Loeb., der als Häftling im Stammlager in Auschwitz gewesen ist, hatte einen guten Bekannten unter den Häftlingen namens Dr. Sperber. Dieser war im Desinfektionskommando des Angeklagten Klehr. Bei der Entwesung von Baracken und Kleidungsstücken half er mit. Wie der Zeuge Dr. Loeb. glaubhaft bekundet hat, hat ihm der Häftling Dr. Sperber damals im Lager erzählt, dass Klehr auch das Gas in die Gaskammern einwerfe.
Der Zeuge Am. war ebenfalls im Desinfektionskommando des Angeklagten Klehr. Der Zeuge hat zwar nicht selbst gesehen, dass sich der Angeklagte Klehr an den Gaskammern betätigt oder in ihrer Nähe während der Vergasungen aufgehalten hat. Er hat aber - nach seiner glaubhaften Aussage - wiederholt erlebt, dass Klehr morgens mit anderen Desinfektoren zum Dienst gekommen ist und dass sie sich untereinander über ihren Dienst in der vergangenen Nacht unterhalten haben. Oft seien sie morgens schon - so hat der Zeuge glaubhaft berichtet - betrunken gewesen. Auch das spricht dafür, dass Klehr Chef des Vergasungskommandos gewesen ist und Dienst an der Gaskammer gemacht hat. Ferner hat der Zeuge Sik., der den Angeklagten Klehr gut gekannt hat, weil er in der Apotheke des SS-Reviergebäudes, in dem auch der Angeklagte Klehr ein Jahr lang untergebracht war, gearbeitet hat, gemeint, dass Klehr Chef des Vergasungskommandos gewesen sei. Der Zeuge Gol. hat bekundet, dass zu den Aufgaben des Desinfektionskommandos, dessen Leiter der Angeklagte Klehr gewesen sei, auch die Vergasungen in den Gaskammern gehört hätten. Die Entwesung der Baracken und der Kleidungsstücke sei nur eine "Nebentätigkeit" gewesen. Schliesslich haben die Zeugen Gol., Py., Sik., Lil. und Dr. F. übereinstimmend glaubhaft bekundet, dass der Angeklagte Klehr laufend Zusatzverpflegung in Form von Milch, Butter, Bonbons, Jamaika-Rum, Schnaps und Zigaretten erhalten hätte. Der Zeuge Dr. F. konnte sich noch genau erinnern, dass der Angeklagte Klehr stets die Zusatzverpflegung "wegen seiner Tätigkeit in Birkenau" durch Häftlinge schriftlich habe anfordern lassen. Nach der Erinnerung dieses Zeugen hat dann der Angeklagte Klehr auch die Zusatzverpflegung "wegen seiner Tätigkeit in Birkenau" erhalten. Auch das spricht dafür, dass der Angeklagte Klehr laufend mit den Vergasungen von Menschen zu tun gehabt haben muss.
Wenn auch kein Zeuge den Angeklagten Klehr bei seiner Tätigkeit an den Gaskammern in Birkenau hat beobachten können, so ist das Gericht auf Grund der angeführten Beweismittel und Beweisanzeichen doch davon überzeugt, dass der Angeklagte Klehr Chef des Vergasungskommandos gewesen ist und in dieser Funktion wiederholt Dienst an den Gaskammern in Birkenau verrichtet hat, indem er zumindest die ihm unterstellten SS-Männer beim Einschütten des Zyklon B beaufsichtigt und durch seine Anwesenheit für einen reibungslosen Ablauf der Vernichtungsaktionen mit gesorgt hat.
Wie oft der Angeklagte Klehr bei den Gaskammern in Birkenau gewesen ist, konnte nicht festgestellt werden. Da er jedoch laufend Zusatzverpflegung erhalten hat und nach der Aussage des Zeugen Am. wiederholt morgens mit seinen ihm unterstellten SS-Männern über den Dienst in der vergangenen Nacht gesprochen hat, kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass der Angeklagte Klehr mehr als einmal, also mindestens zweimal, Dienst an einer der Gaskammern in Birkenau verrichtet hat. Es lag auch in der Natur seiner Funktion als Leiter des Vergasungskommandos, dass er sich mehr als einmal um den Einsatz seiner Männer an den Gaskammern persönlich kümmern musste.
In diesen beiden Fällen sind mindestens jeweils 750 Menschen getötet worden. Diese Feststellung beruht darauf, dass RSHA-Transporte, die in den Gaskammern in Birkenau getötet wurden, jeweils mindestens 1000 Personen stark waren. Zieht man hiervon 25% ab, die höchstens in das Lager aufgenommen worden sein können, so ergibt sich die Anzahl von 750 Menschen, die durch Zyklon B getötet worden sind.
13. Zu II.7.
Die Feststellungen unter II.7. beruhen auf der glaubhaften Aussage des Zeugen Gol. Der Zeuge hat das Geschehen im Hof des kleinen Krematoriums und an dem kleinen Krematorium - wie es unter II.7. dargestellt worden ist - aus dem SS-Reviergebäude durch ein Fenster beobachtet. Er hat - wie er glaubhaft bekundet hat - gesehen, wie der Angeklagte Klehr mit zwei anderen SS-Männern am kleinen Krematorium gestanden hat. Nachdem die Häftlinge des Sonderkommandos in die Gaskammer hineingeführt worden waren, hat er weiter beobachtet, wie der Angeklagte mit bestimmten Körperbewegungen durch Zeichen die SS-Männer auf das Dach des kleinen Krematoriums geschickt und wie diese nach seinen Anweisungen das Zyklon B unter dem Schutz von Gasmasken eingeschüttet haben.
Der Zeuge kannte den Angeklagten Klehr sehr gut. Denn er hat eine Zeitlang das Zimmer des Angeklagten Klehr gereinigt und ihm persönliche Dienste (wie Stiefel putzen) geleistet. Eine Verwechslungsmöglichkeit scheidet daher aus. Der Zeuge konnte aus dem SS-Reviergebäude auch die am kleinen Krematorium stehenden Personen erkennen. Denn die Entfernung zwischen dem kleinen Krematorium und dem SS-Reviergebäude, die einander gegenüberlagen, war gering. Anhaltspunkte dafür, dass der Zeuge den Angeklagten Klehr wider besseres Wissen hat belasten wollen, liegen nicht vor. Der Zeuge hat einen glaubwürdigen Eindruck hinterlassen. Im übrigen passt die vom Zeugen Gol. geschilderte Tätigkeit des Angeklagten Klehr in den Rahmen des vom Zeugen Lil. beobachteten Dienstes des Angeklagten Klehr an der Gaskammer.
Dass es sich bei den Opfern um 200 Angehörige des jüdischen Sonderkommandos gehandelt hat, hat der Zeuge Gol. von anderen Häftlingen unmittelbar nach der Aktion erfahren. Dafür spricht auch, dass die Häftlinge geahnt haben müssen, was ihnen bevorstand. Denn sonst hätten sie sich nicht geweigert, sich zu entkleiden. Glaubhaft und überzeugend erscheint auch, dass man die Häftlinge des Sonderkommandos nicht in Birkenau, sondern im kleinen Krematorium getötet hat. Man hat nie in einer der Gaskammern in Birkenau Angehörige des jüdischen Sonderkommandos getötet. Die Zeugen Mü. und Pa., die in diesem Sonderkommando gearbeitet haben, haben das nie erlebt. Sie hätten es wissen müssen, wenn es vorgekommen wäre. Offenbar hat man sich aus Tarnungsgründen gescheut, die Angehörigen des Sonderkommandos in den Gaskammern von Birkenau zu töten. Wahrscheinlich hat man Unruhe bei den Überlebenden anderen Angehörigen des Sonderkommandos befürchtet, die ja ihre Kameraden genau kannten. Die Vergasung im kleinen Krematorium konnte man vor den überlebenden jüdischen Angehörigen des Sonderkommandos in Birkenau, die isoliert und ohne Verbindung mit anderen Häftlingen waren, geheim halten. Das Schwurgericht hat aber keinen Zweifel, dass man dem Zeugen Gol. zutreffend berichtet hat.
Auch der Zeuge Py. hat von einer Vergasung von 200 Personen im kleinen Krematorium berichtet. Auch dieser Zeuge hat den Angeklagten Klehr bei der Vergasung gesehen. Allerdings konnte nicht mit Sicherheit geklärt werden, ob es sich bei dieser Vergasung um die gleiche gehandelt hat, die der Zeuge Gol. geschildert hat. Der Zeuge Py., der das Geschehen nur beschränkt beobachten konnte, hat nicht von Häftlingen des jüdischen Sonderkommandos gesprochen. Er hat bekundet, dass die Opfer mit verdeckten LKWs angekommen seien. Wahrscheinlich hat es sich um jüdische Zivilisten gehandelt. Der Zeuge konnte die Opfer nicht mehr auf dem Hof des kleinen Krematoriums beobachten. Möglicherweise hat es sich um eine der Vergasungen gehandelt, von denen bereits der Zeuge Lil. berichtet hat. Das Gericht hat daher auf Grund der Aussage des Zeugen Py. keine weiteren Feststellungen treffen können.
14. Zu II.8a.
Der Angeklagte Klehr bestreitet, den Häftling Fedor getötet zu haben.
Er wird jedoch durch die glaubhafte Aussage des Zeugen Han. überführt, auf dessen Aussage die Feststellungen unter II.8a. beruhen.
Der Zeuge hat geschildert, dass der Angeklagte Klehr den jüdischen Häftling Fedor im Röntgenraum des Blockes 28 beim Schlafen überrascht habe und ihm sofort befohlen habe, in den Operationssaal hineinzugehen. Der Zeuge Han. hat zwar nicht selbst gesehen, wie der Angeklagte Klehr den Häftling durch eine Phenolinjektion getötet hat. Der Zeuge hat aber Umstände geschildert, aus denen das Gericht die Überzeugung gewonnen hat, dass der Angeklagte Klehr den Häftling Fedor selbst durch eine Phenolinjektion umgebracht hat. Fedor ist nach der glaubhaften Aussage des Zeugen als gesunder Mensch in den Operationssaal hineingegangen. Unmittelbar danach hat der Angeklagte Klehr den Operationssaal betreten. Später hat der Zeuge die Leiche des Fedor im Operationssaal liegen sehen. Er musste sie am Abend wegtragen.
15. Zu II.8b.
Der Angeklagte Klehr bestreitet ferner, eine Häftlingsfrau auf Block 28 durch eine Phenolinjektion getötet zu haben. Er wird jedoch insoweit durch die glaubhafte Aussage des Zeugen Kremer überführt. Der Zeuge Kremer hat glaubhaft geschildert, dass der Angeklagte Klehr in der Zeit zwischen August 1942 und Mitte November 1942 einmal mit einem Arztmantel bekleidet in seiner Gegenwart eine Häftlingsfrau, der er vorgespiegelt hatte, sie sei herzkrank, eine Phenolinjektion unmittelbar in das Herz gegeben und dadurch getötet habe. Die Frau habe sich die Injektion ohne weiteres geben lassen. Er - der Zeuge - habe sich das auf Befehl des Standortarztes ansehen müssen. Er sei aber nach der Tötung dieser einen Frau unter Protest weggelaufen. Man habe damals gemunkelt, dass 5-6 Frauen, die eine Revolte gemacht hätten, auf diese Weise getötet worden seien.
Die Aussage des Zeugen wird bestätigt durch eine Eintragung, die der Zeuge in seinem im Jahr 1942 geführten persönlichen Tagebuch gemacht hat. Unter dem 24.10.1942 befindet sich folgende Eintragung, die das Gericht aus dem Original des Tagebuches gemäss §249 StPO verlesen hat:
24.Oktober 1942: 6 Frauen von der Budyer Revolte abgeimpft (Klehr).
Nach der Überzeugung des Gerichts hat es sich bei der getöteten Frau um eine deutsche Arbeitsanweiserin (Häftlingsfrau) aus dem Nebenlager Budy gehandelt, die man nach einer Schlägerei mit anderen Häftlingsfrauen nach dem Stammlager verbracht hat. Das ergibt sich aus der erwähnten Eintragung des Zeugen Kremer in seinem Tagebuch und dem sog. Broad-Bericht aus dem Jahre 1945, in dem der Angeklagte Broad von einer Schlägerei in Budy berichtet hat, nach der einige der weiblichen Kapos und Arbeitsanweiserinnen im Stammlager durch Phenolinjektionen getötet worden seien.
Aus der Tatsache, dass die Frau heimlich und unter Vorspiegelung, sie sei herzkrank, von dem Angeklagten Klehr durch eine Phenolinjektion getötet worden ist, hat das Gericht die Überzeugung gewonnen, dass die Frau ohne ein Gerichtsurteil getötet worden ist. Hätte ein Urteil vorgelegen, wäre es öffentlich vollstreckt worden, wie auch sonst Häftlinge im KL durch Erhängen vor dem gesamten angetretenen Lager getötet worden sind, wenn Vollstreckungsbefehle höherer Dienststellen vorlagen. Aus den gesamten Umständen, wie die Frau getötet worden ist, insbesondere daraus, dass ihr der Angeklagte Klehr vorgespiegelt hat, sie sei herzkrank und müsse deswegen die Spritze erhalten, hat das Gericht ferner die Überzeugung gewonnen, dass der Angeklagte Klehr auch gewusst hat, dass gegen die Frau kein Todesurteil vorlag.
16. Zu II.8c.
Die Feststellungen unter II.8c. beruhen auf der glaubhaften Aussage des Zeugen Glo., der mit eigenen Augen gesehen hat, wie der Angeklagte Klehr den russ. Politkommissar getötet hat. Auch hier hat das Gericht aus der Art der Tötung, die heimlich durchgeführt wurde, die Überzeugung gewonnen, dass gegen den russ. Kommissar kein Todesurteil vorgelegen haben kann. Das war auch dem Angeklagten Klehr nach der Überzeugung des Gerichts auf Grund der gesamten Umstände klar.
17. Zu II.8d.
Die Feststellungen unter II.8d. beruhen ebenfalls auf der Aussage des Zeugen Glo. Der Zeuge Glo. war allerdings nicht Augenzeuge der Tötung der beiden Frauen. Er hat aber die Leichen der beiden Frauen im Zimmer Nr.1 des Blockes 20 liegen sehen. Der Pförtner des Blockes 20 hat ihm bereits damals berichtet, dass die beiden Frauen zuvor gesund durch den Haupteingang des Blockes 20 in das Zimmer Nr.1 hineingegangen seien. Der Angeklagte Klehr sei in diesem Zimmer gewesen und habe dann das Zimmer durch den Haupteingang wieder verlassen. Das Gericht ist überzeugt, dass der Pförtner dem Zeugen Glo. damals zutreffend berichtet hat. Der Zeuge Glo. konnte die Tötung selbst nicht sehen, weil er - wie er glaubhaft ausgesagt hat - auf dem Flur des Blockes 20 hinter dem Vorhang gewesen ist und somit auch nicht sehen konnte, wie der Angeklagte Klehr den Block 20 und das Zimmer Nr.1 betreten hat. Aus den vom Pförtner dem Zeugen Glo. berichteten Umständen und aus der Tatsache, dass die Leichen der beiden Frauen im Zimmer Nr.1, in dem der Angeklagte Klehr Häftlinge durch Phenolinjektionen zu töten pflegte, gelegen haben, hat das Gericht die Überzeugung gewonnen, dass der Angeklagte Klehr die beiden Frauen durch je eine Phenolinjektion getötet hat.
Die Hintergründe für die Tötung der beiden Frauen konnten nicht aufgeklärt werden. Da die beiden Frauen jedoch in aller Heimlichkeit getötet worden sind, bestehen nach der Überzeugung des Gerichts keine Zweifel, dass kein Todesurteil gegen die beiden Frauen vorgelegen haben kann und dass dies dem Angeklagten Klehr auch bewusst gewesen ist.
18. Zu II.8e.
Die Feststellungen unter II.8e. beruhen ebenfalls auf der glaubhaften Aussage des Zeugen Glo. Der Zeuge hat selbst beobachtet, wie der Angeklagte Klehr den jüdischen Häftling Samson mit einem Schürhaken misshandelt und ihn, nachdem er zusammengebrochen war, lebend auf das Zimmer Nr.1 im Block 20 hat bringen lassen. Später hat der Zeuge F. - wie er glaubhaft bekundet hat - die Leiche des jüdischen Arztes Samson im Leichenkeller des Blockes 20 liegen sehen. Daraus ergibt sich zur Überzeugung des Gerichts, dass der Angeklagte Klehr auch diesen Häftling durch eine Phenolinjektion auf seinem Zimmer, in dem er Häftlinge durch Phenol zu töten pflegte, getötet hat.
IV. Rechtliche Würdigung
1. Zu II.1.
Die Tötung der kranken und schwachen Häftlinge durch Phenolinjektionen war Mord. Denn sie erfolgte aus niedrigen Beweggründen. Nach den getroffenen Feststellungen wurden die Häftlinge, die der besonderen Pflege und Fürsorge bedurft hätten, nur deswegen beseitigt, weil sie nicht mehr nützlich erschienen und man sie als unnütze Esser loswerden wollte. Für die Tötungen waren also reine Nützlichkeitserwägungen massgebend. Ein solcher Beweggrund ist sittlich verachtenswert und steht auf tiefster sittlicher Stufe. Es gilt hier das gleiche, was bereits bei der Tötung von Häftlingen durch Gas nach sog. Lagerselektionen ausgeführt worden ist (vgl. oben J.IV.1.).
Es kann dahingestellt bleiben, ob die Tötungen auch heimtückisch erfolgt sind. Für einen Teil der Opfer ist dies ohne Zweifel zu bejahen. Denn nach den getroffenen Feststellungen ahnten viele der kranken und schwachen Häftlinge nicht, was ihnen bevorstand. Sie glaubten, sie würden im Block 20 behandelt. Durch den Vorhang im Korridor des Blockes 20 verbarg man ihnen, was im Zimmer Nr.1 geschah. Sie gingen daher ahnungslos in dieses Zimmer hinein. Wenn sie noch nicht durch die umlaufenden Gerüchte von den Phenoltötungen gehört hatten, mussten sie noch im Zimmer Nr.1 nach den gesamten Umständen (Arztzimmer, ärztliche Instrumente, ärztliche Kleidung) annehmen, dass sie behandelt werden sollten. Sie waren daher auch wehrlos, ganz abgesehen davon, dass sie meist so krank und schwach waren, dass sie sich gar nicht mehr hätten wehren können. Diese Arg- und Wehrlosigkeit hat der Angeklagte Klehr bewusst ausgenutzt. Andererseits wusste ein Teil der Opfer aus Gesprächen, die im Lager über die Vorgänge im Block 20 geführt wurden, welches Schicksal ihnen bevorstehen könnte, wenn sie sich vielleicht auch nicht sicher darüber waren. Sie ergaben sich apathisch in ihr nicht mehr abwendbares Los. Bei ihnen kann daher nicht mehr von einer Arglosigkeit gesprochen werden. Da jedoch nicht mehr aufzuklären war, welche Opfer arglos waren und welche nicht, kann auch nicht mit Sicherheit festgestellt werden, bei welchen Opfern die tatsächlichen Voraussetzungen einer heimtückischen Tötung vorlagen. Das Gericht hat daher die Frage, ob die 256 jüdischen Menschen auch heimtückisch getötet worden sind, offengelassen.
Der Angeklagte Klehr hat bereits bei der Auswahl der Opfer durch den Lagerarzt durch seine geschilderte Mitwirkung einen kausalen Tatbeitrag zu ihrem Tod geleistet. Anschliessend hat er ihnen dann eigenhändig die Phenolinjektionen gegeben und damit bewusst und gewollt eine entscheidende Ursache für ihren Tod gesetzt. Bei der Auswahl der Opfer hat er auf Befehl des Lagerarztes mitgewirkt. Zu seinen Gunsten muss auch davon ausgegangen werden, dass er die mindestens 256 Häftlinge auf Befehl des Lagerarztes getötet hat. Da er Angehöriger der Waffen-SS gewesen ist, findet §47 MStGB Anwendung. Der Angeklagte Klehr hat auch klar erkannt, dass die Tötung unschuldiger jüdischer Menschen ein allgemeines Verbrechen war, und dass der ihm gegebene Befehl, dabei in der geschilderten Weise mitzuwirken, ein allgemeines Verbrechen bezweckte. Denn die Tötung unschuldiger, kranker und schwacher Häftlinge, nur um sie als unnütze Esser zu beseitigen, ist ein so krasser Verstoss gegen die auch dem primitivsten Menschen bewussten Grundsätze über das Recht eines jeden Menschen auf sein Leben, dass der Angeklagte Klehr keine Zweifel haben konnte, dass die befohlenen Tötungen nach einem so oberflächlichen Verfahren ohne jegliche rechtliche Sicherungen für die Opfer ein allgemeines Verbrechen waren. Er hat nach der Überzeugung des Gerichts diese Zweifel auch nicht gehabt. Er hat sich selbst nicht darauf berufen, dass er die Beseitigung der schwachen und kranken jüdischen Häftlinge als rechtmässig angesehen habe. Bei seiner in der Hauptverhandlung erkennbar gewordenen Mentalität hätte er das mit Sicherheit geltend gemacht, wenn er nur die geringsten Zweifel an dem Unrechtscharakter der befohlenen Tötungen gehabt hätte.
Der Angeklagte Klehr ist als Mittäter zu bestrafen. Nach den getroffenen Feststellungen hat er die Tötung der schwachen und kranken jüdischen Häftlinge innerlich bejaht. Darüber hinaus hat es ihm unnatürliche Freude bereitet, die Opfer durch Phenolinjektionen zu töten. Es kann daher nicht zweifelhaft sein, dass er mit Täterwillen gehandelt hat. Da er nach den getroffenen Feststellungen die Umstände gekannt hat, die den Beweggrund für die Tötungen als niedrig kennzeichnen und die Häftlinge in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken mit dem Lagerarzt getötet hat, hat er auch vorsätzlich gehandelt. Er persönlich hat darüber hinaus auch aus Mordlust getötet, da es ihm unnatürliche Freude bereitet hat, die Häftlinge auf diese Weise umzubringen. Seines persönlichen Motivs war er sich nach der Überzeugung des Gerichts auch bewusst. Irgendwelche Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe sind nicht ersichtlich. Dass der Angeklagte Klehr nicht durch Drohung des Lagerarztes Dr. Entress zu den Tötungen gezwungen worden ist, ist oben bereits ausgeführt worden. Die Tatsache, dass er die Tötungen innerlich bejaht und aus Mordlust gehandelt hat, schliesst das Vorliegen eines Befehlsnotstandes aus. Die Tötung eines jeden Häftlings ist als selbständige Handlung im Sinne des §74 StGB anzusehen. Denn jeder Häftling wurde durch einen besonderen Willensentschluss, durch eine besondere Entscheidung des Lagerarztes Dr. Entress für die Tötung ausgewählt. Anschliessend wurde jeder Häftling durch eine besondere Willensbetätigung des Angeklagten Klehr, nämlich das Einspritzen des Phenols in das Herz, getötet.
Der Angeklagte Klehr war daher wegen der Tötung der mindestens 256 Häftlinge wegen gemeinschaftlichen Mordes in mindestens 256 Fällen (§§47, 211, 74 StGB) zu 256mal lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen.
2. Zu II.2a.-d.
Die Tötungen der Häftlinge in den Fällen II.2a.-d. erfüllen ebenfalls den Tatbestand des Mordes. Sie erfolgten ebenfalls aus niedrigen Beweggründen. Denn der Angeklagte Klehr hat diesen Häftlingen nur deswegen kein Lebensrecht mehr zuerkannt, weil sie Juden waren und als Kranke nicht mehr nützlich erschienen. Er hat ausserdem aus Mordlust gehandelt. Er hat die im KL Auschwitz herrschende allgemeine Missachtung jüdischer Menschen, die ihren Grund in der allgemeinen nationalsozialistischen Politik gegenüber den Juden hatte, bewusst ausgenutzt, um seine niedrigen Instinkte zu befriedigen. Die Tötung der Häftlinge am Heiligen Abend zeigt besonders klar, dass es ihm unnatürliche, sadistische Freude bereitet hat, wehrlose Menschen durch Phenolinjektionen zu töten. Der Angeklagte Klehr war sich dieser Motive auch bewusst. Er hat somit vorsätzlich gehandelt.
Irgendwelche Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe liegen nicht vor.
Die Tötung eines jeden Häftlings ist als selbständige Handlung im Sinne des §74 StGB anzusehen. Denn der Angeklagte Klehr hat jeden Häftling durch eine besondere Entschliessung und Entscheidung für den Tod ausgewählt und jeweils durch eine besondere Willensbetätigung, das Einspritzen des Phenols in das Herz, getötet.
Er war daher wegen der unter II.2a.-d. aufgeführten Fälle wegen Mordes in mindestens 211 Fällen (§§211, 74 StGB) zu 211mal lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen.
3. Zu II.3a.
Die Tötung der kranken Häftlinge, die der Angeklagte Klehr im Block 20 zur Vergasung ausgesucht hat, war ebenfalls Mord. Sie erfolgte aus niedrigen Beweggründen.
Die Häftlinge wurden nur deswegen getötet, weil sie als Kranke nicht mehr lebenswert erschienen. Ihre "Liquidierung" erfolgte somit nur aus Nützlichkeitserwägungen. Der Angeklagte Klehr hat die Häftlinge zwar nicht eigenhändig getötet, er hat für ihren Tod jedoch eine entscheidende Ursache gesetzt, indem er sie eigenmächtig zur Vergasung ausgesondert hat. Aus seiner eigenmächtigen Handlungsweise ergibt sich gleichzeitig, dass er den Tod dieser Häftlinge bewusst gewollt, somit mit Täterwillen gehandelt hat. Da er sich auch seines Motivs für die Selektion der Häftlinge bewusst gewesen ist, was nach der gesamten Situation nicht zweifelhaft sein kann, hat er auch vorsätzlich gehandelt. Die Tötung der mindestens vier Häftlinge durch Gas ist als ein Mord, begangen in gleichartiger Tateinheit an mindestens vier Menschen, anzusehen, da die Tötung dieser vier Menschen durch ein- und dieselbe Handlung, nämlich das Einwerfen des Zyklon B, erfolgt ist.
Der Angeklagte Klehr war daher in diesem Fall wegen gemeinschaftlichen Mordes in einem Fall (§§47, 211 StGB) begangen in gleichartiger Tateinheit (§73 StGB) an mindestens vier Menschen, zu lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen.
4. Zu II.3b.
Die Tötung der 70 holländischen Juden durch Zyklon B in einer der Gaskammern in Birkenau war ebenfalls Mord. Auch sie erfolgte aus niedrigen Beweggründen. Die Juden wurden von dem Angeklagten Klehr nur wegen ihrer Abstammung und ihrer Erkrankung ausgesondert und anschliessend getötet. Weil sie nicht mehr arbeiten konnten, erschienen sie nicht mehr nützlich.
Der Angeklagte Klehr hat durch die eigenmächtige Selektion eine entscheidende Ursache für ihren Tod gesetzt. Ohne seine Selektion wären sie überhaupt nicht getötet worden. Aus der Tatsache, dass er die Häftlinge ohne Befehl eigenmächtig ausgesondert hat, ergibt sich, dass er mit Täterwillen gehandelt hat. Er hat ihren Tod bewusst als eigene Tat gewollt.
Er hat auch gewusst, warum er die 70 holländischen Juden zur Tötung ausgesondert hat. Das liegt bei der gegebenen Sachlage auf der Hand. Er war sich somit der Tatumstände bewusst, die den Beweggrund für die Tötung der 70 Juden als niedrig kennzeichnen.
Er hat also bewusst und gewollt in Kenntnis der Umstände, in denen die Tatbestandsmerkmale des Mordes enthalten sind, einen kausalen Beitrag für den Tod der 70 Häftlinge geleistet, somit vorsätzlich gehandelt.
Irgendwelche Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe sind nicht vorhanden.
Die Tötung der 70 Juden durch Zyklon B in einer der Gaskammern ist als eine selbständige Handlung im Sinne des §74 StGB anzusehen, begangen in gleichartiger Tateinheit an 70 Menschen, da sie durch eine Handlung, nämlich das Einwerfen von Zyklon B, gleichzeitig getötet worden sind.
Der Angeklagte Klehr war daher wegen der Tötung der 70 holländischen Juden wegen gemeinschaftlichen Mordes in einem Fall (§§47, 211 StGB) begangen in gleichartiger Tateinheit (§73 StGB) an mindestens 70 Menschen mit einmal lebenslangem Zuchthaus zu bestrafen.
5. Zu II.4.
Die Tötung der 280 Häftlinge war ebenfalls Mord. Sie erfolgte aus niedrigen Beweggründen. Denn diese Häftlinge wurden nur deswegen getötet, weil man sie als unnütze Esser und Belastung des Lagers loswerden wollte. Auch hier waren somit nur reine Nützlichkeitserwägungen massgebend. Die Tötungsart war zudem grausam. Es bedarf keiner Frage, dass der Hunger und das Quälen der ausgehungerten und schwachen Häftlinge durch Appellstehen diesen erhebliche körperliche und seelische Qualen bereitet haben, zumal sie ihren sicheren Tod vor Augen sehen mussten, ohne sich dagegen wehren zu können. Eine solche Tötungsart kann nur anordnen, wer selbst von gefühlloser, roher und unbarmherziger Gesinnung ist. Aus dieser Gesinnung heraus hat man den Häftlingen Qualen bereitet.
Der Angeklagte Klehr hat zu dem Tode dieser 280 Häftlinge bewusst und gewollt einen kausalen Tatbeitrag dadurch geleistet, dass er in dem Bewusstsein, dass die "überstellten" Häftlinge in Birkenau umgebracht werden sollten, ihre Verladung auf die LKWs überwacht und dafür gesorgt hat, dass alle im Saal Nr.10 des Blockes 20 befindlichen Häftlinge auch tatsächlich die LKWs bestiegen und nach Birkenau gebracht werden.
Er hat in diesem Fall - jedenfalls muss es nach den gesamten Umständen zu seinen Gunsten angenommen werden - auf Befehl gehandelt. Seine Beteiligung muss daher im Rahmen des §47 MStGB beurteilt werden. Auch hier kann nicht zweifelhaft sein, dass der Angeklagte Klehr erkannt hat, dass der ihm gegebene Befehl, bei der Verbringung der Schonungskranken nach Birkenau zur Liquidierung mitzuhelfen, ein allgemeines Verbrechen bezweckte. Die Situation war die gleiche wie in allen anderen Fällen, in denen Kranke zur Tötung durch Phenol oder durch Gas ausgesondert oder nach Birkenau gebracht wurden. Es kann daher auf die Ausführung unter IV.1. Bezug genommen werden.
Auch in diesem Fall besteht der erhebliche Verdacht, dass der Angeklagte Klehr mit Täterwillen gehandelt hat. Wenn das Schwurgericht gleichwohl nur von einem Gehilfenwillen des Angeklagten Klehr ausgegangen ist, dann deswegen, weil nicht festgestellt werden konnte, dass er die Tötung von Häftlingen durch Gas mit dem gleichen Eifer wie die Tötung durch Phenol betrieben hat. An der Tötung von Häftlingen durch Phenol war er persönlich interessiert, weil es ihm eine unnatürliche Freude bereitet hat, Menschen durch Injektionen in das Herz zu töten. Er hat hier auch nicht so das Geschehen beherrscht wie bei den Tötungsaktionen, bei denen er den Häftlingen eigenhändig das Gift in das Herz gespritzt hat. Im Falle der 280 Häftlinge kann der Angeklagte Klehr auch aus seiner bereitwilligen Befehlsergebenheit heraus ohne persönliches Interesse am Tod der betreffenden Häftlinge die Verladung und Verbringung der Opfer nach Birkenau überwacht haben. Zwar sprechen die Fälle, in denen der Angeklagte Klehr ohne Befehl auch Häftlinge für die "Liquidierung" durch Gas ausgesucht hat, an sich dafür, dass er auch in den anderen - befohlenen - Fällen, in denen Häftlinge durch Gas oder - wie hier - durch andere Massnahmen "liquidiert" wurden, diese innerlich bejaht und zu seiner eigenen Sache gemacht hat. Das Schwurgericht konnte jedoch letzte Zweifel an seinem Täterwillen in diesem Fall nicht überwinden, zumal es sich um einen Fall gehandelt hat, der bereits im April 1942 geschehen ist, also zu einer Zeit, in der man Häftlinge des Lagers noch nicht für Tötungen durch Zyklon B ausgesucht hat. Mit Sicherheit konnte daher das Schwurgericht nur feststellen, dass der Angeklagte Klehr die von anderer Seite befohlene Tötung der Schonungskranken als Gehilfe hat fördern und unterstützen wollen.
Der Angeklagte Klehr hat seinen kausalen Tatbeitrag zu dem Mord auch vorsätzlich geleistet. Denn er hat in Kenntnis der Tatumstände, die den Beweggrund für die Tötung der Schonungskranken als niedrig kennzeichnen und in dem Bewusstsein, dass die Häftlinge in Birkenau "liquidiert" werden sollten, bei der Verladung der Häftlinge auf die LKWs mitgeholfen. Nach den getroffenen Feststellungen war ihm auch klar, dass er durch die Beaufsichtigung der Verladung der Opfer einen kausalen Tatbeitrag zu ihrem Tode leistete. Irgendwelche Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich. Insbesondere bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass dem Angeklagten Klehr seine Mitwirkung durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben abgenötigt worden ist. Sein sonstiges Verhalten im KL Auschwitz, wie es sich aus den getroffenen Feststellungen ergibt, insbesondere seine eigenmächtigen Selektionen, sprechen auch eindeutig dagegen, dass sein Wille hat gebeugt werden müssen. Daraus ist vielmehr zu folgern, dass er seinen Tatbeitrag bereitwillig geleistet hat.
Die Tötung der 280 Häftlinge hat das Gericht als eine einzige selbständige Handlung, begangen in gleichartiger Tateinheit an 280 Menschen, angesehen. Denn der Tod dieser Menschen ist bei natürlicher Betrachtungsweise durch eine einzige länger dauernde Behandlung (das Hungernlassen, das Appellstehen und sonstige Schikanen) herbeigeführt worden. Wenn auch die Häftlinge nicht gleichzeitig gestorben sind, ist ihr Tod jedoch letztlich auf die gleiche andauernde Behandlung zurückzuführen.
Der Angeklagte Klehr war daher in diesem Fall wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zu gemeinschaftlichem Mord (§§47, 49, 211, 74 StGB) begangen in gleichartiger Tateinheit (§73 StGB) an 280 Menschen zu verurteilen.
6. Zu II.5.
Die Tötung der 700 Infektionskranken aus dem Block 20 war ebenfalls Mord. Sie erfolgte ebenfalls aus niedrigen Beweggründen. Denn die Kranken, die der besonderen Pflege und ärztlichen Hilfe bedurft hätten, wurden nur deswegen getötet, um die Gefahr der Ansteckung für SS-Angehörige zu beseitigen. Dass ein solches Motiv sittlich verachtenswert ist und auf tiefster sittlicher Stufe steht, liegt auf der Hand. Der Angeklagte Klehr hat zum Tode der 700 Menschen dadurch einen kausalen Tatbeitrag geleistet, dass er darauf achtete, dass die Opfer nicht durch Funktionshäftlinge gerettet würden, dass er bei ihrer Verladung auf die LKWs die Aufsicht führte und dass er schliesslich widerstrebende Häftlinge persönlich auf die LKWs zerrte. Nach den getroffenen Feststellungen hat er gewusst, dass die Opfer anschliessend durch Zyklon B getötet werden sollten. Er hat somit auch das Bewusstsein gehabt, durch die geschilderten Handlungen kausale Tatbeiträge zum Tode der Häftlinge zu leisten.
Auch in diesem Falle hat er auf Befehl mitgewirkt, so dass §47 MStGB zur Anwendung kommt. Der Angeklagte Klehr hat auch hier erkannt, dass die Tötung von kranken Menschen, die völlig unschuldig waren und nur, weil sie krank waren, getötet werden sollten, ein allgemeines Verbrechen war und der Befehl, der seine Mitwirkung an der Aktion anordnete, ein allgemeines Verbrechen bezweckte. Denn jeder, auch der primitivste Mensch, weiss, dass man nicht einfach kranke Menschen töten darf, um damit die Gefahr einer Ansteckung von anderen zu unterbinden. Die Tötung von Menschen aus einem solchen Motiv ist ein so krasser Verstoss gegen die allen Angehörigen von Kulturnationen bekannten Grundsätze eines jeden Menschen auf sein Leben, dass auch dem Angeklagten Klehr der verbrecherische Charakter der Vernichtungsaktion nicht verborgen geblieben sein kann und nach der Überzeugung des Gerichts auch nicht verborgen geblieben ist. Er beruft sich selbst auch nicht darauf, dass er etwa die Tötung der Infektionskranken aus den angegebenen Beweggrund für rechtmässig gehalten habe.
Ihn trifft daher die Strafe des Teilnehmers. Auch in diesem Falle konnte das Gericht - ebenso wie in allen anderen Fällen, in denen er auf Befehl an Vernichtungsaktionen, durch die Häftlinge durch Zyklon B getötet worden sind, teilgenommen hat - nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass er mit Täterwillen gehandelt hat, wenn auch ein erheblicher Verdacht hierfür besteht. Insoweit kann auf die obigen Ausführungen Bezug genommen werden. Es kann daher nur festgestellt werden, dass der Angeklagte Klehr die Vernichtungsaktion und damit den Mord der Haupttäter als Gehilfe fördern und unterstützen wollte.
Allerdings hat er bereitwillig geholfen. Das ergibt sich daraus, dass er keinem Opfer die Chance lassen wollte, durch Funktionshäftlinge gerettet zu werden. Es zeigt sich ferner darin, dass er widerstrebende Häftlinge brutal auf die LKWs gezerrt hat.
Seine Tatbeiträge zu dem Mord der Haupttäter hat der Angeklagte Klehr vorsätzlich geleistet. Denn er hat die Umstände gekannt, die den Beweggrund für die Vernichtungsaktion als niedrig kennzeichnen und hat seine Tatbeiträge in dem Bewusstsein geleistet, die Vernichtungsaktion zu fördern.
Auch hier liegen keine Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe vor. Anhaltspunkte für einen Befehlsnotstand sind ebensowenig wie in den anderen Fällen, in denen er auf Befehl an Verbrechen mitgewirkt hat, ersichtlich. Sein gesamtes sonstiges Verhalten im KL Auschwitz, insbesondere seine eigenmächtigen Selektionen, sprechen auch eindeutig dagegen.
Die gesamte Vernichtungsaktion ist als eine einzige selbständige Handlung im Sinne des §74 StGB anzusehen, da die 700 Menschen letztlich durch eine einzige Willensbetätigung, nämlich durch das Einwerfen des Zyklon B in die Gaskammer, gleichzeitig getötet worden sind.
Der Angeklagte Klehr
war daher wegen seiner Mitwirkung an dieser Vernichtungsaktion wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zu gemeinschaftlichem Mord (§§47, 49, 211 StGB) begangen in gleichartiger Tateinheit (§73 StGB) an 700 Menschen zu verurteilen.
7. Zu II.6a und b.
Die Massentötung jüdischer Menschen im kleinen Krematorium und in den Gaskammern in Birkenau war Mord, wie oben bereits näher ausgeführt worden ist. Der Angeklagte Klehr hat zu diesen Mordtaten der Haupttäter kausale Tatbeiträge geleistet. Das bedarf kaum einer näheren Begründung. Im Falle II.6a. liegt es auf der Hand, dass er durch das Einschütten des Zyklon B unmittelbar den Tod der in der Gaskammer eingeschlossenen Menschen herbeigeführt hat. Auch in den unter II.6b. aufgeführten Fällen hat er zum Tod der in der Gaskammer eingeschlossenen Menschen eine Mitursache gesetzt, indem er die SS-Männer für das Einschütten des Zyklon B eingeteilt und sie dann bei dieser Tätigkeit, die unmittelbar den Tod der Opfer herbeiführte, beaufsichtigt hat. Durch seine Anwesenheit in der Gaskammer hat er dazu beigetragen, dass die ihm unterstellten SS-Männer die ihnen gegebenen Befehle prompt ausführten und dass die reibungslose Durchführung der Vernichtungsaktionen gewährleistet war.
Auch durch das Heraussuchen der Kranken auf der Rampe hat er zum Tode, zumindest dieser Menschen, einen kausalen Tatbeitrag geleistet. Es kann dahingestellt bleiben, ob diese Tätigkeit darüber hinaus als Förderung der Vernichtung aller aus diesem RSHA-Transport getöteter Menschen anzusehen ist oder nur als Beitrag zum Tode der von ihm herausgesuchten Kranken gewertet werden darf. Denn das Gericht hat in diesen beiden Fällen zu Gunsten des Angeklagten angenommen, dass die beiden RSHA-Transporte, bei deren Abwicklung er auf der Rampe tätig war, identisch sind mit den beiden RSHA-Transporten, bei denen er das Einwerfen des Zyklon B in Birkenau überwacht und beaufsichtigt hat. Die Tätigkeit auf der Rampe bezieht sich somit nicht auf zwei weitere RSHA-Transporte, sondern ist nur Teil einer Mitwirkung an der Vernichtung von zwei RSHA-Transporten. Die Tätigkeit an der Gaskammer in Birkenau bei diesen beiden RSHA-Transporten war auf jeden Fall mitursächlich für den Tod aller in der Gaskammer eingeschlossenen Menschen (mindestens zweimal je 750 Menschen), so dass die Tätigkeit des Angeklagten Klehr auf der Rampe und an der Gaskammer zusammengenommen die Förderung von zwei Mordtaten begangen an je 750 Menschen ist.
Der Angeklagte Klehr war sich auch bewusst, dass er zum Tode der 50 bzw. zweimal 750 Menschen durch die geschilderte Tätigkeit kausale Tatbeiträge geleistet hat. Das kann bei der Art seiner Mitwirkung nicht zweifelhaft sein. Denn es liegt für jedermann klar auf der Hand.
Auch in diesen drei Fällen hat der Angeklagte Klehr auf Befehl gehandelt, so dass §47 MStGB zur Anwendung kommt. Er hat erkannt, dass die ihm gegebenen Befehle, an der Vernichtung der RSHA-Transporte in der geschilderten Weise teilzunehmen, ein allgemeines Verbrechen bezweckten. Er beruft sich selbst nicht darauf, dass er die Tötung unschuldiger jüdischer Menschen nur wegen ihrer Abstammung für rechtmässig gehalten habe. Im übrigen gilt auch bei dem Angeklagten Klehr das gleiche, was bereits oben unter A.V.2. ausgeführt worden ist. Auch in diesen Fällen konnte das Schwurgericht aus den bereits angeführten Gründen nicht mit letzter Sicherheit feststellen, dass der Angeklagte Klehr mit Täterwillen gehandelt hat. Er hat zwar bereitwillig mitgewirkt, auch hat er sonst den jüdischen Menschen kein Lebensrecht zuerkannt, was sich daraus ergibt, dass er im HKB eigenmächtig jüdische Häftlinge herausgesucht und getötet hat. In diesen Fällen kam aber sein Interesse und seine unnatürliche Freude an der Tötung von Menschen durch Phenolinjektionen hinzu, während in den Fällen, in denen die Menschen durch Gas getötet worden sind, dieses Motiv wegfiel. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass er in diesen drei Fällen aus einer bereitwilligen Befehlsergebenheit heraus nur als Gehilfe die Mordtaten der Haupttäter fördern und unterstützen wollte.
Da der Angeklagte Klehr die gesamten Umstände, die den Beweggrund für die Tötung der jüdischen Menschen als niedrig kennzeichnen, gekannt hat und durch seine Anwesenheit an der Gaskammer zwangsläufig die Umstände erfahren musste und erfahren hat, die die Art der Tötung als grausam kennzeichnen, und da er sich im übrigen im klaren war, selbst kausale Tatbeiträge zu den Mordtaten der Haupttäter zu leisten, hat er auch vorsätzlich gehandelt.
Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe liegen nicht vor. Der Angeklagte Klehr hat nicht in einem Befehlsnotstand gehandelt. Dagegen spricht sein gesamtes Verhalten im KL Auschwitz, wie es sich aus den getroffenen Feststellungen ergibt. Er beruft sich auch selbst nicht darauf, vielmehr leugnet er, überhaupt etwas mit den Vergasungen zu tun gehabt zu haben.
Bezüglich des Rampendienstes in den beiden Fällen hat er sich nicht darauf berufen, dass sein Wille gebeugt worden sei.
Der Angeklagte Klehr war daher wegen seiner Mitwirkung an den geschilderten Vergasungen wie folgt zu verurteilen:
a. wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord (§§47, 49, 211 StGB) begangen in gleichartiger Tateinheit (§73 StGB) an mindestens 50 Menschen,
b. wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zu gemeinschaftlichem Mord in zwei Fällen (§§47, 49, 211, 74 StGB), begangen jeweils in gleichartiger Tateinheit (§73 StGB) an je mindestens 750 Menschen.
8. Zu II.7.
Die Tötung der Angehörigen des jüdischen Sonderkommandos war ebenfalls Mord. Sie erfolgte ebenfalls aus niedrigen Beweggründen. Man wollte auf diese Weise die Zeugen vieler Verbrechen beseitigen. Weil die Angehörigen des jüdischen Sonderkommandos Massenverbrechen mit angesehen hatten und weil es "nur" jüdische Menschen waren, sprach man ihnen jedes Lebensrecht ab und beseitigte sie ohne jedes Gerichtsverfahren und jegliche rechtliche Sicherungen abgeschirmt gegen die Öffentlichkeit. Es liegt auf der Hand, dass ein solches Motiv sittlich verachtenswert ist und auf tiefster sittlicher Stufe steht. Ausserdem war die Tötung der Angehörigen des Sonderkommandos auch grausam. Die jüdischen Männer hatten selbst in unzähligen Fällen die Ermordung ihrer Leidensgefährten und deren Todeskampf in den Gaskammern erlebt.
Als sie im Hof des alten Krematoriums mit Gewalt gezwungen wurden, sich zu entkleiden, musste ihnen klar werden, dass sie auf die gleiche menschenunwürdige und qualvolle Weise wie ihre Glaubensgenossen umgebracht werden sollten. Das hat ihnen ohne Zweifel über die normale Todesangst hinaus weitere seelische Qualen bereitet. Die SS-Angehörigen haben sich nicht gescheut, ihnen diese Qualen zu bereiten und sie mit brutaler Gewalt in die Gaskammer zu bringen. Eine solche Tötungsart kann nur anordnen, wer gefühllos, roh und unbarmherzig ist. Aus dieser Gesinnung heraus hat man die Tötung der Angehörigen des jüdischen Sonderkommandos in der Gaskammer im kleinen Krematorium angeordnet.
Der Angeklagte Klehr hat zu der Tötung der 200 jüdischen Männer einen kausalen Tatbeitrag geleistet, indem er den ihm unterstellten SS-Männern das Einschütten des Zyklon B befohlen und sie beim Einschütten des Giftgases beaufsichtigt hat. Ihm war auch bewusst, was bei der Art seiner Tätigkeit nicht zweifelhaft sein kann, dass er hierdurch zum Tode der 200 Menschen einen kausalen Tatbeitrag leistete. Auch in diesem Fall hat er auf Befehl mitgewirkt, jedoch klar erkannt, dass die Tötung der 200 jüdischen Menschen ein allgemeines Verbrechen war. Insoweit gilt das gleiche, was bereits oben unter A.V.2. ausgeführt worden ist. Ihn trifft daher nach §47 MStGB die Strafe des Teilnehmers. Auch in diesem Falle konnte das Schwurgericht - aus den oben bereits angeführten Gründen - nicht mit Sicherheit einen Täterwillen des Angeklagten Klehr sondern nur feststellen, dass er die Mordtat der Haupttäter fördern und unterstützen wollte.
Er hat seinen Tatbeitrag vorsätzlich geleistet. Denn er war sich - wie schon festgestellt - bewusst, einen kausalen Tatbeitrag zu dem Mord an den 200 Menschen zu leisten und hat nach den getroffenen Feststellungen die Umstände gekannt, die den Beweggrund für die Tötung der Angehörigen des jüdischen Sonderkommandos als niedrig kennzeichnen. Ferner hat er die gesamten Umstände miterlebt und daher in seinem Bewusstsein aufgenommen, die die Art der Tötung als grausam kennzeichnen. Auch in diesem Falle liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass er zu der Mitwirkung durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben gezwungen worden wäre. Es gilt daher das gleiche wie in allen anderen oben bereits erörterten Fällen. Sonstige Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich.
Der Angeklagte Klehr war daher in diesem Fall wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zu gemeinschaftlichem Mord (§§47, 49, 211 StGB) begangen in gleichartiger Tateinheit (§73 StGB) an mindestens 200 Menschen zu verurteilen.
9. Zu II.8a. und e.
Die Tötung des Häftlingsarztes Fedor war Mord. Der Angeklagte Klehr hat den Häftlingsarzt Fedor bewusst und gewollt getötet. Beweggrund hierfür war Mordlust. Zwar war äusserer Anlass für die Tötung, dass der Häftling aus Übermüdung eingeschlafen war. Dieses "Vergehen" stand jedoch in keinem Verhältnis zur "Todesstrafe", die der Angeklagte Klehr eigenmächtig über den Häftling verhängte und sofort selbst vollzog. Daher war nach der Überzeugung des Gerichts das Einschlafen des Häftlings nicht der eigentliche Grund für die anschliessende Tötung. Der Angeklagte Klehr hat das angebliche Vergehen des Häftlings nur als Vorwand benutzt, um seine unnatürliche Freude an der Vernichtung von Menschenleben durch Phenolinjektionen zu befriedigen. Oben ist bereits ausgeführt worden, dass die Tatsache, dass der Angeklagte Klehr eigenmächtig Häftlinge zur Tötung mit Phenol, insbesondere am Heiligen Abend, ausgesucht und anschliessend eigenhändig getötet hat und sich gegenüber Häftlingsärzten noch mit seiner Fertigkeit im Geben von Phenolinjektionen gebrüstet hat, eindeutig dafür spricht, dass ihm die Tötung von Häftlingen durch Phenolinjektionen unnatürliche Freude bereitet hat. Da im Falle Fedor praktisch kein Anlass für die vom Angeklagten Klehr durchgeführte Tötung bestand, ist sie nach Überzeugung des Gerichts nur aus dieser unnatürlichen Freude des Angeklagten Klehr an der Vernichtung von Menschenleben durch Phenol zu erklären.
Das gleiche gilt für den Fall 8e. Der Häftling Samson hatte dem Angeklagten Klehr durch einen nichtigen Anlass nur den Vorwand geliefert, um seine niederen Instinkte auszutoben. Auch hier stand der Anlass in keinem Verhältnis zu dem von dem Angeklagten Klehr herbeigeführten Erfolg. Das Gericht ist daher überzeugt, dass der Angeklagte Klehr auch den Häftling Samson aus Mordlust bewusst und gewollt getötet hat.
Der Angeklagte Klehr war daher wegen der Tötung der beiden Häftlinge Fedor und Samson wegen Mordes in zwei Fällen (§211, 74 StGB) zu zweimal lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen.
10. Zu II.8b.
Die Tötung der Häftlingsfrau war ebenfalls Mord. Sie war rechtswidrig, da gegen die Frau kein Todesurteil vorlag, und ausserdem heimtückisch. Der Angeklagte Klehr hat die Frau über sein Vorhaben bewusst getäuscht, indem er ihr vorspiegelte, sie sei herzkrank und müsse deswegen eine Spritze bekommen. Dadurch hat er ihre Ahnungslosigkeit bestärkt und sie dazu gebracht, dass sie sich die Spritze bereitwillig geben liess. Sie war auch wehrlos. Ihre Ahnungslosigkeit und Wehrlosigkeit hat er dann zu seinem Vorhaben ausgenutzt.
Zu seinen Gunsten ist davon auszugehen, dass ihm von höherer Stelle der Befehl erteilt worden sei, die Frau zu töten. Er hat jedoch, was nach §47 MStGB erforderlich ist, erkannt, dass der Befehl ein allgemeines Verbrechen bezweckt. Denn er wusste, dass gegen die Frau kein Todesurteil vorlag. Die Umstände, unter denen die Frau durch ihn zu Tode gebracht werden sollte, mussten ihm ferner den Gedanken aufdrängen, dass die Tötung der Frau ein Verbrechen war. Ihm war das nach der Überzeugung des Gerichts daher auch klar. Die Tatsache, dass er die Frau über seine Tötungsabsicht täuschte, zeigt auch deutlich, dass er sich über den Unrechtsgedanken seiner Handlungsweise im klaren war.
Wenn der Angeklagte Klehr auch nur auf Befehl gehandelt hat, bestehen keine Zweifel, dass er den Tod der Frau als eigene Tat gewollt hat. Hierfür spricht zunächst, dass er die Frau eigenhändig getötet hat, somit das Tatgeschehen völlig beherrschte, wenn dies allein auch noch kein sicherer Beweis für seinen Täterwillen ist. Sein Täterwillen ergibt sich aber weiter aus seinem Verhalten gegenüber der Frau und schliesslich aus seinem sonstigen Verhalten im HKB. Oben sind bereits die Tatsachen angeführt worden, aus denen das Schwurgericht den Schluss gezogen hat, dass der Angeklagte Klehr den Häftlingen die Phenolinjektionen in das Herz aus unnatürlicher Freude an der Vernichtung von Menschenleben gegeben hat. Nach der Überzeugung des Gerichts war bei ihm auch in diesem Fall dieses Motiv vorhanden. Daraus ergibt sich, dass er den Tod der Frau als eigene Tat gewollt und darüber hinaus auch aus Mordlust gehandelt hat.
Er war daher auch in diesem Fall wegen Mordes (§211 StGB) mit lebenslangem Zuchthaus zu bestrafen.
11. II.8c.
Dieser Fall ist ebenso wie die Tötung der Häftlingsfrau zu beurteilen, nur dass das Tatbestandsmerkmal der Heimtücke wegfällt.
Die Tötung des Politkommissars war rechtswidrig, da gegen ihn kein Todesurteil vorlag. Der Angeklagte Klehr hat ihn, wovon nach den Umständen des Falles zu seinen Gunsten ausgegangen werden muss, auf Befehl getötet, so dass §47 MStGB zur Anwendung kommt. Die Tatsache, dass der Politkommissar nicht öffentlich exekutiert worden ist, sondern heimlich beseitigt werden sollte, musste ihm aber deutlich vor Augen führen, dass gegen ihn kein Todesurteil vorlag und dass die befohlene Tötung ein allgemeines Verbrechen war. Das hat er nach der Überzeugung des Gerichts auch klar erkannt.
Auch in diesem Fall hat das Gericht keine Zweifel, dass der Angeklagte Klehr den Tod des Politkommissars als eigene Tat gewollt hat. Hier gilt das gleiche, was bereits oben bei der Erörterung der Tötung der Häftlingsfrau ausgeführt worden ist. Dem Angeklagten Klehr hat es unnatürliche Freude bereitet, den Politkommissar durch eine Phenolinjektion zu töten. Er hat somit aus Mordlust gehandelt. Es kommt daher nicht mehr darauf an, aus welchem Motiv der oder die Befehlsgeber die Tötung des Politkommissars befohlen haben und ob der Angeklagte Klehr dieses Motiv gekannt hat.
Er war daher auch in diesem Fall wegen Mordes (§211 StGB) zu lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen.
12. Zu II.8d.
Die Tötungen der beiden Häftlingsfrauen erfüllten ebenfalls den Tatbestand des Mordes. Die Frauen wurden rechtswidrig getötet, da gegen sie kein Todesurteil vorlag. Auch in diesem Fall musste zu Gunsten des Angeklagten davon ausgegangen werden, dass ihm die Tötung der beiden Frauen befohlen worden ist, so dass §47 MStGB Anwendung findet. Auch hier hat die Tatsache, dass die beiden Frauen heimlich beseitigt werden sollten, dem Angeklagten Klehr deutlich vor Augen geführt, dass gegen die Frauen kein Todesurteil vorlag und ihre Tötung ein allgemeines Verbrechen war. Das war ihm nach der Überzeugung des Gerichts bewusst. Der Grund für die Beseitigung der beiden Frauen konnte zwar nicht festgestellt werden. Wahrscheinlich haben sie sich aus irgend einem nichtigen Anlass unbeliebt gemacht. Der Beweggrund der Haupttäter, die die Tötung der Frauen befohlen haben, kann jedoch dahingestellt bleiben. Denn der Angeklagte Klehr hat auch in diesen beiden Fällen aus den gleichen Gründen wie in den Fällen II.8b. und II.8c. die Tötung der beiden Frauen als eigene Taten gewollt und ihnen die Phenolinjektionen aus unnatürlicher Freude an der Vernichtung ihres Lebens gegeben. Er hat somit aus Mordlust gehandelt.
Der Angeklagte Klehr war daher wegen der Tötung der beiden Frauen wegen Mordes in zwei Fällen (§§211, 74 StGB) zu zweimal lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen.
V. Hilfsbeweisanträge
1. Der Hilfsantrag des Verteidigers der Angeklagten Hofmann und Klehr, Rechtsanwalt Gö.,
a. beglaubigte Abschrift des Urteils des Schwurgerichts Tübingen vom Dezember 1964 gegen Haupt von der Staatsanwaltschaft Tübingen beizuziehen,
b. die Akten 17 Ks 1/55 gegen Knott von der Staatsanwaltschaft Bochum heranzuziehen,
war abzulehnen, da keine konkreten beweiserheblichen Tatsachen angegeben worden sind, zu deren Beweis die beglaubigte Abschrift des Urteils des Schwurgerichts in Tübingen beigezogen und offenbar verlesen worden soll.
Bei dem Antrag, die Akten 17 Ks 1/55 des Staatsanwaltschaft Bochum beizuziehen, handelt es sich nicht um einen Beweisantrag, sondern um einen Beweisermittlungsantrag; denn es sind keine beweiserheblichen konkreten Tatsachen angegeben worden, die bewiesen werden sollen. Ferner sind keine genau bezeichneten Urkunden aus den Akten angeführt worden, die verlesen werden sollen.
2. Der Hilfsantrag des Verteidigers der Angeklagten Hofmann und Klehr, Rechtsanwalt Gö.,
das Kriegstagebuch des Kommandostabes des RFSS vom 16.6. - 31.12.1941 mit Tätigkeitsberichten mehrerer SS-Kommandos von der Zentralstelle in Ludwigsburg beizuziehen, zum Beweise dafür, dass die Angeklagten Hofmann und Klehr nur auf Befehl des RFSS und des WVHA gehandelt hätten, dass Befehlsverweigerung mit Gefahr für Leib und Leben verbunden gewesen sei und dass bei Befehlsverweigerung ausserdem die Versetzung zu den "SS-Knochen-Stürmen" in Dachau und Buchenwald hätte angeordnet werden können, war abzulehnen, da keine bestimmten Urkunden aus dem Kriegstagebuch angegeben worden sind, aus denen sich der Beweis der behaupteten Tatsachen ergeben soll. Der Verteidiger hat auch nur die Beiziehung des Kriegstagebuches, jedoch nicht die Verlesung konkret bezeichneter Urkunden beantragt. Die blosse Beiziehung des Kriegstagebuches kann keinen Beweis für irgendwelche Tatsachen erbringen. Bei dem Antrag handelt es sich offensichtlich um einen Beweisermittlungsantrag. Aus dem beigezogenen Kriegstagebuch sollen erst die Urkunden ermittelt werden, die als Beweismittel für die behaupteten Tatsachen in Betracht kommen können.
3. Der Hilfsbeweisantrag des Verteidigers des Angeklagten Klehr,
den Rechtsanwalt Dr. Mo. zum Beweise für die Tatsache zu vernehmen,
a. dass der Angeklagte Klehr an den Standortarzt Dr. Wirths eine Meldung weitergeleitet habe, wonach die Desinfektoren Wornitzka und Schmunitzer sich an jüdischen Wertsachen bereichert hätten,
b. dass der Rechtsanwalt Dr. Mo. am 18.11.1943 eine Haussuchung in der Wohnung der Ehefrau Klehr durchgeführt habe,
war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da die Tatsachen, die bewiesen werden sollen, für die Entscheidung ohne Bedeutung sind.
4. Der Hilfsbeweisantrag des Verteidigers des Angeklagten Klehr,
den Zeugen Esformer darüber zu vernehmen, dass während der Dienstzeit des Angeklagten Klehr Kranke aus den Krankenblöcken in die Isolierstation Birkenau verlegt worden sind,
war gemäss §244 Abs.III StPO abzulehnen, da die in das Wissen des Zeugen gestellten Tatsachen zu Gunsten des Angeklagten Klehr so behandelt werden können, als wären sie wahr. Die "Verlegung" von Kranken nach Birkenau in die Isolierstation schliesst nicht aus, dass Kranke - wie der Angeklagte Klehr selbst zugegeben hat - nach Birkenau auch "überstellt", d.h. zur "Liquidierung" nach Birkenau gebracht worden sind. "Verlegung" und "Liquidierung" waren Bezeichnungen für ganz verschiedene Massnahmen. Die "Verlegung" bedeutete die Versetzung von Häftlingen in einen anderen Lagerabschnitt oder in ein anderes Lager, während "Überstellung" Liquidierung bedeutete.
VI. Strafzumessung
Gegen den Angeklagten Klehr musste noch wegen der 6 Fälle der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord auf Freiheitsstrafen erkannt werden (Fälle II.4.; II.5.; II.6a und b.; II.7.).
Der Angeklagte hat sich jeweils mit Eifer, unnachsichtig und ohne eine menschliche Regung an die Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben gemacht. Er achtete immer darauf, dass kein Häftling die Chance wahrnehmen konnte, sich mit Hilfe anderer aus dem Kreise der zum Tode Bestimmten wegzuschleichen. Ihm war es wichtiger, dass die festgestellten Zahlen stimmten, als dass ein Mensch vor dem Tode gerettet wurde. Ohne jeden Skrupel liess sich der Angeklagte bereitwillig als Mitvollstrecker teuflischer Mordpläne einspannen und verschuldete zu seinem Teil den Tod von vielen unschuldigen Menschen.
Sein Tatbeitrag war jedesmal erheblich, das Mass seiner Schuld von besonders hohem Gewicht.
Zu Gunsten des Angeklagten konnte berücksichtigt werden, dass er sich nach seiner Versetzung in das Nebenlager Gleiwitz anständig verhalten und sich die Jahre nach Kriegsende unauffällig geführt hat.
Mag der Angeklagte auch seine Funktionen im Rahmen eines bereits in Gang befindlichen generellen Vernichtungsplanes ausgeübt haben, so erschien es nach den angeführten Strafzumessungserwägungen doch erforderlich, auf nachdrückliche Strafen zu erkennen, um dem erheblichen Unrechtsgehalt der Taten gerecht zu werden.
Deshalb wurde in jedem Falle auf 8 Jahre Zuchthaus und gemäss §74 StGB auf eine Gesamtstrafe von 15 Jahren Zuchthaus erkannt. Das Höchstmass der zeitigen Zuchthausstrafe konnte als gerechte Strafe und Sühne der Taten des Angeklagten angesehen werden.
P. Die Straftaten des Angeklagten Scherpe
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Scherpe
Der Angeklagte Scherpe ist am 20.5.1907 als Sohn eines Elektroinstallateurs in Gleiwitz geboren. Er hatte 11 Geschwister, von denen noch 9 am Leben sind. An seinem Geburtsort Gleiwitz besuchte er 8 Jahre lang die Volksschule. Danach erlernte er das Fleischerhandwerk. Nach Abschluss der Lehre übte er den Beruf jedoch nicht mehr aus. Er arbeitete vielmehr im Betrieb seines Vaters und zeitweise auch als Hilfsarbeiter bei verschiedenen anderen Firmen in Gleiwitz. Von 1930 oder 1931 bis 1933 oder 1934 war der Angeklagte arbeitslos. 1931 trat er in die NSDAP und in die allgemeine SS ein. Als Grund hierfür gibt er - ebenso wie der Angeklagte Klehr - die damalige allgemeine wirtschaftliche Notlage an. Von Politik habe er - so lässt er sich ein - keine Ahnung gehabt. Nur weil er arbeitslos gewesen sei, sei er in die Partei und in die SS eingetreten. Eine Zeitlang arbeitete der Angeklagte von 1933 oder 1934 an als Hilfspolizist, als Messkontrolleur für die Kreisbauernschaft und als Hilfsgrenzangestellter beim Zoll. Wegen seiner schlechten Augen sei er jedoch - so gibt er an - bei der Zollbehörde wieder entlassen worden. Von 1935 an gehörte er einem Werkschutz (SS-Wachkommando) an, der Benzinlager auf einem Flugplatz zu bewachen hatte. Dieser Einheit gehörte der Angeklagte bis zum Ausbruch des Krieges an.
Am 6.9.1939 wurde der Angeklagte zur SS-Totenkopfstandarte nach Dachau eingezogen. Zunächst wurde er dort infanteristisch ausgebildet. Wegen seiner Augenschwäche war er jedoch nur g.v.H. Deswegen machte er auch nicht den Frankreichfeldzug mit, bei dem seine Einheit eingesetzt wurde. Er kam vielmehr nach Berlin-Oranienburg, wo er in einem Lehrgang von 8 oder 10 Wochen zum Sanitäter ausgebildet wurde. Nach Abschluss des Lehrganges wurde er zum SS-Unterscharführer (der Waffen-SS) befördert. Bei der allgemeinen SS war er bereits im Jahre 1935 oder 1936 Unterscharführer geworden.
Im Sommer 1940 wurde der Angeklagte zum KL Auschwitz versetzt. Er wurde zunächst im Truppenrevier verwendet. Anfang Mai 1942 wurde er zum HKB des Stammlagers (A I) als SDG versetzt. Hier war er zunächst bis zum 7.10.1942 als SDG tätig. Dann wurde er wegen verbotener Kontakte mit Häftlingen verhaftet. Er war vom 7.10.1942 bis zum 22. oder 23.12.1942 inhaftiert. Nach seiner Haftentlassung war er einige Zeit krank. Im Februar oder März 1943 musste er den Angeklagten Hantl, der für ihn inzwischen als zweiter SDG in den HKB gekommen war, vertreten. Er übte erneut kurze Zeit die Funktionen eines SDG im HKB aus. Anschliessend war er in verschiedenen Nebenlagern, unter anderem im Lager Golleschau, als SDG tätig. Im September oder Oktober 1944 wurde der Angeklagte Scherpe in das Lager Gleiwitz versetzt. Hier blieb er bis zur Evakuierung des Lagers.
Der Angeklagte wurde in Auschwitz zu einem nicht mehr festzustellenden Zeitpunkt zum SS-Oberscharführer befördert. Er selbst gibt an, dass die Beförderung nach seiner Inhaftierung erfolgt sei. Am 20.4.1943 wurde der Angeklagte mit dem KVK II. Klasse ausgezeichnet.
Nach der Räumung des Lagers Auschwitz marschierte der Angeklagte zu Fuss nach Gross-Rosen.
Nach dem Zusammenbruch wurde er als SS-Angehöriger interniert. Er wurde jedoch bereits im Juli 1945 wieder aus dem Internierungslager entlassen. Von November 1949 bis zum Jahre 1956 lebte er in Clausthal-Zellerfeld/Harz. Dann verzog er nach Mannheim. Dort arbeitete er als Pförtner in einer Maschinenfabrik. Er verdiente etwa 650.- DM netto. Der Angeklagte Scherpe ist seit dem 2.8.1941 verheiratet. Aus der Ehe ist ein inzwischen volljähriger Sohn hervorgegangen. Der Angeklagte befand sich vom 15.8.1961 bis zum 19.8.1965 in dieser Sache in Untersuchungshaft.
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Mitwirkung des Angeklagten Scherpe bei der Tötung von sog. Arztvorstellern durch Phenolinjektionen in Block 20 (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
Der Angeklagte Scherpe kam - wie schon in seinem Lebenslauf ausgeführt - Anfang Mai 1942 in den HKB des Stammlagers als SDG. Er wurde zweiter SDG neben dem Angeklagten Klehr. Dieser wies ihn in seine Aufgaben als SDG ein. Der Angeklagte Scherpe wurde gleich zu Beginn seiner Tätigkeit im HKB von dem Angeklagten Klehr zu einer "Untersuchung" der Arztvorsteller in den Block 28 mitgenommen. Dort lernte er das Verfahren, das der Lagerarzt Dr. Entress bei der "Untersuchung" der Neukranken anwandte, wie es unter O.II.1. geschildert worden ist, kennen. Nach Abschluss der Vorbereitungen für die Tötung der vom Lagerarzt Dr. Entress ausgewählten kranken und schwachen jüdischen Häftlinge (Schreiben der Liste, Verbringen der Opfer in den Block 20) nahm der Angeklagte Klehr den Angeklagten Scherpe mit auf Block 20. Beide betraten den Block 20 durch den Haupteingang und gingen dann auf das Zimmer Nr.1. Dort sah der Angeklagte Scherpe, wie die von Dr. Entress ausgewählten Häftlinge nacheinander durch Phenolinjektionen - wie es oben unter O.II.1. beschrieben worden ist - getötet wurden. Er war darüber entsetzt. Zu dem Angeklagten Klehr sagte er nach Abschluss der Aktion, dass er so etwas nicht machen könne. Klehr erwiderte ihm, das sei seine Sache, er solle sehen, wie er damit fertig werde. Scherpe meldete sich noch am gleichen Tag bei dem Lagerarzt Dr. Entress und erklärte ihm, dass er den Dienst im HKB nicht übernehmen könne. Er wolle mit den Tötungen nichts zu tun haben. Dr. Entress lachte ihn aus und erwiderte ihm, dass er - Dr. Entress - darüber nicht bestimmen könne, das sei Sache des Standortarztes. Der Angeklagte Scherpe begab sich am nächsten Tag zu dem Standortarzt und trug ihm vor, er möchte vom Dienst im HKB abgelöst werden. Der Standortarzt antwortete ihm, das ginge nicht, weil er nicht genügend Personal habe. Er - Scherpe - müsse daher im HKB bleiben. Der Angeklagte Scherpe fand sich mit dieser Erklärung seines Standortarztes ab. In der Folgezeit nahm er nur noch einmal - wie er unwiderlegt angibt - an einer "Untersuchung" der Arztvorsteller durch den Lagerarzt Dr. Entress teil. Er ging jedoch auf Befehl des SS-Lagerarztes in den folgenden Monaten bis Oktober 1942 mindestens zweimal wöchentlich zur Tötung der von Dr. Entress bei den sog. Arztvorstellern ausgesuchten kranken und schwachen jüdischen Häftlingen auf den Block 20. Er begab sich jeweils mit einer Flasche Phenol und der Liste der ausgesonderten Häftlinge, die er sich von einem Häftlingsschreiber geben liess, durch den Haupteingang des Blockes 20 in das Zimmer Nr.1 in diesem Block. In dieses Zimmer wurden dann die bereits im Flur oder grossen Waschraum wartenden nackten Häftlinge nacheinander hereingeführt und durch Phenolinjektionen - wie es bereits unter O.II.1. beschrieben worden ist - getötet. Häufig gaben Funktionshäftlinge den Opfern die tödlichen Spritzen. Der Angeklagte Scherpe führte dann nur die Aufsicht. Zuvor hatte er jeweils den Funktionshäftlingen das Phenol ausgehändigt. An mindestens zwei Tagen tötete der Angeklagte jedoch eigenhändig die Opfer, indem er ihnen die Nadel der mit Phenol gefüllten Rekordspritze in das Herz stiess und anschliessend das Phenol unmittelbar in das Herz spritzte. Er hat auf diese Weise mindestens insgesamt zehn Häftlinge eigenhändig getötet. Unter seiner Aufsicht sind mindestens weitere 170 Häftlinge durch Funktionshäftlinge getötet worden, so dass die Gesamtzahl der Opfer, die in seiner Anwesenheit getötet worden sind, mindestens 180 beträgt.
Der Angeklagte Scherpe wusste, dass die von dem Lagerarzt Dr. Entress ausgesuchten kranken und schwachen jüdischen Häftlinge nur als unnütze Esser beseitigt werden sollten und getötet wurden, weil sie wegen Ausfalls ihrer Arbeitskraft nicht mehr nützlich erschienen.
2. Die Tötung von mindestens 20 polnischen Knaben durch den Angeklagten Scherpe
Als der Angeklagte Scherpe im Februar oder März 1943 den Angeklagten Hantl im HKB vertreten musste, wurden einmal polnische Knaben im Alter zwischen 8-14 Jahren in das Stammlager gebracht. Sie stammten aus Zamocz. Diese Stadt liegt im ehemaligen Generalgouvernement. Welches der Anlass für die Verschickung der Kinder aus Zamocz in das KL Auschwitz gewesen ist, ist nicht völlig geklärt worden. Wahrscheinlich waren sie Opfer der nationalsozialistischen Germanisierungspolitik.
Himmler, der ursprünglich das Generalgouvernement als Reservat für Polen, Juden und andere unerwünschte Personengruppen bestimmt hatte, dehnte nach Ausbruch des Krieges gegen die Sowjetunion seine Germanisierungspolitik - in Abänderung seiner ursprünglichen Konzeption, wonach nur die eingegliederten Ostgebiete als deutscher Siedlungsraum dienen sollten - auch auf das Generalgouvernement aus. Als erstes Siedlungsgebiet im Generalgouvernement wurde der Distrikt Lublin und der Kreis Zamocz ausersehen. Am 20.7.1941 gab Himmler eine streng geheime Weisung heraus, dass der Distrikt Lublin und der Kreis Zamocz das erste grosse deutsche Grosssiedlungsgebiet im Generalgouvernement sein solle. Ende 1942 wurde auf Befehl Himmlers mit der gewaltsamen Aussiedlung von Polen und der Ansiedlung von deutschen Umsiedlern im Kreis Zamocz begonnen. Die polnische Bevölkerung wurde in vier Wertungsgruppen eingeteilt. Die Angehörigen der Wertungsgruppen I und II sollten nach Litzmannstadt zur Eindeutschung bzw. "Feinmusterung" (d.h. zur Überprüfung ihrer Tauglichkeit für die Eindeutschung) gebracht werden. Die arbeitsfähigen Angehörigen (14-60 Jahre) der Wertungsgruppe III sollten in das Reich zum Arbeitseinsatz kommen. Die nicht arbeitsfähigen Angehörigen der Wertungsgruppe III und IV (Kinder und Personen über 60 Jahre) sollten in sog. Rentendörfern untergebracht werden. Schliesslich sollten die Angehörigen der Wertungsgruppe IV im Alter von 14-60 Jahren in das KL Auschwitz befördert werden. Tatsächlich wurden im Rahmen dieser Aktion von Zamocz im Dezember 1942 644 Personen in das KL Auschwitz gebracht.
Ob die polnischen Kinder aus Zamocz unter den 644 Angehörigen der Wertungsgruppe IV (die an sich 14-60 Jahre alt sein sollten) mit nach Auschwitz (vielleicht aus Versehen) deportiert worden sind, war nicht zu klären. Es konnte auch nicht festgestellt werden, wann sie überhaupt in das KL Auschwitz gebracht worden sind. Möglicherweise sind sie bei der Aktion im Kreise Zamocz von ihren Eltern getrennt worden und man wusste nicht, was man mit ihnen anfangen sollte.
Fest steht jedenfalls, dass die Kinder schliesslich im KL Auschwitz auf unauffällige Weise "liquidiert" werden sollten. Wer den Tötungsbefehl gegeben hat, konnte ebenfalls nicht geklärt werden. Wahrscheinlich kam er von der politischen Abteilung oder irgend einer Gestapoleitstelle.
Eines Tages, Ende Februar oder Anfang März 1943, wurden die polnischen Knaben zum HKB gebracht. Sie übernachteten eine Nacht auf dem Block 20. Am nächsten Morgen spielten sie eine Zeitlang auf dem Hof zwischen Block 20 und 21 mit einem Ball. Der Angeklagte Scherpe erhielt am Morgen dieses Tages von dem Lagerarzt Dr. Rohde, der zu dieser Zeit Dienst im HKB des Stammlagers als SS-Lagerarzt machte, den Befehl, die Kinder durch Phenolinjektionen zu töten. Der Angeklagte Scherpe weigerte sich zunächst mit dem Hinweis, dass er das nicht machen könne. Er erklärte dem Lagerarzt Dr. Rohde, er werde den Dienst verweigern, er möchte sofort abgelöst werden, er würde Meldung machen. Dr. Rohde verliess daraufhin wortlos den HKB. Am Nachmittag kam er zurück und erklärte dem Angeklagten Scherpe, es bliebe dabei, die Kinder müssten getötet werden. Der Angeklagte Scherpe gab sich damit zufrieden. Er ging mit einer Flasche Phenol auf das Zimmer Nr.1 in den Block 20 und liess sich dann von dem Zeugen Glo., der zu dieser Zeit noch Häftlingsschreiber in dem Block 20 war, die Kinder einzeln in das Zimmer Nr.1 hereinführen. Zwei Funktionshäftlinge assistierten ihm. Dann tötete er eigenhändig mindestens 20 Kinder, indem er ihnen mit der Rekordspritze Phenol unmittelbar in das Herz einspritzte. Die Kinder wurden unschuldig getötet. Gegen sie lag kein Gerichtsurteil vor. Die Kinder waren ahnungslos. Sie wussten nicht, als sie in den Block 20 und danach einzeln in das Zimmer Nr.1 geführt wurden, was ihnen bevorstand. Sie liessen sich daher widerstandslos töten.
Nachdem der Angeklagte Scherpe mindestens 20 Kinder durch Phenolinjektionen getötet hatte, brach er die Tötungsaktion ab. Er war seelisch nicht mehr in der Lage, weitere Kinder zu töten. Er lief völlig verstört und aufgeregt zunächst auf das Arztzimmer im Block 20 und begab sich unmittelbar danach zu dem Standortarzt Dr. Wirths. Diesem erstattete er Meldung über die Tötung der Kinder und bat darum, von der weiteren Durchführung der Aktion befreit zu werden. Dr. Wirths nahm die Meldung des Angeklagten Scherpe ruhig entgegen. Er rief den Spiess des Standortarztes, O., hinzu und setzte dann im Beisein des Angeklagten Scherpe ein Schreiben auf, in welchem er die Angaben des Angeklagten Scherpe niederlegte. Dann erklärte er dem Angeklagten Scherpe, er bekäme wegen der Meldung noch Bescheid. Kurz danach versetzte er den Angeklagten in das Nebenlager Golleschau.
Später wurde der Angeklagte wegen der Tötung der Kinder von einem SS-Führer, der im KL Auschwitz Ermittlungen wegen des Verdachtes von Verbrechen und Vergehen der im KL Auschwitz beschäftigten SS-Angehörigen durchführte, vernommen. Dabei gab der Angeklagte alles an, was er bereits dem Standortarzt Dr. Wirths gemeldet hatte. Im August 1943 wurde der Angeklagte Scherpe vor das SS-Gericht nach Weimar geladen. Dort wurde er befragt, ob er noch zu seiner Meldung über die Tötung der Kinder stehe. Der Angeklagte Scherpe bejahte dies. Weitere Feststellungen bezgl. dieses Gerichtsverfahrens konnten nicht getroffen werden.
3. Die Mitwirkung des Angeklagten Scherpe bei der Vernichtung der 700 Infektionskranken aus Block 20 (Eröffnungsbeschluss Ziffer 2)
Der Angeklagte Scherpe hat auch an der Aktion gegen die 700 Fleckfieberkranken aus dem Block 20 am 29.8.1942 teilgenommen. Er hat ebenso wie der Angeklagte Klehr dem Lagerarzt Dr. Entress assistiert. Wie bereits unter O.II.5. ausgeführt worden ist, passte er - ebenso wie der Angeklagte Klehr - auf, dass keiner der für den Tod bestimmten Häftlinge sich zu der Gruppe, die in das Lager entlassen werden sollte, schlich und so der Vergasung entging. Er achtete auch darauf, dass die Opfer nicht von Funktionshäftlingen gerettet wurden. Bei der Verladung der Opfer auf die LKWs stand er ebenfalls dabei und sorgte für eine reibungslose Durchführung der Aktion. Es konnte jedoch nicht festgestellt werden, dass er - wie der Angeklagte Klehr - Häftlinge mit Gewalt auf die LKWs gezerrt hat. Als die LKWs mit den ersten Opfern weggefahren waren, überwachte er - wie ebenfalls schon unter O.II.5. ausgeführt worden ist - zusammen mit dem Angeklagten Klehr die zunächst noch zurückgebliebenen Häftlinge, die erst später von den LKWs weggebracht werden sollten. Er achtete darauf, dass keiner von ihnen weglief oder von einem Häftlingsarzt oder Häftlingspfleger gerettet wurde. Der Angeklagte Scherpe wusste, dass die kranken Häftlinge unschuldig nur deswegen getötet wurden, weil sie an einer ansteckenden Krankheit litten und deswegen eine Ansteckungsgefahr für die SS-Angehörigen bildeten.
III. Einlassung des Angeklagten Scherpe, Beweismittel, Beweiswürdigung
1.
Die Feststellungen zum Lebenslauf des Angeklagten Scherpe beruhen auf seiner Einlassung sowie einem von ihm am 6.5.1941 eigenhändig geschriebenen Lebenslauf, der in der Hauptverhandlung verlesen worden ist.
2. Zu II.1.
Die Feststellungen unter II.1. beruhen auf der Einlassung des Angeklagten Scherpe, soweit ihr gefolgt werden konnte, sowie der glaubhaften Aussage des Zeugen Dr. P.
Der Angeklagte Scherpe hat eingeräumt, dass ihn der Angeklagte Klehr zu Beginn seiner Tätigkeit im HKB zu einer "Untersuchung" der Neukranken durch den Lagerarzt Dr. Entress in den Block 28 mitgenommen habe und dass er - der Angeklagte - dort die Auswahl bestimmter Häftlinge durch den Lagerarzt für die Tötung mit Phenol miterlebt habe. Er hat weiter zugegeben, dass er anschliessend von dem Angeklagten Klehr zur Tötung dieser Häftlinge auf den Block 20 mitgenommen worden sei und mit angesehen habe, wie die Häftlinge durch Phenolinjektionen getötet worden seien.
Der Angeklagte Scherpe hat sich dann weiter dahin eingelassen, dass er darüber so entsetzt gewesen sei, dass er sich noch am gleichen Tage bei Dr. Entress gemeldet und ihm mitgeteilt habe, dass er den Dienst im HKB nicht übernehmen könne. Da ihn Dr. Entress vom Dienst im HKB jedoch nicht habe entbinden können, habe er sich bei dem Standortarzt gemeldet und um seine Ablösung gebeten. Der Standortarzt habe ihm erklärt, er - der Angeklagte - müsse im HKB bleiben, da nicht genügend Personal für diesen Dienst vorhanden sei.
Das Gericht hat dem Angeklagten Scherpe diese Einlassung geglaubt. Denn nach den Aussagen einer Reihe von Zeugen war der Angeklagte Scherpe seiner Persönlichkeit nach das Gegenteil des Angeklagten Klehr. Er verhielt sich den Häftlingen gegenüber menschlich und anständig. Der Zeuge Glo. hat ihn als einen ruhigen, höflichen SDG geschildert, der die Häftlinge im Gegensatz zu dem Angeklagten Klehr nie geschlagen habe. Er sei - so hat der Zeuge erklärt - im Vergleich zum Angeklagten Klehr wie ein Engel gewesen. Die Zeugen F. und Kruc. - letzterer hat den Angeklagten Scherpe später im Nebenlager Golleschau kennengelernt - haben übereinstimmend bekundet, dass der Angeklagte Scherpe den Funktionshäftlingen, aber auch den Kranken gegenüber gut und anständig gewesen sei. Der Zeuge Kruc. hat betont, dass er auch Juden gegenüber freundlich gewesen sei. Daraus ergibt sich, dass der Angeklagte Scherpe die allgemeine Missachtung und Diffamierung jüdischer Häftlinge im KL Auschwitz nicht mitgemacht hat. Auch die Zeugen de Ma., Dr. Kl. und Gl. haben den Angeklagten Scherpe als einen ruhigen, natürlichen und zurückhaltenden SDG geschildert. Der Zeuge Glo. hat noch eine Besonderheit hervorgehoben, dass der Angeklagte Scherpe die Häftlinge, wenn er morgens auf den Block gekommen sei und abends wenn er den Block wieder verlassen habe, sogar gegrüsst habe. Das war man im KL Auschwitz nicht gewöhnt. Bei der Persönlichkeit des Angeklagten Scherpe, wie sie sich aus diesem seinem allgemeinen Verhalten im KL Auschwitz ergibt, erscheint es daher glaubhaft, dass er sich zu Beginn seiner Tätigkeit im HKB über die Tötung von unschuldigen Menschen entsetzt hat und bestrebt war, von einem Dienst, der ihn in Tötungshandlungen verstricken konnte, befreit zu werden.
Der Angeklagte Scherpe hat sich weiter dahin eingelassen, dass er bei Selektionen von Arztvorstellern durch den Lagerarzt nur noch ein zweites Mal dabei gewesen sei, ohne allerdings eine besondere Tätigkeit auszuüben. Dies konnte ihm nicht widerlegt werden. Denn die Beweisaufnahme hat nicht ergeben, dass er darüber hinaus an Selektionen teilgenommen oder - wie der Angeklagte Klehr - sogar selbständig im HKB selektiert habe. Der Zeuge Rei. hat zwar erklärt, er habe gehört, dass der Angeklagte Scherpe auch Selektionen gemacht haben solle. Der Zeuge musste aber einräumen, dass er selbst den Angeklagten Scherpe bei diesen Selektionen nicht gesehen hat. Der Zeuge konnte auch nicht mehr angeben, wer ihm von solchen Selektionen des Angeklagten Scherpe berichtet hat. Es kann sich daher um nicht nachprüfbares allgemeines Gerede oder um Gerüchte gehandelt haben. Sichere Feststellungen lassen sich darauf nicht stützen.
Der Zeuge Ta. will den Angeklagten Scherpe bei "Selektionen" von Arztvorstellern gesehen haben. Bei solchen Selektionen sei der Angeklagte Scherpe - so hat der Zeuge erklärt - ohne Anwesenheit eines Lagerarztes gewesen. Der Zeuge hat jedoch nicht bestätigt, dass der Angeklagte Scherpe bei diesen sog. "Selektionen" tatsächlich Karteikarten von kranken Häftlingen ausgesondert hat und kranke Häftlinge auf Block 20 hat abführen und dort töten lassen. Er hat die Tätigkeit des Angeklagten Scherpe bei solchen angeblichen Selektionen nur in der Richtung beschrieben, dass der Angeklagte Scherpe darüber entschieden habe, ob jemand in den HKB aufgenommen oder wieder in das Lager zurückgeschickt werden solle. Nach der Aussage des Zeugen ist es daher möglich, dass der Angeklagte Scherpe gelegentlich bei den Neukranken, wenn der Lagerarzt aus irgend einem Grunde nicht erschienen war, mit den Häftlingsärzten nur darüber beraten hat, was mit den Neukranken geschehen solle und zwar in der Richtung, ob eine Aufnahme in den HKB notwendig oder ob ambulante Behandlung ausreichend sei. Es steht jedoch nicht fest, dass bei diesen Gelegenheiten auch Häftlinge zum Zwecke der Tötung ausgesondert worden sind. Bei der Persönlichkeit des Angeklagten Scherpe, wie sie von den oben genannten Zeugen geschildert worden ist, erscheint es auch unwahrscheinlich, dass er ohne Befehl und aus eigenem Ermessen Häftlinge zur Tötung bestimmt hat.
Der Zeuge Glo. wusste nichts davon, dass der Angeklagte Scherpe eigenmächtig selektiert habe. Allerdings will er einmal gesehen haben, dass der Angeklagte Scherpe auf Block 20 Menschen von der Typhusabteilung abgeholt und zur "Abspritzung" d.h. zur Tötung mit Phenol gebracht habe. Das hätte sie sehr verwundert und hätte ihnen zu denken gegeben. Aus dieser Aussage ergibt sich nicht, dass der Angeklagte Scherpe diese Kranken eigenmächtig selektiert und zur Tötung bestimmt hat. Es ist denkbar, dass sie bereits vorher vom Lagerarzt Dr. Entress zur Tötung ausgewählt und von dem Angeklagten Scherpe anhand einer Liste zur Tötung weggebracht worden sind. Der Zeuge musste auch einräumen, dass er diese Möglichkeit nicht ausschliessen könne.
Im übrigen erscheint der Zeuge - wie schon oben ausgeführt - nicht zuverlässig genug, um auf seine Aussage sichere Feststellungen stützen zu können. Der Zeuge hat viele Dinge, die er nur von anderen im KL Auschwitz oder später gehört und erfahren hat, als eigenes Erleben - wahrscheinlich ohne sich dessen bewusst zu sein - geschildert. Er hat sich in Widersprüche zu anderen Zeugenaussagen verwickelt. Auch in diesem Fall erscheint es nicht ausgeschlossen, dass er Dinge berichtet hat, die er nur vom Hörensagen weiss. Darauf deutet hin, dass er hinzugefügt hat: "Das hat "uns" zu denken gegeben und hat "uns" verwundert."
Die russischen Zeugen Mi. und Was. wollen den Angeklagten Scherpe im Februar 1942 bei einer Kommission gesehen haben, die in dem im Stammlager für die russischen Kriegsgefangenen eingerichteten Lagerteile, und zwar im Krankenbau Block 14, nackte russ. Kriegsgefangene für die Tötung ausgesucht hätte. Bei dieser Selektion hätten 8 SS-Männer um einen Tisch herumgesessen. Unter ihnen sei auch der Angeklagte Scherpe gewesen. Der Zeuge Was. will von Häftlingsärzten erfahren haben, dass einer der 8 SS-Männer der Angeklagte Scherpe gewesen sei. Auch der Zeuge Mi. hat behauptet, dass der Angeklagte Scherpe zu dieser Kommission, die nackte Häftlinge für die Tötung ausgesucht hätte, gehört habe. Es erscheint jedoch unwahrscheinlich, dass der Angeklagte Scherpe bei dieser Selektion dabei gewesen ist. Denn es konnte nicht festgestellt werden, dass er bereits im Februar 1942 in den HKB gekommen ist. Das Schwurgericht konnte sich auch nicht davon überzeugen, dass die beiden Zeugen damals den Angeklagten Scherpe gekannt haben. Der Zeuge Mi. hat den Angeklagten Scherpe als einen kleinen Mann geschildert, der kleiner als Klehr und von gedrungener Gestalt gewesen sei. Tatsächlich ist der Angeklagte Scherpe jedoch grösser als der Angeklagte Klehr und nicht von gedrungener Gestalt. In der Hauptverhandlung hat der Zeuge den Angeklagten Scherpe bei der Gegenüberstellung nicht wiedererkannt. Der Zeuge Was. hat den Angeklagten Scherpe damals überhaupt nicht gekannt. Seinen Namen will er von Häftlingsärzten erfahren haben. Möglicherweise ist ihm irrtümlich irgend ein anderer SS-Mann als der Angeklagte Scherpe bezeichnet worden. Ungewöhnlich erscheint auch, dass eine Kommission von 8 SS-Männern kranke russische Kriegsgefangene zur Tötung ausgesucht haben soll. Selektionen bei kranken Häftlingen im HKB wurden nach den Aussagen der im HKB beschäftigten Häftlingsärzte und Häftlingspfleger in der Regel vom SS-Lagerarzt unter Assistenz eines SDG oder nur durch den Angeklagten Klehr (eigenmächtig) durchgeführt. Wenn in dem von den beiden Zeugen geschilderten Fall 8 SS-Männer an der Selektion teilgenommen haben, so spricht das eher dafür, dass diese Kommission nach russ. Kommissaren gesucht hat. Wahrscheinlich wurden bei dieser Gelegenheit nicht kranke und schwache Kriegsgefangene zur Tötung ausgesondert, sondern die Selektion erfolgte nach anderen Gesichtspunkten durch ein besonderes Einsatzkommando auf Grund des OKW-Befehls vom 6.6.1941 und den danach ergangenen Richtlinien über die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener (vgl. auch oben 2. Abschnitt VII.3.). Es erscheint ausserordentlich unwahrscheinlich, dass der Angeklagte Scherpe zu einem solchen Einsatzkommando gehört hat.
Es konnte auch nicht festgestellt werden, dass der Angeklagte Scherpe im Nebenlager Golleschau als SDG kranke Häftlinge zur Tötung ausgesucht hat. Der Zeuge August Klehr, der im Nebenlager Golleschau als Blockführer tätig war, wusste nichts davon, dass der Angeklagte Scherpe im HKB Golleschau Selektionen durchgeführt habe. Er will sich allerdings auch nicht um den HKB gekümmert haben. Der Zeuge Kruc., der als Häftling im Nebenlager Golleschau war und den Angeklagten Scherpe - wie oben bereits ausgeführt - günstig beurteilt hat, hat bekundet, dass in Golleschau zwar Selektionen im HKB vorgekommen seien. Der Häftlingsarzt Dr. Rubinstein habe zusammen mit einem Sanitäter arbeitsunfähige Häftlinge ausgesondert. Diese seien nach Auschwitz gekommen. Es sei jedoch nicht gesagt worden, dass sie zur Vergasung kämen. Da der Angeklagte Scherpe als SDG in Golleschau gewesen ist, müsste er derjenige gewesen sein, der zusammen mit dem Häftlingsarzt Dr. Rubinstein kranke und schwache Häftlinge ausgesucht und nach Auschwitz geschickt hat. Nach der Aussage des Zeugen Kruc. ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Kranken in den HKB nach Auschwitz (Stammlager) und nicht zur Vergasung gekommen sind. Hierfür spricht immerhin, dass sie - jedenfalls nach dem, was der Zeuge Kruc. gehört hat - nicht nach Birkenau, sondern nach Auschwitz gebracht worden sind. Der Zeuge Kruc. hat auch noch erklärt, es sei in Golleschau nicht gesagt worden, dass der Angeklagte Scherpe eigenmächtig und selbständig Selektionen gemacht habe.
Es kann somit nicht festgestellt werden, dass der Angeklagte Scherpe eigenmächtig im HKB oder im Nebenlager Golleschau Häftlinge zur Tötung mit Phenol oder zur Vergasung ausgesucht und über die beiden von ihm zugegebenen Fälle hinaus bei Selektionen durch den Lagerarzt oder durch andere SS-Angehörige dabeigewesen ist.
Die Beweisaufnahme hat jedoch ergeben, dass der Angeklagte Scherpe bei der Tötung von Häftlingen durch Phenolinjektionen im Zimmer 2 des Blockes 20 anwesend war. Der Angeklagte Scherpe gibt dies selbst zu. Er hat eingeräumt, dass er in der Zeit von Anfang Mai bis zum 7.Oktober 1942 - mit Ausnahme von zwei bis drei Wochen im Juli oder August 1942, als nämlich der Lagerarzt Dr. Entress im Urlaub gewesen sei - wöchentlich zweimal zu dem Zimmer Nr.1 im Block habe gehen und dort die Tötung von Häftlingen, die der Lagerarzt bei der morgendlichen "Untersuchung" ausgewählt habe, habe beaufsichtigen müssen. Er hat auch zugegeben, dass er das Phenol, mit dem die Häftlinge getötet worden sind, mit auf den Block 20 genommen und den Funktionshäftlingen ausgehändigt habe. Allerdings will er nie eigenhändig Häftlinge getötet haben. Vielmehr hätten stets Funktionshäftlinge - so hat er sich eingelassen - die Phenolinjektionen gegeben.
Es steht somit schon auf Grund der eigenen Einlassung des Angeklagten Scherpe fest, dass er in einer unbestimmten Anzahl von Fällen Tötungsaktionen im Zimmer Nr.1 des Blockes 20 beaufsichtigt und das für diese Aktionen erforderliche Phenol den Funktionshäftlingen zur Verfügung gestellt hat.
Es kann dem Angeklagten Scherpe geglaubt werden, dass er in vielen Fällen die Tötungen durch Phenol von Funktionshäftlingen hat ausführen lassen. Denn nach den Aussagen der Zeugen de Ma. und Dr. F. wurden Phenolinjektionen auch von Funktionshäftlingen gegeben. Im HKB war damals allgemein bekannt, dass - wie schon bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Klehr ausgeführt worden ist - die Funktionshäftlinge Stössel und Panczyk eine grosse Anzahl von kranken und schwachen jüdischen Häftlingen eigenhändig durch Phenolinjektionen getötet haben. Nach der glaubhaften Aussage des Zeugen Dr. F. haben sich diese beiden Funktionshäftlinge - ebenso wie der Angeklagte Klehr - sogar damit gebrüstet, dass sie eine gewisse Fertigkeit in dieser Tötungsart erlangt hätten. Ausser diesen beiden Funktionshäftlingen war noch ein Häftling namens Schumkowiak im HKB, der ebenfalls Häftlinge auf Befehl der SS durch Phenolinjektionen eigenhändig getötet hat. Das hat der Zeuge Glo. bekundet. Gelegentlich, jedoch in erheblich kleinerem Umfang, hat schliesslich noch ein Häftling namens Landau - so hat der Zeuge Glo. weiter berichtet - tödliche Phenolinjektionen gegeben. Es erscheint daher glaubhaft, dass sich der Angeklagte Scherpe, der nur widerstrebend an der Tötung von kranken und schwachen Häftlingen mitgewirkt hat, soweit wie möglich, bei den durchzuführenden Vernichtungsaktionen sich dieser Häftlinge bedient hat, um nicht selbst die tödlichen Phenolinjektionen geben zu müssen.
Gleichwohl hat das Gericht auf Grund der Beweisaufnahme die Überzeugung gewonnen, dass der Angeklagte Scherpe - entgegen seiner Einlassung - zumindest in einigen Fällen, auch eigenhändig die vom Lagerarzt Dr. Entress zur Tötung bestimmten Häftlinge durch Phenolinjektionen auf dem Zimmer Nr.1 im Block 20 getötet hat.
Allerdings hat kein zuverlässiger Zeuge den Angeklagten Scherpe dabei beobachtet, wie er den Opfern die Nadel der Rekordspritze in das Herz gestossen hat. Nur der Zeuge Gl. will dies gesehen haben. Dieser Zeuge ist jedoch nicht zuverlässig genug, um auf seine Aussage sichere Feststellungen stützen zu können. Die Aussage des Zeugen Gl. ist bereits bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Dylewski gewürdigt worden. In diesem Zusammenhang ergeben sich weitere Zweifel an seiner Zuverlässigkeit. So will er mit eigenen Augen gesehen haben, wie der Angeklagte Scherpe Kinder im Zimmer Nr.1 des Blockes 20 (worauf noch zurückzukommen sein wird) getötet habe. Der Zeuge Glo., der die Kinder in das Zimmer Nr.1 hineinführen musste, was auch der Angeklagte bestätigt hat, hat den Zeugen Gl. während dieser Aktion aber überhaupt nicht gesehen. Er hätte ihn aber sehen müssen, wenn Dr. Gl. tatsächlich anwesend gewesen wäre. Denn, wenn der Zeuge Glo. die Kinder bis zu dem Zimmer Nr.1 geführt hat, hätte er zwangsläufig dem Zeugen Gl. begegnen müssen, wenn dieser tatsächlich die Aktion selbst mit angesehen hätte. Denn der Zeuge Gl. hätte seine Beobachtungen nur vom Flur des Blockes 20 aus machen können, da er als Leichenträger nicht zu den assistierenden Funktionshäftlingen gehörte und daher nicht im Zimmer Nr.1 selbst hat sein können. Als Leichenträger hätte er allenfalls von der Tür des Zimmer Nr.1 die Leichen aus dem Zimmer abholen können. Dabei hätte er dem Zeugen Glo. begegnen müssen. Die Aussage des Zeugen Gl. kann daher insoweit nicht richtig sein. Wahrscheinlich nimmt der Zeuge Gl. auf Grund von Berichten, die er damals sowohl im Lager und auch nach seiner Lagerzeit erhalten haben mag, nach so langer Zeit irrtümlich an, er habe diese Aktion selbst miterlebt.
Ist aber seine Aussage in diesem Punkt nicht richtig, kann sie auch insoweit nicht als zuverlässig angesehen werden, als er behauptet, den Angeklagten Scherpe auch in anderen Fällen beim Geben von Phenolinjektionen gesehen zu haben.
Aus Beobachtungen, die der zuverlässige Zeuge Dr. P. gemacht hat, hat jedoch das Gericht den Schluss gezogen, dass der Angeklagte Scherpe auch eigenhändig Häftlinge durch Phenolinjektionen getötet hat.
Der Zeuge Dr. P. musste - wie er glaubhaft bekundet hat - mehrfach als Häftlingsschreiber dem Angeklagten Scherpe etwas ausrichten, wenn dieser gerade während der Tötung von Häftlingen im Zimmer Nr.1 war. Der Zeuge P. ging dann jeweils vom Block 21, in dem sich die Schreibstube befand, über den Hof zwischen Block 21 und 20 durch den Mitteleingang in den Block 20 hinein. Dann ging er an den im Flur wartenden nackten Häftlingen vorbei und betrat, nachdem er den Vorhang im Flur passiert hatte, das Zimmer Nr.1. Dort traf er nach seiner glaubhaften Bekundung mehrfach den Angeklagten Scherpe an, wie er mit einer Gummischürze bekleidet und mit Gummihandschuh an der Hand gerade die Rekordspritze in der Hand hielt.
Diese vom Zeugen Dr. P. glaubhaft geschilderten
Umstände sprechen nach Auffassung des Schwurgerichts eindeutig dafür, dass an diesen Tagen der Angeklagte Scherpe die vom Lagerarzt Dr. Entress selektierten Häftlinge eigenhändig getötet hat, auch wenn der Zeuge nicht selbst hat beobachten können, dass der Angeklagte Scherpe einem Häftling die Nadel der Spritze in das Herz gestossen hat. Denn wenn der Angeklagte Scherpe nur die Aufsicht geführt hätte, hätte für ihn kein Anlass bestanden, Gummischürze und Gummihandschuhe zu tragen. Es gäbe auch keine überzeugende Erklärung dafür, dass er die Rekordspritze in der Hand gehalten hat. Denn bei seiner Stellung als SS-Unterscharführer kann nicht angenommen werden, dass er sich als Gehilfe eines Funktionshäftlings betätigt und für diesen die Rekordspritze aufgezogen hat.
Wie oft der Angeklagte Scherpe eigenhändig Häftlinge getötet hat, konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Der Zeuge Dr. P. konnte keine sicheren Angaben mehr darüber machen, an wieviel Tagen er den Angeklagten Scherpe in der geschilderten Situation angetroffen hat. Da dies jedoch nach seiner glaubhaften Aussage nicht nur einmal sondern mehrfach geschehen ist, kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass der Angeklagte Scherpe mindestens an zwei verschiedenen Tagen die vom Lagerarzt Dr. Entress zur Tötung bestimmten Häftlinge eigenhändig getötet hat. Da stets bei den sog. Selektionen der sog. Arztvorsteller mindestens 5 Häftlinge zur Tötung ausgewählt worden sind, ist mit Sicherheit festzustellen, dass der Angeklagte Scherpe mindestens insgesamt 10 Häftlinge eigenhändig getötet hat.
Die Feststellung des Gerichts, dass in Anwesenheit des Angeklagten Scherpe im Zimmer Nr.1 des Blockes 20 insgesamt mindestens 180 Häftlinge, die vom Lagerarzt Dr. Entress zur Tötung bestimmt worden waren, getötet worden sind (wovon er mindestens 10 eigenhändig getötet hat, während die restlichen 170 unter seiner Aufsicht von Funktionshäftlingen umgebracht worden sind) beruht auf der Einlassung des Angeklagten Scherpe und auf folgender Überlegung: Nach der Einlassung des Angeklagten Scherpe hat er von Anfang Mai bis zum 7.10.1942 zweimal wöchentlich die Tötung von Häftlingen im Zimmer Nr.1 des Blockes 20 beaufsichtigt. Zieht man in Betracht, dass nach der unwiderlegten Einlassung des Angeklagten im Juli oder August 1942 während eines Zeitraumes von zwei bis drei Wochen keine Selektions- und Tötungshandlungen vorgekommen sind, so ergibt sich, dass der Angeklagte Scherpe während eines Zeitraumes von mindestens 18 Wochen wöchentlich zweimal bei Tötungsaktionen anwesend gewesen ist. Da von dem Lagerarzt Dr. Entress bei den Arztvorstellern stets mindestens 5 Häftlinge (in den meisten Fällen jedoch erheblich mehr) zur Tötung ausgewählt worden sind, ergibt sich eine Mindestzahl von 180 Häftlingen, die teils unter der Aufsicht des Angeklagten Scherpe, teils von ihm selbst (mindestens 10) durch Phenol getötet worden sind.
Die Feststellung, dass der Angeklagte Scherpe den Grund für die Tötung der kranken und schwachen jüdischen Häftlinge gekannt hat, ergibt sich aus der gesamten damaligen Situation. Ihm kann nicht verborgen geblieben sein, dass diese jüdischen Häftlinge nur deswegen beseitigt wurden, weil sie wegen des Ausfalls ihrer Arbeitskraft unnütz erschienen und als Belastung des Lagers galten. Denn ein sonstiger Grund wurde ihm nicht genannt. Auch lag nichts gegen die Häftlinge vor. Sie hatten sich nichts zu schulden kommen lassen. Der Angeklagte Scherpe hat auch nicht behauptet, dass er über den Grund der Tötungsaktionen nicht informiert gewesen sei.
3. Zu II.2.
Die Feststellungen unter II.2. beruhen auf der Einlassung des Angeklagten Scherpe, soweit ihr gefolgt werden konnte, den Aussagen der Zeugen Glo., Dr. F., Dr. P., Dr. Kl. und Woy. sowie dem Sachverständigengutachten des Sachverständigen Dr. Broszat über die nationalsozialistische Polenpolitik. Auf Grund der Einlassung des Angeklagten Scherpe steht zunächst fest, dass man im Februar oder März 1943 eine Gruppe polnischer Knaben in den HKB gebracht hat. Der Angeklagte Scherpe hat angegeben, dass er eines Morgens, als er zum Dienst in den HKB gekommen sei, Kinder im Hof zwischen Block 20 und 21 habe spielen sehen. Seine Einlassung wird bestätigt durch die Bekundungen der Zeugen Woy. und Dr. Kl. Beide Zeugen haben die Kinder ebenfalls auf dem Hof zwischen Block 20 und 21 gesehen.
Der Zeuge Kl. konnte sich noch erinnern, dass irgend jemand den Kindern einen Ball besorgt habe und dass die Kinder mit dem Ball gespielt hätten. Er hat erfahren, dass die Kinder aus Zamocz stammten.
Der Angeklagte Scherpe hat das Alter der Kinder auf 10-14 Jahre geschätzt. Der Zeuge Woy. hat gemeint, dass sie zwischen 8-12 Jahre alt gewesen seien.
Aus der Einlassung des Angeklagten Scherpe ergibt sich weiter, dass die Kinder zum Zwecke der Tötung in den HKB gebracht worden sind. Denn der damalige Lagerarzt Dr. Rohde erklärte dem Angeklagten Scherpe - wie dieser sich weiter eingelassen hat - dass die Kinder "abgespritzt" d.h. durch Phenol getötet werden sollten. Der Angeklagte Scherpe will sich darüber sehr erregt haben und Dr. Rohde erklärt haben, er verweigere den Dienst, er mache sofort Meldung, er möchte abgelöst werden. Dr. Rohde habe daraufhin - so hat der Angeklagte Scherpe weiter ausgesagt - wortlos den HKB verlassen. Erst am Nachmittag sei er zurückgekommen und habe erklärt, es bleibe dabei, die Kinder würden getötet. Zeugen für dieses Gespräch zwischen Dr. Rohde und dem Angeklagten Scherpe sind nicht vorhanden. Die Angaben des Angeklagten Scherpe scheinen jedoch insoweit glaubhaft. Denn nach der Aussage des Zeugen Dr. Kl. sind die Kinder erst am Nachmittag in Block 20 geführt worden. Das spricht für die Einlassung des Angeklagten Scherpe. Denn die Tatsache, dass die Kinder erst am Nachmittag in den Block 20 gebracht worden sind, obwohl sie bereits morgens auf dem Hof zwischen Block 20 und 21 gespielt haben, deutet darauf hin, dass am Vormittag irgend ein Ereignis die Verbringung der Kinder in den Block 20 verzögert haben muss. Normalerweise gab der Lagerarzt bereits am Vormittag zwischen 8 und 9.00 Uhr seine Anweisungen. Das Gericht hat daher dem Angeklagten Scherpe insoweit geglaubt.
Fest steht weiter auf Grund der Einlassung des Angeklagten Scherpe, dass ein Teil der Kinder am Nachmittag des betreffenden Tages auch tatsächlich im Zimmer Nr.1 des Blockes 20 durch Phenolinjektionen getötet worden ist. Denn der Angeklagte Scherpe hat eingeräumt, dass die Kinder im Zimmer Nr.1 des Blockes 20 durch Phenolinjektionen getötet worden seien.
Schwierig war es nur, Klarheit über die Durchführung der Aktionen selbst und die Anzahl der getöteten Kinder zu erlangen.
Der Angeklagte Scherpe hat sich dahin eingelassen, dass die Kinder in Anwesenheit des Dr. Rohde und in seinem Beisein durch Funktionshäftlinge nacheinander durch Phenolinjektionen umgebracht worden seien. Er - der Angeklagte - habe den Funktionshäftlingen die Flasche mit Phenol ausgehändigt. Im übrigen habe er nichts getan. Er habe sich an einen Tisch am Fenster gesetzt und gar nicht hingeschaut, als die Kinder getötet worden seien.
Insoweit ist die Einlassung des Angeklagten Scherpe nicht glaubhaft. Zunächst glaubt das Schwurgericht dem Angeklagten nicht, dass der Lagerarzt Dr. Rohde der Tötungsaktion beigewohnt hat. Denn bei seiner früheren Vernehmung im Ermittlungsverfahren hat der Angeklagte Scherpe, was ihm in der Hauptverhandlung vorgehalten worden ist und was er als zutreffend bestätigt hat, nichts davon erwähnt, dass der Lagerarzt Dr. Rohde bei dieser Aktion dabeigewesen sei. Nach Auffassung des Schwurgerichts hätte er einen so wichtigen Umstand, der - aus seiner Sicht gesehen - entscheidend zu seiner Entlastung dienen konnte, nicht verschwiegen oder vergessen, wenn seine Einlassung in der Hauptverhandlung tatsächlich der Wahrheit entspräche. Im übrigen hat auch kein Angeklagter und kein Zeuge bekundet, dass jemals ein SS-Lagerarzt bei den sog. "Abspritzungen", wie die Tötungshandlungen im damaligen Lagerjargon genannt wurden, dabeigewesen sei. Das haben die Ärzte den SDGs und Funktionshäftlingen überlassen. Es erscheint daher unglaubhaft, dass Dr. Rohde ausgerechnet bei der Tötung der Kinder dabeigewesen sein soll.
Das Schwurgericht hat dem Angeklagten Scherpe auch nicht abgenommen, dass Funktionshäftlinge die Kinder getötet haben. Es ist vielmehr überzeugt, dass er die polnischen Kinder eigenhändig getötet hat. Diese Überzeugung stützt sich auf folgendes: Der Zeuge Glo. hat ausgesagt, dass er die Kinder in das Zimmer Nr.1 hat hineinführen müssen. Das hat der Angeklagte Scherpe bestätigt. Er hat nämlich bei seiner Einlassung erklärt, dass Glo. die Kinder einzeln in das Zimmer hineingeführt habe. Der Zeuge Glo. musste daher zwangsläufig die Personen sehen, die an der Tötungsaktion beteiligt gewesen sind. Er hat weiter bekundet, dass er den Angeklagten Scherpe und die beiden Funktionshäftlinge Schwarz und Gebhardt in den Tötungszimmern gesehen habe. Scherpe hat nicht in Abrede gestellt, im Zimmer Nr.1 gewesen zu sein. Er hat daher auch insoweit die Aussage des Zeugen Glo. bestätigt. Die Erinnerung des Zeugen Glo., wer nun die Phenolinjektionen gegeben hat, erschien allerdings zunächst nicht ganz sicher. Der Zeuge hat zunächst nicht erklärt, dass er mit eigenen Augen gesehen habe, dass der Angeklagte Scherpe den Opfern eigenhändig die Phenolinjektionen verabreicht habe. Er hat vielmehr eine Schlussfolgerung gezogen, indem er erklärt hat, es könne keinem Zweifel unterliegen, dass der Angeklagte Scherpe die Tötungsaktion eigenhändig durchgeführt habe, weil die beiden Funktionshäftlinge Schwarz und Gebhardt nicht hätten töten können und auch nie Phenolinjektionen gegeben hätten. Bei seiner früheren Vernehmung im Ermittlungsverfahren hat der Zeuge - was ihm in der Hauptverhandlung vorgehalten worden ist und von ihm auch bestätigt wurde - angegeben, er habe "gesehen", wie etwa 20-30 Knaben von Scherpe "abgespritzt" worden seien. Nach dem Vorhalt hat er dann erklärt, er habe doch mit eigenen Augen gesehen, dass Scherpe, wenn er - der Zeuge - ein Kind in das Zimmer Nr.1 hineingebracht habe, die Spritze in der Hand gehalten und das Kind, das von ihm - dem Zeugen - bereits in das Zimmer gebracht worden sei, getötet habe.
Diese Unterschiede in der Aussage des Zeugen erscheinen jedoch nach Auffassung des Schwurgerichts nur scheinbar widersprüchlich. Der Zeuge hat bei seiner Vernehmung im Ermittlungsverfahren offensichtlich bereits eine Schlussfolgerung gezogen. Er hat aus den Umständen, dass nämlich der Angeklagte Scherpe im Tötungszimmer war, und dass die Häftlinge Gebhardt und Schwarz nach seiner damaligen Kenntnis der Dinge im HKB nicht zu den Funktionshäftlingen gehörten, die eigenhändig Phenolinjektionen geben konnten, gefolgert, dass der Angeklagte Scherpe die Kinder getötet haben müsse. Diese Folgerung hat er in der Erklärung zusammengefasst, dass er "gesehen" habe, wie der Angeklagte Scherpe etwa 20 bis 30 Kinder "abgespritzt" habe. Wahrscheinlich ist, dass er selbst gar nicht sehen konnte, wer den Kindern die Nadel der Rekordspritze in das Herz gestossen hat. Denn er musste jeweils, wenn er ein Kind in das Zimmer hereingebracht hatte, sofort wieder den Raum verlassen, um das nächste Kind zu holen. In der Zwischenzeit konnte dann die tödliche Injektion bei dem bereits im Zimmer befindlichen Kind angebracht werden. Dieser genauen Unterschiede ist sich der Zeuge nach einem Zeitraum von über 20 Jahren wahrscheinlich selbst nicht mehr bewusst. So ist es zu erklären, dass er nach dem Vorhalt selbst wieder zu der Überzeugung kam, er müsse es gesehen haben, wer die tödliche Injektion angebracht habe, wenn er es bei seiner früheren Vernehmung so ausgesagt habe. Damit wird die Aussage des Zeugen jedoch nicht wertlos. Es bleibt nur zu prüfen, ob die von ihm auf Grund der Umstände gezogene Schlussfolgerung überzeugend ist. Das ist der Fall. Denn keiner der Zeugen, die damals im HKB tätig waren, hat gesagt, dass die Funktionshäftlinge Gebhardt und Schwarz zu den Funktionshäftlingen gehört hätten, die eigenhändig getötet hätten. Es war damals nur bekannt, dass die Funktionshäftlinge Stössel, Panczyk, Schumkowiak und in geringem Umfang Landau Phenolinjektionen geben konnten und gegeben haben. Auch der Angeklagte Klehr hat nicht behauptet, dass die Häftlinge Gebhardt und Schwarz zu dem Kreis der Funktionshäftlinge gehört hätten, die eigenhändig tödliche Phenolinjektionen hätten geben können. Wenn also die Häftlinge Gebhardt und Schwarz dem Angeklagten Scherpe assistiert haben, die nicht in der Lage waren, Phenolinjektionen zu geben, muss der Angeklagte Scherpe die Kinder eigenhändig getötet haben.
Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Erinnerungsvermögens des Zeugen Glo. könnten auch deswegen bestehen, weil er in der Hauptverhandlung zunächst behauptet hat, dass auch der Angeklagte Hantl bei der Tötung der Kinder dabei gewesen sei. Bei seiner früheren Aussage im Ermittlungsverfahren hat der Zeuge den Angeklagten Hantl im Zusammenhang mit der Tötung der Kinder nicht erwähnt. Auf Vorhalt hat er dann auch eingeräumt, dass er sich an Hantl nicht erinnern könne. Insoweit kann der Zeuge zunächst einem Erinnerungsfehler zum Opfer gefallen sein. Über die Aktion gegen die polnischen Kinder ist nach dem Krieg unter den ehemaligen Häftlingen des KL Auschwitz viel diskutiert worden. Einige ehemalige Häftlinge haben behauptet, dass auch der Angeklagte Hantl an dieser Aktion beteiligt gewesen sein soll. Möglicherweise haben diese Diskussionen und Beiträge in polnischen Zeitungen falsche Vorstellungen in der Erinnerung des Zeugen in bezug auf den Angeklagten Hantl hervorgerufen. Möglich ist allerdings auch, dass Hantl tatsächlich bei dieser Aktion dabeigewesen ist. Eine sichere Feststellung konnte insoweit jedoch nicht getroffen werden, da der Angeklagte Hantl das entschieden bestreitet. Wenn der Zeuge Glo. zunächst möglicherweise zu Unrecht den Angeklagten Hantl belastet hat, so wird dadurch seine Aussage in bezug auf den Angeklagten Scherpe nicht wertlos. Denn der Angeklagte Scherpe hat im Gegensatz zu dem Angeklagten Hantl eingeräumt, bei der Aktion dabeigewesen zu sein und der Zeuge hat schliesslich eingeräumt, dass er sich an Hantl nicht erinnern könne.
Die Überzeugung des Gerichts, dass der Angeklagte Scherpe eigenhändig die Kinder getötet hat, stützt sich aber nicht allein auf die Aussage des Zeugen Glo. Eine Reihe von Zeugen hat bekundet, dass der Angeklagte Scherpe bei der Tötungsaktion seelisch zusammengebrochen sei. Er habe daher die Aktion abgebrochen.
Der Zeuge P., der während der Tötungsaktion auf Block 21 gewesen ist, von der Aktion aber bereits gehört hatte, hat - wie er glaubhaft bekundet hat - gesehen, wie der Angeklagte Scherpe an dem betreffenden Nachmittag plötzlich in den Block 21 gelaufen kam und in das Ärztezimmer hineinging. Er hat gehört, wie der Angeklagte etwas vor sich hinmurmelte. Er hat festgestellt, dass der Angeklagte Scherpe ausserordentlich erregt gewesen ist und dass seine Lippen gezittert haben. Hinter dem Angeklagten Scherpe sei - so hat der Zeuge P. weiter berichtet - der Schreiber von Block 20, der Zeuge Glo. gelaufen gekommen und habe erklärt, dass die Tötungsaktion abgebrochen sei. An diese Einzelheit konnte sich der Zeuge Glo. allerdings nicht mehr erinnern. Er wusste jedoch noch, dass am ersten Tag nur ein Teil der Kinder getötet worden sei, weil die Aktion aus irgendeinem Grunde abgebrochen worden sei. Der Zeuge La. hat bekundet, dass der Angeklagte Scherpe an dem betreffenden Tag erregt und blass zu der Dienststelle des Standortarztes gekommen sei und sich beim Standortarzt habe melden lassen. Diesem habe er erklärt, er könne die Kinder nicht weiter "abspritzen". Daraufhin sei ihm dies erlassen worden. Er habe dann überhaupt keine tödlichen Injektionen mehr zu geben brauchen, sondern sei nach Golleschau versetzt worden.
Der Zeuge F. hat ausgesagt, dass ihm die Funktionshäftlinge Gebhardt und Schwarz damals berichtet hätten, dass Scherpe damit begonnen habe, die Kinder zu töten, dann aber einfach dabei zusammengebrochen sei.
Der Zeuge Kl., der zwar die Tötungsaktion selbst nicht mit angesehen hat, während der Aktion aber im Block 20 gewesen ist und davon erfahren hat, hat bekundet, dass der Angeklagte Scherpe plötzlich aus dem Zimmer Nr.1 herausgekommen sei und gesagt habe, er könne nicht mehr.
Aus diesen Umständen hat das Gericht die Überzeugung gewonnen, dass die Tötungsaktion tatsächlich abgebrochen worden ist und dass der Angeklagte Scherpe, weil er es psychisch nicht mehr durchhalten konnte, aus dem Block 20 weggelaufen ist und sich beim Standortarzt Dr. Wirths gemeldet hat, um von der weiteren Durchführung der Aktion befreit zu werden. Der Angeklagte Scherpe hat hiervon allerdings nichts berichtet. Nach seiner Einlassung will er sich erst am nächsten Tag beim Standortarzt gemeldet haben. Insoweit verdienen jedoch die Aussagen des Zeugen den Vorzug vor der Einlassung des Angeklagten Scherpe. Denn wenn der Angeklagte Scherpe zugegeben hätte, dass er die Tötungsaktion abgebrochen und sich sofort beim Standortarzt gemeldet hat, hätte er damit indirekt zugeben müssen, dass er die Kinder eigenhändig getötet hat. Das wollte er aber offenbar nicht. Nach Auffassung des Schwurgerichts hat er daher, um sich nicht mit der eigenhändigen Tötung der Kinder belasten zu müssen, verschwiegen, dass er die Aktion abgebrochen hat.
Wenn aber der Angeklagte Scherpe während der Tötungsaktion aus dem Block 20 weggelaufen ist und sich unmittelbar danach bei dem Standortarzt Dr. Wirths gemeldet hat, um von der weiteren Durchführung der Aktion befreit zu werden, spricht das eindeutig dafür, dass er - wie auch der Zeuge Glo. bekundet hat - tatsächlich eigenhändig die Kinder getötet hat. Denn wenn der Lagerarzt Dr. Rohde anwesend gewesen wäre und der Angeklagte Scherpe während der Tötungsaktion nur am Fenster gesessen und die Tötung der Kinder gar nicht mit angesehen hätte, wäre kaum verständlich, dass er die Nerven verloren hat und die Aktion hat abbrechen müssen. Selbst wenn er den Raum verlassen hätte, hätte unter der Aufsicht des Dr. Rohde die Aktion durch die Funktionshäftlinge weitergeführt werden können. Sein eigenes Verhalten an dem betreffenden Nachmittag stützt daher die Überzeugung des Gerichts, dass er selbst den Kindern die Phenolinjektionen verabreicht hat.
Die genaue Anzahl der getöteten Kinder konnte nicht festgestellt werden.
Der Zeuge Dr. Kl. hat gemeint, es seien 30-40 Kinder gewesen. Der Zeuge Woy. hat die Anzahl der Kinder auf 60-80 geschätzt. Nach der Aussage des Zeugen Gl. sollen es sogar über 100 gewesen sein. Der Zeuge Glo. hat angegeben, dass die ganze Gruppe der Kinder aus 120 bestanden hätte. Davon seien am ersten Tag insgesamt 80 Kinder, am nächsten Tag 40 Kinder getötet worden.
Auf diese unterschiedlichen Zahlenangaben konnten keine sicheren Feststellungen gestützt werden. Das Schwurgericht hat daher die Anzahl der vom Angeklagten Scherpe eigenhändig getöteten Opfer nur auf die Einlassung des Angeklagten Scherpe gestützt. Der Angeklagte hat zwar nicht zugegeben, die Kinder eigenhändig getötet zu haben, er hat aber eingeräumt, dass in seinem Beisein 20-30 Kinder umgebracht worden seien. Die Mindestzahl der Opfer die der Angeklagte Scherpe - entgegen seiner Einlassung - eigenhändig getötet hat, beträgt daher nach der Überzeugung des Gerichts mindestens 20. Wer nach Abbruch der Tötungsaktion durch den Angeklagten Scherpe die noch lebenden Kinder getötet hat, konnte nicht festgestellt werden. Es besteht ein gewisser Verdacht, dass der Angeklagte Hantl die weitere Durchführung der Aktion übernommen hat. Mit Sicherheit konnte dies jedoch nicht festgestellt werden, wie noch bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Hantl auszuführen sein wird. Möglicherweise haben Funktionshäftlinge die Fortführung der Aktion übernommen.
Dass gegen die Kinder kein Gerichtsurteil vorlag, ergibt sich aus der Tatsache, dass die Kinder heimlich beseitigt wurden und dass der Standortarzt Dr. Wirths auf den Protest und die Meldung des Angeklagten Scherpe hin eine schriftliche Meldung aufgesetzt hat, und der Angeklagte Scherpe später wegen dieser Aktion von einem SS-Führer vernommen worden ist. Hätte ein Gerichtsurteil gegen die Kinder vorgelegen oder wäre - nach der damaligen Auffassung der SS - ein sonstiger wichtiger Grund für die Aktion vorhanden gewesen, wären später wegen dieser Aktion mit Sicherheit keine Ermittlungen durchgeführt worden. Auch hätten die Ärzte Dr. Rohde und Dr. Wirths bereits damals dem Angeklagten Scherpe auf seinen Protest hin die Gründe für die Tötung der Kinder mitgeteilt. Da dies nicht erfolgt ist, bestehen keine Zweifel, dass die Kinder unschuldig umgebracht worden sind. Dass dies auch dem Angeklagten Scherpe klar gewesen ist, ergibt sich daraus, dass er zunächst die Tötung überhaupt nicht hat durchführen wollen und dann die Tötungsaktion abgebrochen hat.
4. Zu II.3.
Der Angeklagte Scherpe bestreitet, an der Vernichtungsaktion am 29.8.1942 teilgenommen zu haben. Er hat sich dahin eingelassen, dass er erst am nächsten Tag von dem Kalfaktor des SS-Reviers gehört habe, dass die Kranken aus dem Block 20 zur Vergasung ausgesucht worden seien. Der Kalfaktor habe ihm noch erklärt, dass unter den ausgesonderten auch ein Kalfaktor des SS-Reviers sei. Er habe ihn - den Angeklagten - gebeten, diesen Kalfaktor zu retten. Er - der Angeklagte - habe dann dafür gesorgt, dass dieser Häftling in einen anderen Block verlegt und von der Vergasung verschont worden sei.
Diese Einlassung des Angeklagten Scherpe kann schon deshalb nicht der Wahrheit entsprechen, weil die am 29.8.1942 aus dem Block 20 für die Vergasung bestimmten Häftlinge noch am gleichen Tag auf LKWs verladen und nach Birkenau gebracht worden sind. Der Angeklagte Scherpe hätte daher am nächsten Tage überhaupt keinen Häftling mehr retten können. Dass der Angeklagte Scherpe an der Aktion am 29.8.1942 teilgenommen hat, steht fest auf Grund der Aussage des glaubwürdigen Zeugen Dr. Kl. Dieser Zeuge hat den Angeklagten Scherpe beim Lagerarzt Dr. Entress stehen sehen, als dieser auf dem Hof zwischen Block 20 und 21 die Häftlinge für die Vergasung bestimmt hat. Nach der ganzen Sachlage kann nicht angenommen werden, dass der Angeklagte Scherpe nur als unbeteiligter Zuschauer der Aktion beigewohnt hat. Wenn er vom Lagerarzt Dr. Entress als SDG zu der Aktion hinzugezogen worden ist, so muss er auch eine Funktion gehabt haben. Das Gericht ist daher überzeugt, dass es seine Aufgabe war - ebenso wie des Angeklagten Klehr - für eine reibungslose Durchführung der Vernichtungsaktion zu sorgen und dass er zumindest darauf achten musste und auch darauf geachtet hat, dass sich keiner der für die Vergasung bestimmten Häftlinge verstecken konnte oder auf andere Weise gerettet wurde.
Die Feststellung, dass der Angeklagte Scherpe den Grund für die Vernichtungsaktion gekannt hat, ergibt sich aus der gesamten damaligen Situation. Die Zeugen P., Glo., Dr. Kl. und Dr. F. haben bereits damals als Funktionshäftlinge über die Hintergründe der Vernichtungsaktionen Bescheid gewusst. Es kann daher auch dem Angeklagten Scherpe als SDG nicht verborgen geblieben sein, warum die Infektionskranken zur Vergasung gebracht wurden. Es lag im übrigen für alle an der Aktion Beteiligen auch klar auf der Hand.
IV. Rechtliche Würdigung
1. Zu II.1.
Die Tötung der kranken und schwachen jüdischen Häftlinge durch Phenolinjektionen in den festgestellten mindestens 180 Fällen war Mord. Es kann insoweit auf die Ausführung unter O.IV.1. verwiesen werden.
Der Angeklagte Scherpe hat zu diesen Mordtaten kausale Tatbeiträge geleistet. Soweit er die Häftlinge eigenhändig getötet hat, liegt das klar auf der Hand. Denn er hat durch die Phenolinjektionen unmittelbar den Tod der Häftlinge selbst herbeigeführt. Aber auch in den übrigen Fällen hat er die Tötungsaktion dadurch gefördert, dass er den Funktionshäftlingen das für die Tötungen erforderliche Phenol ausgehändigt und die Funktionshäftlinge bei ihrer Tätigkeit beaufsichtigt hat. Durch die Aushändigung des Phenols hat er die Tötungsaktionen überhaupt erst ermöglicht. Durch die Beaufsichtigung der Funktionshäftlinge hat er dafür gesorgt, dass auch alle für den Tod bestimmten Häftlinge getötet wurden.
Der Angeklagte Scherpe hat auf Befehl des Lagerarztes Dr. Entress die Häftlinge getötet bzw. töten lassen. Seine Tätigkeit muss daher im Rahmen des §47 MStGB beurteilt werden. Er hat klar erkannt, dass die Tötung der unschuldigen kranken und schwachen Häftlinge ein allgemeines Verbrechen war und dass die ihm gegebenen Befehle, daran in der geschilderten Weise mitzuwirken, ein allgemeines Verbrechen bezweckten. Das ergibt sich daraus, dass er zu Beginn seiner Tätigkeit, nachdem er eine Tötungsaktion miterlebt hatte, den Lagerarzt und Standortarzt um Ablösung aus dem HKB gebeten hat. Er beruft sich auch nicht darauf, dass er die Tötung der unschuldigen Häftlinge für rechtmässig gehalten habe. Im übrigen gilt auch hier, was bezüglich des Angeklagten Klehr unter O.IV.1. ausgeführt worden ist.
Bei Prüfung der Frage, ob der Angeklagte Scherpe mit Täterwillen gehandelt hat oder ob er nur als Gehilfe fremde Taten fördern und unterstützen wollte, musste das gesamte Verhalten des Angeklagten Scherpe im HKB in Betracht gezogen werden. Oben ist bereits ausgeführt worden, dass sich der Angeklagte Scherpe nach den Aussagen einer Reihe von - oben im einzelnen angeführten - Zeugen allen, auch den jüdischen Häftlingen gegenüber anständig und menschlich verhalten hat. Der Angeklagte Scherpe hat ferner versucht, gleich zu Beginn seiner Tätigkeit von einer Mitwirkung an den Tötungsaktionen befreit zu werden. Vor der Tötung der Kinder hat er durch einen Protest beim Lagerarzt Dr. Rohde die Durchführung der Aktion zu verhindern versucht. Schliesslich hat er, nachdem er einen Teil der Kinder getötet hatte, die Aktion abgebrochen und hat sich beim Standortarzt Dr. Wirths gemeldet, um endgültig von solchen Tötungshandlungen befreit zu werden. Das spricht eindeutig dafür, dass er innerlich die Tötungen abgelehnt und nur widerstrebend an Tötungsaktionen teilgenommen und auch nur schweren Herzens selbst die Phenolinjektionen gegeben hat.
Es kann daher nicht festgestellt werden, dass er mit Täterwillen gehandelt hat.
Andererseits hat der Angeklagte Scherpe das Bewusstsein gehabt, durch die Aushändigung des Phenols an Funktionshäftlinge und deren Beaufsichtigung während der Tötungsaktionen die Mordtaten zu fördern. Dass diese Tätigkeit objektiv eine Förderung der Mordtaten darstellt, liegt so klar auf der Hand, dass es dem Angeklagten Scherpe nicht verborgen geblieben sein kann und nach der Überzeugung des Gerichts auch nicht verborgen geblieben ist. Soweit er selbst die Häftlinge getötet hat, bedarf es keiner Frage, dass ihm bewusst war, unmittelbar eine entscheidende Ursache für den Tod der Opfer zu setzen.
Der Angeklagte Scherpe hat auch die Tatumstände gekannt, die den Beweggrund für die Tötung der kranken und schwachen Häftlinge als niedrig kennzeichnen. Denn nach den getroffenen Feststellungen wusste er, dass sie nur als unnütze Esser beseitigt werden sollten, weil sie wegen des Ausfalls ihrer Arbeitskraft nicht mehr nützlich erschienen.
Der Angeklagte Scherpe hat somit als Gehilfe die Mordtaten der Haupttäter vorsätzlich gefördert. An dem Gehilfenwillen mangelt es nicht schon deshalb, weil er seine Tatbeiträge zu den Mordtaten nur widerstrebend und innerlich ablehnend geleistet hat. Denn entscheidend ist allein - wie schon bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Dr. L. ausgeführt worden ist -, dass er erkannte, durch seine Tatbeiträge die Haupttaten zu fördern und dass er in diesem Bewusstsein durch Handlungen, die von seinem Willen abhängig waren, die Tatbeiträge geleistet hat.
Der Angeklagte Scherpe ist zu der Mitwirkung an den Tötungsaktionen nicht gezwungen worden. Er behauptet selbst nicht, dass sein Wille durch eine Drohung des Lagerarztes Dr. Entress oder des Standortarztes Dr. Wirths mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben gebeugt worden sei. Er hat sich vielmehr mit der Erklärung des Standortarztes Dr. Wirths, dass er kein Personal habe und dass er - der Angeklagte - daher Dienst im HKB verrichten müsse, abgefunden und hat dann aus einer falsch verstandenen Gehorsamspflicht heraus bei der Tötung der Häftlinge mitgewirkt. Dass für den Angeklagten Scherpe im Falle einer Verweigerung der Mitwirkung an den Tötungsaktionen keine Gefahr für Leib oder Leben bestanden hat, ist auch aus der Tatsache ersichtlich, dass ihm der Standortarzt Dr. Wirths keine Vorwürfe gemacht hat, als er die Tötungsaktion der Kinder abbrach. Der Standortarzt ist ihm vielmehr entgegengekommen, indem er ihn in das Nebenlager Golleschau versetzt hat.
Der Angeklagte Scherpe hat sich auch nicht in einem Putativnotstand befunden. Er behauptet nicht, dass er irrtümlich angenommen hätte, dass ihm Gefahr für Leib oder Leben drohe, wenn er seine Mitwirkung an den Tötungsaktionen verweigere. Dass er damit nicht gerechnet hat, ist auch daraus zu ersehen, dass er die Tötungsaktionen bei den Kindern schliesslich abbrach und bei dem Standortarzt Dr. Wirths Meldung erstattete. Irgendwelche Rechtfertigungs- oder sonstige Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich.
Der Angeklagte Scherpe war daher wegen seiner Mitwirkung bei der Tötung von 180 kranken und schwachen Häftlingen wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zu gemeinschaftlichem Mord in mindestens 180 Fällen (§§47, 49, 211, 74 StGB) zu verurteilen.
2. Zu II.2.
Die Tötung der mindestens 20 Kinder war ebenfalls Mord. Die Kinder wurden heimtückisch getötet. Sie waren ahnungslos und somit auch wehrlos. Denn sie wussten nicht, was ihnen bevorstand. Aus dem Umstand, dass sie in ein Arztzimmer geführt wurden, konnten sie nicht entnehmen, dass sie getötet werden sollten. Die Tatsache, dass sie sich widerstandslos und ohne Aufruhr töten liessen, spricht eindeutig dafür, dass der Angeklagte Scherpe bei der Tötungsaktion die Ahnungslosigkeit und Wehrlosigkeit der Kinder bewusst ausgenutzt hat. Im übrigen erfolgte die Tötung der Kinder auch aus niedrigen Beweggründen. Es konnte zwar nicht im einzelnen geklärt werden, warum die polnischen Knaben in den HKB zur Tötung gebracht worden sind und wer ihre Tötung angeordnet hat. Die Tatsache, dass sie als Angehörige der damals von den NS-Machthabern verhassten polnischen Nation heimlich umgebracht wurden, spricht jedoch eindeutig dafür, dass gegen sie nicht nur kein Todesurteil vorlag, sondern, dass man ihnen letztlich deswegen kein Lebensrecht mehr zuerkannte, weil sie Angehörige einer sog. "minderwertigen Rasse" waren, mag auch sonst noch irgend ein äusserer Anlass vorgelegen haben. Ihre "Liquidierung" war letztlich in der nationalsozialistischen Ausrottungs- und Unterdrückungspolitik gegen die als "minderwertig" angesehene polnische Nation begründet. Der Angeklagte Scherpe hat die Kinder auf Befehl getötet. Auch hier kommt daher §47 MStGB zur Anwendung. Der Angeklagte hat erkannt, dass die Tötung der Kinder ein allgemeines Verbrechen war. Das ergibt sich eindeutig daraus, dass er bereits vor der Tötungsaktion beim Lagerarzt Dr. Rohde gegen die Tötung der Kinder protestiert und dass er später die Tötungsaktion abgebrochen hat. Er hat sich auch nicht darauf berufen, dass er die Tötung der Kinder für rechtmässig gehalten habe. Er ist daher für seine Mitwirkung bei der Tötungsaktion strafrechtlich verantwortlich.
Wenn er auch die Kinder eigenhändig getötet hat, kann trotzdem nicht festgestellt werden, dass er mit Täterwillen gehandelt hat. Er hat den Befehl, die Kinder zu töten, nur widerstrebend befolgt. Die Tötung der Kinder hat er innerlich abgelehnt, was sich daraus ergibt, dass er bereits vor der Aktion bei Dr. Rohde dagegen protestiert hat. Besonders klar brachte er dies schliesslich dadurch zum Ausdruck, dass er die Tötungsaktion abbrach und bei dem Standortarzt Dr. Wirths vorstellig wurde. Nach der Überzeugung des Gerichts hat der Angeklagte Scherpe daher nur mit dem Willen eines Gehilfen fremde Mordtaten unterstützt. Dass dieser Gehilfenwille nicht schon deswegen zu verneinen ist, weil er die Taten widerstrebend und in innerer Ablehnung durchgeführt hat, ist bereits unter IV.1. ausgeführt worden. Hier hat der Angeklagte Scherpe - was bei der eigenhändigen Tötung selbstverständlich ist - das Bewusstsein gehabt, durch die Phenolinjektionen unmittelbar den Tod der Kinder herbeizuführen. In diesem Bewusstsein hat er die Phenolinjektionen gegeben, also durch Handlungen, die von seinem freien Willen abhängig waren, entscheidende Tatbeiträge zu dem Tode der Kinder geleistet.
Da er ferner zwangsläufig die gesamten Umstände erlebt und somit auch gekannt hat, die die Tötung der Kinder
als heimtückisch kennzeichnen, hat er vorsätzlich die Tatbeiträge eines Gehilfen zu den Mordtaten der Haupttäter geleistet.
Auch in diesem Fall hat der Angeklagte Scherpe nicht im Befehlsnotstand gehandelt. Er behauptet selbst nicht, dass ihn der Lagerarzt Dr. Rohde zu der Tötung der Kinder gezwungen habe. Er hat sich vielmehr damit abgefunden, als ihm der Lagerarzt Dr. Rohde am Nachmittag erklärt hat, die Kinder müssten getötet werden, und er hat die Tötungsaktion aus einer falsch verstandenen Gehorsamspflicht heraus begonnen. Im übrigen gilt hier das gleiche, was bereits unter Ziffer IV.1. ausgeführt worden ist. Er befand sich auch nicht in einem Putativnotstand. Insoweit kann ebenfalls auf die Ausführung unter Ziffer IV.1. Bezug genommen werden.
In beiden Fällen (II.1. und II.2.) sowie in dem noch zu erörternden Fall II.3. hat der Angeklagte Scherpe auch nicht irrtümlich angenommen, er müsse die Befehle des Lagerarztes bzw. Standortarztes trotz ihres verbrecherischen Charakters als bindend befolgen.
Das behauptet er selbst nicht. Hierfür liegen auch sonst keine Anhaltspunkte vor.
Irgendwelche Rechtfertigungs- oder sonstige Schuldausschliessungsgründe liegen nicht vor.
Der Angeklagte Scherpe war daher wegen der Tötung der mindestens 20 Kinder wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zu gemeinschaftlichem Mord in mindestens 20 Fällen (§§47, 49, 211, 74 StGB) zu verurteilen.
3. Zu II.3.
Die Tötung der 700 Infektionskranken aus Block 20 war Mord, wie bereits unter O.IV.6. ausgeführt worden ist und worauf Bezug genommen werden kann.
Der Angeklagte Scherpe hat zu dieser Mordtat dadurch einen kausalen Tatbeitrag geleistet, dass er den Lagerarzt Dr. Entress bei der Selektion unterstützt hat und nach der Selektion und bei dem Abtransport der Opfer darauf achtete, dass die für den Tod bestimmten Menschen nicht mehr gerettet werden konnten. Beim Abtransport der Opfer hat er durch seine Anwesenheit als SDG für eine reibungslose Durchführung der Aktion gesorgt. Schliesslich hat er die Vernichtungsaktion auch dadurch unterstützt, dass er in der Zeit, in der die LKWs die Opfer nach und nach zu der Gaskammer brachten, die Zurückbleibenden beaufsichtigt hat, damit sie nicht gerettet werden konnten.
Nach den getroffenen Feststellungen hat er gewusst, dass die Opfer anschliessend durch Zyklon B getötet werden sollten. Es kann daher auch nicht zweifelhaft sein, dass ihm bewusst gewesen ist, durch seine Anwesenheit bei der Aktion und die dabei ausgeübte Aufsicht einen kausalen Tatbeitrag zu dem Tod der 700 Häftlinge zu leisten.
Auch in diesem Fall hat er auf Befehl mitgewirkt, so dass §47 MStGB zur Anwendung kommt. Er hat erkannt, dass die Tötung der kranken und unschuldigen Menschen ein allgemeines Verbrechen war und der Befehl, der seine Mitwirkung an der Aktion anordnete, ein allgemeines Verbrechen bezweckte. Hier gilt das gleiche, was bereits unter O.IV.6. bezüglich des Angeklagten Klehr ausgeführt worden ist.
Auch in diesem Fall kann nicht festgestellt werden, dass der Angeklagte Scherpe mit Täterwillen seinen Tatbeitrag geleistet hat. Nach seinem allgemeinen Verhalten im KL Auschwitz und seiner in der Hauptverhandlung erkennbar gewordenen inneren Einstellung zu den Tötungsaktionen im HKB, muss vielmehr davon ausgegangen werden, dass er auch diese Aktion innerlich abgelehnt und nur widerstrebend dabei mitgeholfen hat. Er hat aber als Gehilfe die Mordtaten der Haupttäter unterstützt. Denn er hat in dem Bewusstsein, die Mordaktion gegen die 700 Kranken zu fördern, durch Handlungen, die von seinem Willen abhängig waren (Aufsichtsführung bei den Selektionen und beim Abtransport der Häftlinge), diese kausalen Tatbeiträge geleistet. Da er nach den getroffenen Feststellungen auch die Umstände gekannt hat, die den Beweggrund für die Liquidierung der 700 Kranken als niedrig kennzeichnen, hat er seinen Tatbeitrag zu dem Mord der Haupttäter vorsätzlich als Gehilfe geleistet. Auch hier liegen keine Rechtfertigungs- oder Schuldausschliessungsgründe vor. Anhaltspunkte für einen Befehlsnotstand sind nicht gegeben.
Der Angeklagte Scherpe war daher wegen seiner Mitwirkung an der "Liquidierung" der 700 Fleckfieberkranken wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zu gemeinschaftlichem Mord (§§47, 49, 211 StGB) begangen in gleichartiger Tateinheit (§73 StGB) an mindestens 700 Menschen zu verurteilen.
V. Strafzumessung
Der Angeklagte Scherpe hat zwar im HKB in Auschwitz I die gleiche Funktion ausgeübt, wie der Angeklagte Klehr. Er hebt sich jedoch nach seinem Verhalten wie nach seiner Persönlichkeit in vielerlei Hinsicht von diesem ab: Der Angeklagte Scherpe hat sich von Anfang an innerlich gegen das in Auschwitz übliche Morden gesträubt, hat sich weitgehend zurückgehalten, nicht mehr getan, als ihm befohlen wurde und die Häftlinge durchweg korrekt behandelt; er sass selbst einmal im Arrest wegen Verdachtes der "Häftlingsbegünstigung".
Der Angeklagte hat mehrfach seinen Vorgesetzten - wenn auch anfänglich ohne Erfolg - erklärt, er könne sich an den ihm anbefohlenen Aktionen nicht beteiligen und ist endlich Manns genug gewesen, seine Bereitwilligkeit, die ihm übertragenen Funktionen zu erfüllen, einfach aufzukündigen. Er hatte sich, obgleich seine ihm vorgesetzten SS-Ärzte alles andere als ein gutes Beispiel gaben, doch wenigstens einen Rest sittlicher Wertungsmassstäbe bewahrt, die ihn schliesslich aus der Mordmaschinerie ausbrechen liess.
Zu seinen Gunsten wurde berücksichtigt, dass er sich vor und nach dem Kriege anständig geführt hat. Andererseits hat auch Scherpe insbesondere bei den Tötungen durch Phenol immer wieder seine Dienste zur Durchführung abscheulicher Mordpläne zur Verfügung gestellt.
Das Gericht hat bei Abwägung dieser Umstände Strafen für gerechtfertigt gehalten, die an der unteren Grenze des Strafrahmens lagen und hatte alle Beihilfehandlungen des Angeklagten für gleich strafwürdig gehalten.
Die Mitwirkung bei der Vernichtung der 700 Typhuskranken trug mit zum Tod einer grossen Anzahl pflegebedürftiger Menschen bei, die nur deshalb eines fürchterlichen Todes sterben mussten, weil man die Ansteckung von SS-Leuten fürchtete. Diesem Erschwerungsgrund steht gegenüber, dass die Aktion ausdrücklich von der höchsten SS-Führung befohlen war und der Angeklagte nur einen geringen Tatbeitrag geleistet hat. Handelte es sich bei den Tötungen mit Phenol jeweils nur um ein Opfer, so erhält jede dieser Handlungen des Angeklagten ihr Gewicht durch die sie begleitenden makabren Umstände. Eine Zuchthausstrafe von jeweils 3 Jahren und 3 Monaten erschien danach angemessen und die Bildung einer Gesamtstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten Zuchthaus gerechtfertigt.
Q. Die Straftaten des Angeklagten Hantl
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Hantl
Der Angeklagte Hantl ist am 14.12.1902 in Mährisch-Lotschnau als Sohn eines Tabakfabrikarbeiters geboren. Er hatte noch 4 Geschwister. Davon leben noch zwei Schwestern. Der Angeklagte besuchte in Mährisch-Lotschnau 8 Jahre die Volksschule. Von 1917 bis 1920 lernte er das Bäckerhandwerk. Nach Abschluss der Lehre arbeitete er als Hilfsarbeiter in der Textilfabrik Ettel in Zwittau. 1924 wurde er arbeitslos. Er ging nun nach Böhmen, wo er bei einem tschechischen Bauern für ein Jahr Arbeit in der Landwirtschaft fand. Danach kehrte er wieder nach Zwittau zurück, wo er in der Firma Heinrich Klinger, einer jüdischen Firma, die im Jahre 1940 von einem Deutschen übernommen wurde, als Weber arbeiten konnte.
Der Angeklagte gehörte in der Tschechoslowakei dem Deutschen Turnverband an. Nach dem Einmarsch der Deutschen Truppen (1938) wurde dieser Verband - wie der Angeklagte angibt - in die SS übernommen. So wurde der Angeklagte Mitglied der allgemeinen SS. Ausserdem trat er in die NSDAP ein. Der Angeklagte wurde am 21.1.1940 zur Waffen-SS nach Breslau einberufen. Er wurde dann bei der SS-Totenkopfstandarte Lodz als Infanterist ausgebildet.
Am 1.8.1940 wurde er mit weiteren 35 SS-Männern zum Wachsturmbann des KZ Auschwitz versetzt. Damals waren etwa 1700 Häftlinge mit dem Aufbau des Lagers beschäftigt. Der Angeklagte tat Dienst als Wachmann bei den Arbeitskommandos. Später hatte er ein Häftlingskommando von 7 Mann zu überwachen, das mit Aufräumungsarbeiten in der Fourierstelle und bei der Essensausgabe in der Küche beschäftigt war. An Pfingsten 1942 wurde der Angeklagte krank. Wegen Magenbeschwerden kam er in das Lazarett nach Kattowitz. Nach dem Lazarettaufenthalt unterzog er sich noch einer Kur. Gegen Weihnachten 1942 kehrte er wieder nach Auschwitz zurück. Er kam auf Veranlassung des Standortarztes Dr. Wirths als SDG in den HKB. Alsbald musste er an einem Kursus im Hygienischen Institut in Berlin teilnehmen, wo er in der Durchführung von Wasseranalysen ausgebildet wurde. Nach seiner Rückkehr nach Auschwitz wurde er wieder als Sanitäter im HKB eingesetzt. Er war als Rottenführer etwa ein Jahr lang als alleiniger SDG im Lager tätig.
Im April oder Mai 1944 kam er nach Monowitz, wo er im HKB als SDG etwa 6 Monate tätig war. Dann kam er nach Jawoschno wo er die gleiche Tätigkeit ausübte. Nach der Räumung des Lagers setzte er sich zusammen mit noch anderen SS-Angehörigen ab. Aus Furcht, als Deserteur aufgegriffen zu werden, suchte und fand er jedoch wieder Anschluss an eine SS-Einheit, die einen Häftlingstransport aus dem Lager Mauthausen nach Nordhausen begleitete. Bei dieser Einheit blieb er jedoch nur drei Tage. Danach setzte er sich erneut - und zwar nach Rybnik - ab. Dort meldete er sich bei einer OT-Einheit.
Nach Überschreitung der Enz wurde er von amerikanischen Truppen gefangen genommen, die ihn jedoch nach drei Wochen wieder entliessen, weil er einen OT-Ausweis bei sich trug und verschwieg, dass er zur Waffen-SS gehört hatte und im KZ Auschwitz eingesetzt gewesen war.
Nach seiner Entlassung ging der Angeklagte nach Passau, dann nach Regensburg und kam schliesslich nach München-Reuth. Dort arbeitete er 4 1/2 Jahre lang in der Landwirtschaft. Schliesslich kam er nach Marktredwitz, wo er bis zu seiner Festnahme in dieser Sache bei der Firma Bencker als Weber arbeitete.
Der Angeklagte Hantl ist ledig. Er befand sich vom 26.5.1961 bis zum 19.8.1965 in dieser Sache in Untersuchungshaft.
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Mitwirkung des Angeklagten Hantl bei der Tötung von kranken und schwachen Häftlingen durch Phenol
Der Angeklagte Hantl kam - wie bereits bei seinem Lebenslauf ausgeführt - etwa um die Weihnachtszeit 1942 als SDG in den HKB. Zu dieser Zeit war der Angeklagte Scherpe krank. Anfang 1943 trat noch ein weiterer SDG, der Unterscharführer Nierwicki, den Dienst im HKB an. Mit ihm zusammen nahm der Angeklagte Hantl wiederholt an den "Untersuchungen" von sog. Arztvorstellern im Block 28 durch den Lagerarzt Dr. Entress teil. Dabei lernte er das Verfahren kennen, durch das kranke und schwache Häftlinge zur Tötung mit Phenol ausgewählt wurden. Er selbst will bei diesen "Untersuchungen" nur untätig dabeigestanden und keine besondere Tätigkeit verrichtet haben.
Auf Befehl des Lagerarztes ging der Angeklagte Hantl wiederholt im Anschluss an diese "Untersuchungen", nachdem die Vorbereitungen für die Tötung der ausgewählten Häftlinge getroffen waren (Erstellung der Liste mit den Namen und Nummern der Opfer, Verbringung der Opfer in den Block 20), durch den Haupteingang in Block 20 hinein und begab sich dort auf das Zimmer Nr.1. Dort fanden sich ausserdem zwei Funktionshäftlinge ein, denen der Angeklagte Hantl das Phenol zur Tötung der Opfer aushändigte. Dann liess der Angeklagte Hantl die im Flur hinter dem Vorhang oder im grossen Waschraum des Blockes 20 wartenden nackten Häftlinge durch den Schreiber des Blockes 20 einzeln und nacheinander in das Zimmer Nr.1 hereinführen. Die Häftlinge wurden einzeln und nacheinander auf einem Schemel sitzend von dem einen der beiden Funktionshäftlinge durch Phenol auf die bereits mehrfach beschriebene Weise getötet. Der andere Funktionshäftling hielt jeweils die Opfer. Der Angeklagte Hantl führte bei diesen Tötungsaktionen jeweils die Aufsicht. Er blieb stets bis zur Beendigung der Aktion im Zimmer Nr.1. Die Leichen der Opfer wurden sofort nach der Einspritzung des Phenol in den dem Zimmer Nr.1 gegenüberliegenden Waschraum gebracht, wo sie bis zur Abholung durch Leichenträger liegen blieben.
Der Angeklagte Hantl hat mindestens achtmal solchen Tötungsaktionen beigewohnt und dabei die Aufsicht geführt, nachdem er den Funktionshäftlingen das für die Tötungen erforderliche Phenol ausgehändigt hatte. Bei jeder dieser Aktionen sind mindestens 5 Häftlinge getötet worden. Der Angeklagte Hantl wusste, dass die kranken und schwachen Häftlinge unschuldig nur deswegen getötet wurden, weil sie wegen ihrer Erkrankung und wegen des Ausfalls ihrer Arbeitskraft nicht mehr nützlich erschienen.
2. Die Beteiligung des Angeklagten Hantl an Selektionen durch den Lagerarzt Dr. Entress im HKB
Der Angeklagte Hantl hat den Lagerarzt Dr. Entress mindestens zweimal auf dessen Befehl hin auf "Selektionsgängen" durch den HKB begleitet, bei denen der Lagerarzt kranke und schwache Häftlinge für die Tötung durch Zyklon B aussuchte. In diesen beiden Fällen sah sich der Lagerarzt Dr. Entress die Fieberkurven der Kranken an. Häftlinge, die schon längere Zeit im HKB lagen und bei denen nach Meinung des Arztes nicht mit einer baldigen Wiederherstellung der Gesundheit gerechnet werden konnte, bestimmte er zur Tötung, indem er die Fieberkurven dem Angeklagten Hantl aushändigte. Dieser behielt die Fieberkurven bis zur Beendigung der Selektion in der Hand. Er wusste, dass die Häftlinge, deren Fieberkurven er in der Hand hielt, später nach Birkenau gebracht und dort durch Zyklon B in einer der Gaskammern getötet werden sollten. Nach Beendigung der Selektion brachte der Angeklagte Hantl die Fieberkurven der Opfer zur Schreibstube des HKB im Block 21. Dort wurde auf seine Anweisungen hin von Häftlingsschreibern an Hand der Fieberkurven eine Liste mit den Namen und Nummern der betreffenden Häftlinge erstellt. Am nächsten oder übernächsten Tag kamen LKWs in den Lagerabschnitt des HKB gefahren. Die auf der genannten Liste aufgeführten Häftlinge wurden aufgerufen. Sie mussten die LKWs besteigen. Dann wurden sie nach Birkenau zu einer der Gaskammern gefahren. In ihr wurden sie durch Zyklon B getötet.
In den beiden Fällen, in denen der Angeklagte Hantl dem Lagerarzt Dr. Entress bei den Selektionen assistiert hatte, sind mindestens je 170 Häftlinge, insgesamt also 340 Häftlinge für den Tod ausgewählt und anschliessend in einer der Gaskammern in Birkenau getötet worden.
Der Angeklagte Hantl wusste, dass die Kranken nur deswegen unschuldig getötet wurden, weil sie wegen ihrer Erkrankung und wegen des Ausfalls ihrer Arbeitskraft nicht mehr nützlich erschienen.
III. Einlassung des Angeklagten Hantl, Beweismittel, Beweiswürdigung
1.
Die Feststellungen zum Lebenslauf des Angeklagten Hantl beruhen auf seiner eigenen Einlassung.
2. Zu II.1.
Der Angeklagte Hantl hat eingeräumt, dass er mindestens achtmal die Aufsicht bei Tötungsaktionen im Zimmer Nr.1 des Blockes 20 geführt hat und dass in jedem dieser Fälle mindestens fünf Häftlinge durch einen Funktionshäftling getötet worden sind. Allerdings bestreitet er, dem Funktionshäftling das für die Tötung erforderliche Phenol ausgehändigt zu haben. Insoweit ist seine Einlassung jedoch unglaubhaft. Denn aus zwei Urkunden vom 1.4. bzw. 19.4.1943, die in der Hauptverhandlung verlesen worden sind, ergibt sich, dass er jeweils 1 kg Phenol aus der SS-Apotheke angefordert hat. Beide Urkunden trugen die Unterschrift des Angeklagten Hantl. Der Angeklagte hat anerkannt, dass die Unterschriften auf den Urkunden von ihm stammen. Daraus folgt, dass er etwas mit der Verwaltung und Verwahrung des Phenols zu tun gehabt haben muss. Ferner hat der Angeklagte Scherpe angegeben, dass er jeweils den Funktionshäftlingen das Phenol vor den Tötungsaktionen habe aushändigen müssen. Das Phenol musste nach Einlassung des Angeklagten Scherpe von den SDGs unter Verschluss gehalten werden. Aus Sicherheitsgründen hat man den Häftlingen keine Verfügungsmöglichkeit über das Phenol eingeräumt. Das Schwurgericht ist daher überzeugt, dass auch der Angeklagte Hantl den Funktionshäftlingen ebenfalls kurz vor den Tötungsaktionen das Phenol aushändigen musste und auch ausgehändigt hat.
Über die vom Angeklagten Hantl zugegebene Mitwirkung bei den Tötungsaktionen hinaus konnte jedoch im übrigen nicht festgestellt werden, dass er auch eigenhändig Häftlinge durch Phenolinjektionen getötet hat. Der Angeklagte Hantl hat dies von Anfang an entschieden in Abrede gestellt. Seine Einlassung ist von seiner ersten Vernehmung bis zu seiner Vernehmung in der Hauptverhandlung stets gleich geblieben.
Der Zeuge Gl. will allerdings gesehen haben, wie der Angeklagte Hantl Häftlinge eigenhändig umgebracht habe. Gegen die Zuverlässigkeit des Zeugen bestehen jedoch Bedenken, wie bereits bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Dylewski und des Angeklagten Scherpe ausgeführt worden ist. Weitere Bedenken ergeben sich aus folgendem: Der Zeuge Gl. hat behauptet, dass dem Angeklagten Hantl, wenn er Häftlinge eigenhändig getötet habe, ein jüdischer Häftling namens Wei. assistiert habe. Der Zeuge Wei. hat jedoch in der Hauptverhandlung bekundet, dass er nie gesehen habe, dass der Angeklagte Hantl, den sie in Auschwitz Schewczyk genannt hätten, selbst Phenolinjektionen gegeben habe. Wenn die polnischen Funktionshäftlinge Stössel oder Panczyk die Häftlinge getötet hätten, hätte der Angeklagte Hantl - so hat der Zeuge ausgesagt - am Fenster gestanden und hätte nicht zusehen wollen. Er sei gegenüber dem Angeklagten Klehr, den die Häftlinge im HKB den Teufel genannt hätten, wie ein Engel gewesen. Mit dem Zeugen Gl. habe er - der Zeuge Wei. - nie zusammen Dienst gemacht.
Die Aussage des Zeugen Gl. kann daher nicht der Wahrheit entsprechen.
Die Aussage des Zeugen Glo. ist bereits bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Scherpe gewürdigt worden. Glo., der zunächst behauptet hatte, dass Hantl nach Abbruch der Tötungsaktion der Kinder die überlebenden Kinder umgebracht habe, hat dann diese Behauptung nicht aufrecht erhalten. Er hat eingeräumt, dass er sich an Hantl nicht erinnern könne. Auch bei seiner früheren Vernehmung im Ermittlungsverfahren hat der Zeuge Glo., was ihm in der Hauptverhandlung vorgehalten und von ihm auch bestätigt worden ist, nichts davon erwähnt, dass der Angeklagte Hantl eigenhändig Phenolinjektionen gegeben oder die Kinder getötet habe. Der Zeuge Dr. Kl. hat bekundet, dass der Angeklagte Hantl, nachdem der Angeklagte Scherpe die Tötungsaktion der Kinder abgebrochen habe, die noch überlebenden Kinder getötet habe. Der Zeuge hat dies jedoch nicht mit eigenen Augen gesehen. Er war nach seiner Aussage nicht selbst bei der Tötungsaktion dabei. Er befand sich nur im Block 20 und erfuhr von der Aktion. Er hat auch nicht den Angeklagten Hantl gesehen. Seine Behauptung, Hantl habe die Aktion gegen die Kinder fortgesetzt, beruht nur auf Erzählungen anderer, wobei jedoch nicht feststeht, dass dem Zeugen Kl. richtig berichtet worden ist.
Der Zeuge Dr. F. will von den Funktionshäftlingen Schwarz und Gebhardt erfahren haben, dass der Angeklagte Hantl die Tötung der Kinder fortgesetzt habe. Im Ermittlungsverfahren hat der Zeuge noch erklärt, dass er selbst gesehen habe, wie der Angeklagte Hantl eigenhändig die Kinder getötet habe. Diese Aussage hat er in der Hauptverhandlung nicht mehr aufrecht erhalten. Wenn der Zeuge auch im übrigen zuverlässig erschien und einen glaubwürdigen Eindruck gemacht hat, besteht doch die Möglichkeit, dass er auf Grund der vielen Gespräche und Diskussionen, die unter den Häftlingen im Lager oder nach der Lagerzeit gerade über die Tötungsaktionen der Kinder geführt worden sind, guten Glaubens jetzt irrig annimmt, dass ihm die Funktionshäftlinge Schwarz und Gebhardt über die Fortsetzung der Aktion durch den Angeklagten Hantl berichtet haben, ohne dass dies zutrifft.
Bedenken, dass der Angeklagte Hantl die Kinder nach Abbruch der Aktion des Scherpe getötet hat, bestehen deswegen, weil der Angeklagte Scherpe damals als Vertreter des Angeklagten Hantl in den HKB als SDG gekommen ist. Wahrscheinlich war der Angeklagte Hantl zu dieser Zeit gar nicht im HKB anwesend. Denn andernfalls hätte es einer Vertretung durch den Angeklagten Scherpe nicht bedurft. Der Angeklagte Hantl hat von Anfang an entschieden in Abrede gestellt, irgend etwas mit der Tötung der Kinder zu tun gehabt zu haben, während er von Anfang an zugegeben hat, bei der Tötung von anderen Häftlingen durch Phenol die Aufsicht geführt zu haben.
Das Schwurgericht konnte daher nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass der Angeklagte Hantl tatsächlich die noch überlebenden Kinder selbst getötet oder bei ihrer Tötung die Aufsicht geführt hat.
Ferner will noch der Zeuge Wö. den Angeklagten Hantl mindestens einmal dabei gesehen haben, wie er einen Häftling eigenhändig "abgespritzt" habe. Diese Behauptung des Zeugen Wö. erscheint jedoch nicht zuverlässig genug, um sichere Feststellungen darauf stützen zu können. Denn der Zeuge hat im Verlaufe des Verfahrens voneinander abweichende Angaben bezüglich des Angeklagten Hantl gemacht.
Bei seiner ersten Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft hat er angegeben, dass der Angeklagte Hantl, wie er selbst gesehen habe, Häftlinge "abgespritzt", d.h. durch Phenol getötet habe. Nach dieser ersten Aussage müsste er also mehrfach gesehen haben, wie Hantl eigenhändig Häftlinge getötet hat. Bei seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter hat der Zeuge Wö. diese Aussage nicht mehr in dieser Form aufrecht erhalten. Er hat nur bekundet, dass sich der Angeklagte Hantl in dem Zimmer Nr.1, in dem die "Abspritzungen" vorgenommen worden seien, befunden habe und dass er - der Zeuge - gesehen habe, wie dann laufend nackte Häftlinge in dieses Zimmer hineingeführt worden seien. Dass er die Tötungshandlung selbst gesehen habe, hat er bei seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter nicht behauptet. Er hat bei dieser Vernehmung nur eine Schlussfolgerung gezogen, indem er erklärt hat, in dem Zimmer Nr.1 sei sonst kein anderer SDG gewesen, daher müsse der Angeklagte Hantl die Abspritzungen vorgenommen haben. Er hat jedoch auf Befragen hinzugefügt, dass es möglich sei, dass Hantl einem Funktionshäftling den Befehl gegeben habe, an seiner Stelle die Opfer zu töten. Nach dieser Aussage vor dem Untersuchungsrichter kann der Zeuge Wö. somit nicht Augenzeuge der Tötungshandlungen gewesen sein.
In der Hauptverhandlung hat dann der Zeuge Wö. wieder - wie bei seiner ersten Vernehmung - behauptet, dass Hantl Häftlinge durch Phenolinjektionen getötet habe. Als ihm seine frühere Aussage vor dem Untersuchungsrichter vorgehalten wurde, hat er erklärt, er habe aus dem Block 19 heraus beobachtet, wie der Angeklagte Hantl im Zimmer Nr.1 des Blockes 20 eigenhändig Phenolinjektionen gegeben habe. Auf weitere Vorhalte des Verteidigers des Angeklagten Hantl hat sich der Zeuge schliesslich auf die Erklärung zurückgezogen, "er wolle ihm - dem Verteidiger - entgegenkommen" er habe bestimmt in einem Fall den Angeklagten Hantl aus Block 19 gesehen, wie er eigenhändig eine Phenolinjektion gegeben habe, in allen anderen Fällen könne das auch ein Funktionshäftling gemacht haben. Schon die Formulierung des Zeugen, "er wolle dem Verteidiger entgegenkommen" lässt Bedenken aufkommen, ob der Zeuge tatsächlich über eigene Wahrnehmungen und Beobachtungen berichtet hat. Im übrigen muss wegen der Unterschiede zwischen der ersten Aussage des Zeugen Wö. vor der Staatsanwaltschaft, wonach er mehrfach gesehen haben müsste, wie der Angeklagte Hantl eigenhändig Phenolinjektionen gegeben hat, und der Aussage des Zeugen in der Hauptverhandlung, wonach er dies nur ein einziges Mal beobachtet haben will, und der Aussage vor dem Untersuchungsrichter, wonach der Zeuge dies selbst überhaupt nicht gesehen haben kann, vermutet werden, dass der Zeuge aus den Umständen - wie er sie bei seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter geschildert hat - nur den Schluss gezogen hat und zur Überzeugung gekommen ist, der Angeklagte Hantl müsse auch eigenhändig Häftlinge getötet haben und dass er, um das Gericht für seine Überzeugung zu gewinnen, die er selbst für richtig halten mag, schliesslich die angebliche Beobachtung aus dem Block 19 erfunden hat. Bei seinen abweichenden Angaben im Verlaufe des Verfahrens konnte das Gericht jedenfalls nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass er tatsächlich den Angeklagten Hantl einmal dabei beobachtet hat, wie dieser Häftlinge eigenhändig getötet hat. Die Schlussfolgerung des Zeugen, dass der Angeklagte Hantl, wenn er im Zimmer Nr.1 während der Tötungsaktion gewesen sei, auch eigenhändig die Häftlinge getötet haben müsse, ist nicht zwingend. Phenolinjektionen konnten auch durch Funktionshäftlinge gegeben werden. Das hat der Zeuge auch einräumen müssen. Auf Vorhalt hat er erklärt, dass er es offen lassen müsse, dass der Funktionshäftling Panczyk im Beisein des Angeklagten Hantl getötet hat.
Schliesslich hat noch der Zeuge Sau. behauptet, der Angeklagte Hantl habe auch eigenhändig Häftlinge getötet. Der Zeuge, der in Österreich lebt, konnte nicht in der Hauptverhandlung vernommen werden. Das Protokoll über seine richterliche Vernehmung vor dem Landesgericht in Wien vom 25.1.1965 wurde in der Hauptverhandlung verlesen. Das Gericht konnte sich daher kein Bild über die Glaubwürdigkeit des Zeugen machen. Der Zeuge hat bei seiner Vernehmung die sog. "Abspritzungen" so beschrieben, als wenn er selbst Augenzeuge gewesen sei. Dabei hat er behauptet, dass der Angeklagte Hantl selbst die tödlichen Injektionen gegeben hat. Dann hat er aber erklärt, dass er selbst nie Augenzeuge gewesen sei, sondern dass er es nur aus den Erzählungen der jüdischen Häftlingsgehilfen wisse. Seine Aussage beruht daher im wesentlichen nur auf den Erzählungen anderer. Ob ihm damals zutreffend berichtet worden ist, erscheint zumindest zweifelhaft. Der Zeuge will auch gesehen haben, dass der Angeklagte Hantl jeweils mit einem Köfferchen zu den Tötungsaktionen in den Block 20 gegangen sei. Das hat aber kein anderer Zeuge bestätigt. Der Angeklagte Hantl bestreitet es mit Entschiedenheit. Andererseits will der Zeuge zwar den Angeklagten Klehr im HKB gesehen haben, weiss aber nichts davon, dass der Angeklagte Klehr Phenolinjektionen gegeben hat, obwohl der Zeuge bereits im Spätherbst 1942 in den HKB gekommen ist. Nach den Aussagen vieler Zeugen, die bereits bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Klehr genannt worden sind, war der Angeklagte Klehr aber mindestens noch bis Frühjahr 1943 im HKB als erster SDG tätig. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass der Zeuge Sau. den Angeklagten Hantl mit dem Angeklagten Klehr verwechselt.
Nach der Aussage des Zeugen Sau. soll der Angeklagte Hantl ferner im Mai oder Juni 1944 deutsche kriminelle Häftlinge durch Phenolinjektionen eigenhändig getötet haben. Zu dieser Zeit war der Angeklagte Hantl aber bereits im Nebenlager Monowitz. Der Zeuge legt die Tötung dieser Häftlinge dem Angeklagten Hantl daher offensichtlich zu Unrecht zur Last. Schliesslich hat der Zeuge Sau. noch behauptet, der Angeklagte Hantl habe allein Häftlinge im HKB selektiert und anschliessend getötet. Auch das ist von keinem anderen Zeugen beobachtet und bestätigt worden. Es passt auch nicht in das Persönlichkeitsbild des Angeklagten, wie es von anderen Zeugen geschildert worden ist. Die Zeugen Dr. P., Rei., Glo., Ko., Fab. und Kark. haben dem Angeklagten Hantl übereinstimmend ein gutes Zeugnis ausgestellt. Der Zeuge Dr. P. hat den Angeklagten als einen ruhigen und höflichen SDG geschildert, der stets gut zu den Häftlingen gewesen sei, ihnen sogar Zigaretten gegeben habe und nie einen Häftling geschlagen habe. Er - der Zeuge Dr. P. - habe zwar im Jahre 1944 im Lager davon erfahren, dass der Angeklagte Hantl sich auch bei der Tötung von Häftlingen durch Phenolinjektionen betätigt haben solle. Er habe das damals aber schon nicht glauben wollen. Es gäbe jetzt noch ehemalige Häftlinge in Polen, die wegen des allgemeinen Verhaltens des Angeklagten im KL Auschwitz heute noch nicht glauben wollten, dass sich der Angeklagte Hantl an Tötungsaktionen beteiligt habe.
Der Zeuge Rei. hat ausgesagt, dass sie - die Häftlinge im HKB - den Angeklagten Hantl für einen anständigen Menschen gehalten hätten, Hantl habe sich bei ihm einmal über die Verhältnisse im KL Auschwitz beklagt. Er habe die schrecklichen Geschehnisse im KZ bedauert und habe ihm - dem Zeugen - erklärt, dass er es kaum noch ertragen könne. Auch der Zeuge Glo. hat den Angeklagten Hantl als einen höflichen und zuvorkommenden SDG bezeichnet, der nie Häftlinge geschlagen habe. Hantl habe die Häftlinge morgens, wenn er in den HKB hereingekommen sei und abends bevor er den HKB verlassen habe, sogar gegrüsst.
Die Zeugen Ko., Fab. und Kark. haben den Angeklagten Hantl als taktvoll, menschlich und als den anständigsten SS-Angehörigen im HKB beurteilt. Der Zeuge Wö. hat zugegeben, dass der Angeklagte Hantl wegen der "Abspritzungen" immer wieder "geseufzt" und gewünscht habe, dass endlich das "Abspritzen" aufhöre. Schliesslich sei noch einmal auf die Beurteilung des Zeugen Wei. hingewiesen, der den Angeklagten als einen "Engel" im Vergleich zum Angeklagten Klehr bezeichnet und bekundet hat, dass der Angeklagte Hantl den Tötungen nicht habe zusehen wollen.
All dies spricht gegen die Behauptung des Zeugen Sau., dass der Angeklagte Hantl selbst Selektionen durchgeführt und danach die von ihm ausgewählten Häftlinge eigenhändig getötet habe. Wahrscheinlich beruht die Aussage des Zeugen Sau. im wesentlichen auf Gerüchten und auf Erzählungen anderer Häftlinge, ohne dass nachgeprüft werden kann, ob diese Gerüchte und Erzählungen den Tatsachen entsprechen.
Das Schwurgericht konnte daher mit Sicherheit nur feststellen, dass der Angeklagte Hantl mindestens achtmal Tötungsaktionen beaufsichtigt hat, nachdem er den Funktionshäftlingen das hierfür erforderliche Phenol ausgehändigt hatte, und dass bei diesen Aktionen jeweils mindestens 5 Häftlinge, insgesamt also 40 Häftlinge, getötet worden sind.
Die Feststellung, dass der Angeklagte Hantl den Grund für die Tötung der kranken und schwachen Häftlingen gekannt hat, ergibt sich aus der gesamten damaligen Situation. Ihm kann nicht verborgen geblieben, sein, dass der Lagerarzt Dr. Entress die schwachen und kranken Häftlinge nur deswegen zur Tötung bestimmte, weil sie wegen ihrer Erkrankung und des Ausfalls ihrer Arbeitskraft nicht mehr nützlich erschienen. Denn ein sonstiger Grund wurde ihm nicht genannt. Auch lag nichts gegen die Häftlinge vor. Sie hatten sich nichts zu schulden kommen lassen. Der Angeklagte Hantl behauptet auch nicht, dass er über den Grund der Tötungsaktion nicht im Bilde gewesen sei.
3. Zu II.2.
Die Feststellungen unter II.2. beruhen auf dem Geständnis des Angeklagten Hantl. Der Angeklagte hat zugegeben, dass er an den beiden Selektionen in der geschilderten Weise mitgewirkt hat.
Im übrigen konnte nicht festgestellt werden, dass er darüber hinaus noch an weiteren Selektionen teilgenommen hat oder sogar - wie der Zeuge Sau. behauptet - eigenmächtig Häftlinge für die Tötung ausgewählt hätte. Dass dem Zeugen Sau. insoweit nicht gefolgt werden kann, ist bereits ausgeführt worden. In diesen beiden Fällen ergibt sich die Feststellung, dass der Angeklagte Hantl den Grund für die "Liquidierung" der Kranken gewusst hat, ebenfalls aus den unter III.2. genannten Gründen. Die Situation war hier die gleiche, nur dass die ausgesonderten Häftlinge nicht durch Phenol, sondern durch Zyklon B getötet worden sind, weil offensichtlich die Tötung durch Phenol wegen der Anzahl der Opfer unzweckmässig erschien.
IV. Rechtliche Würdigung
1. Zu II.1.
Wie bereits unter O.IV.1. ausgeführt, war die Tötung der kranken und schwachen Häftlinge durch Phenolinjektionen Mord. Der Angeklagte Hantl hat zu diesen Mordtaten in den festgestellten Fällen dadurch kausale Tatbeiträge geleistet, dass er den Funktionshäftlingen das für die Tötung der Opfer erforderliche Phenol ausgehändigt und während der Tötungsaktionen die Aufsicht geführt hat.
Ihm war auch bewusst, dass er durch diese Tätigkeit die Mordtaten förderte. Das kann nach der gesamten Sachlage nicht zweifelhaft sein. Denn es liegt für jedermann klar auf der Hand.
Der Angeklagte Hantl hat seine Tatbeiträge auf Befehl des Lagerarztes Dr. Entress geleistet. Da er Angehöriger der Waffen-SS gewesen ist, muss seine Mitwirkung im Rahmen des §47 MStGB beurteilt werden. Der Angeklagte Hantl hat klar erkannt, dass die Tötung der kranken und schwachen unschuldigen Häftlinge ein allgemeines Verbrechen war. Das stellt er nicht in Abrede. Es ergibt sich auch daraus, dass er sich bei den Zeugen Wö. und Rei. darüber beklagt hat.
Es konnte nicht festgestellt werden, dass der Angeklagte bei den Tötungsaktionen mit Täterwillen gehandelt hat. Dagegen spricht zunächst, dass er die Phenolinjektionen nicht eigenhändig gegeben, sondern die Tötung der Häftlinge den Funktionshäftlingen überlassen hat. Ferner spricht sein allgemeines sonstiges Verhalten im HKB, wie es sich aus den Aussagen der unter III.2. aufgeführten Zeugen Dr. P., Rei., Glo., Ko., Fab. und Kark. ergibt, dagegen, dass der Angeklagte Hantl die Tötung der unschuldigen Häftlinge innerlich bejaht und zu seiner eigenen Sache gemacht hätte. Aus der Tatsache, dass er sich bei den Zeugen Rei. und Wö. über die Verhältnisse im KL Auschwitz und insbesondere über die sog. "Abspritzungen" beklagt hat, ist vielmehr zu ersehen, dass er nur widerstrebend bei den Tötungsaktionen mitgemacht und diese innerlich nicht bejaht hat. Er hat nur aus einer falsch verstandenen Gehorsamspflicht heraus das getan, was ihm der Lagerarzt Dr. Entress befohlen hatte.
Andererseits hat der Angeklagte Hantl als Gehilfe die Mordtaten bewusst unterstützt. An dem Gehilfenwillen fehlt es nicht schon deswegen - wie bereits bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Dr. L. und des Angeklagten Scherpe ausgeführt worden ist - weil er nur widerstrebend die Mordtaten gefördert hat. Entscheidend ist vielmehr, dass er in dem Bewusstsein, die Mordtaten zu fördern, durch Handlungen, die von seinem freien Willen abhängig waren, kausale Tatbeiträge geleistet hat.
Da er nach den getroffenen Feststellungen auch die Tatumstände gekannt hat, die den Beweggrund für die Tötungen der Häftlinge als niedrig kennzeichnen, hat er vorsätzlich Beihilfe zu den Mordtaten im Zusammenwirken mit anderen geleistet. Der Angeklagte Hantl hat sich nicht in einem Befehlsnotstand befunden. Er beruft sich selbst nicht darauf, dass ihn der Lagerarzt Dr. Entress oder ein anderer hierzu durch eine Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben gezwungen habe. Er hat die Befehle, ohne nach einem Ausweg zu suchen, aus einer falsch verstandenen Gehorsamspflicht heraus, vielleicht auch um irgendwelchen Unannehmlichkeiten aus dem Wege zu gehen, aus freien Stücken, wenn auch widerwillig, befolgt.
Irgendwelche Rechtfertigungs- oder sonstige Schuldausschliessungsgründe für seine Handlungsweise sind nicht ersichtlich.
Er war daher wegen seiner Mitwirkung an den mindestens acht Tötungsaktionen wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zu gemeinschaftlichem Mord in mindestens 40 Fällen (§§47, 49, 211, 74 StGB) zu verurteilen.
2. Zu II.2.
Die Tötung der mindestens zweimal 170 unschuldigen Kranken in einer der Gaskammern in Birkenau war ebenfalls Mord. Denn die Tötung dieser Menschen erfolgte ebenfalls aus niedrigen Beweggründen. Es gilt hier das gleiche, was bereits bezüglich der Tötungen von kranken und schwachen Häftlingen durch Phenol oder durch Zyklon B unter O.IV.1. - 6. ausgeführt worden ist. Der Angeklagte Hantl hat diese Mordtaten ebenfalls gefördert, indem er den Lagerarzt Dr. Entress bei seinen Selektionsgängen durch den HKB begleitet, die Fieberkurven der für den Tod ausgewählten Häftlinge eingesammelt und anschliessend zur Häftlingsschreibstube gebracht hat, wo anhand der Fieberkurven die Liste der Opfer aufgestellt wurde. Diese Liste war eine wichtige Voraussetzung für den Tod der Opfer. Denn nur anhand der Liste konnte überprüft werden, dass auch alle vom Lagerarzt Dr. Entress für den Tod ausgesuchten Häftlinge getötet wurden.
Auch in diesem Fall hat der Angeklagte Hantl auf Befehl des Lagerarztes Dr. Entress mitgewirkt, so dass §47 MStGB zur Anwendung kommt. In beiden Fällen wusste der Angeklagte Hantl, dass die Tötung der kranken Häftlinge durch Zyklon B ein allgemeines Verbrechen war. Er bestreitet das nicht.
Die Art seiner Teilnahme ist genau so zu beurteilen, wie seine Teilnahme an den Tötungsaktionen durch Phenolinjektionen. Es kann daher auf IV.1. Bezug genommen werden. In diesen beiden Fällen kann daher - aus den gleichen Gründen wie dort ausgeführt - nur festgestellt werden, dass der Angeklagte Hantl die Mordtaten als Gehilfe gefördert hat. Er hat das Bewusstsein gehabt - was nach der gesamten Sachlage nicht zweifelhaft sein kann und was er auch nicht bestreitet - durch die geschilderte Mitwirkung zu dem Tod der 340 Opfer einen gewissen Beitrag zu leisten.
Da er nach den getroffenen Feststellungen auch gewusst hat, dass die Opfer nur wegen ihrer Erkrankung als unnütze Esser liquidiert werden sollten, hat er auch die Umstände gekannt, die den Beweggrund für die Tötung der Häftlinge als niedrig kennzeichnen. Er hat somit vorsätzliche Beihilfe zu zwei Mordtaten, jeweils begangen an je 170 Menschen, geleistet.
Die Tötung der beiden Gruppen von Menschen ist jeweils als eine selbständige Handlung im Sinne einer gleichartigen Tateinheit anzusehen. Denn die je 170 Menschen sind jeweils durch eine einzige Handlung, nämlich das Einschütten des Zyklon B getötet worden.
Auch in diesen beiden Fällen sind die Voraussetzungen eines Befehlsnotstandes nicht gegeben. Der Angeklagte Hantl behauptet selbst nicht, dass er durch den Lagerarzt Dr. Entress zu der Mitwirkung gezwungen worden sei.
Der Angeklagte Hantl war daher wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zu gemeinschaftlichem Mord in mindestens zwei Fällen (§§47, 49, 211, 74 StGB) begangen jeweils in gleichartiger Tateinheit (§73 StGB) an je 170 Menschen zu verurteilen.
V. Strafzumessung
Der Angeklagte Hantl musste wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in 42 Fällen bestraft werden. Folgende Umstände wurden der Bemessung der Strafen zugrunde gelegt:
Der Angeklagte ist nach seinen geringen geistigen Anlagen zu einer diffizilen Wertung besonderer Situationen nicht fähig. Er ist zufällig Mitglied der SS geworden und, ohne gefragt zu werden, zum Wachsturmbann nach Auschwitz versetzt worden und hat sich vor und nach seiner Tätigkeit in Auschwitz immer anständig geführt.
Der Angeklagte hat die ihm anbefohlenen Aufgaben nur widerwillig erfüllt, hat sich mit diesen Mordtaten nie identifiziert, seinen Abscheu dagegen vielmehr immer gezeigt. Er hat die Häftlinge ansonsten korrekt und höflich behandelt und ihnen geholfen, wo er konnte. Der Angeklagte hat es mehrfach ermöglicht, dass Funktionshäftlinge Karteikarten von durch den Arzt ausselektierten Häftlingen zurücklegten, was deren Rettung vor dem Tod bedeutete und hat weiterhin, was ihm in besonderem Masse zugute gehalten worden ist, von Anfang an ein Geständnis abgelegt. Er hat mit dem Eingestehen seiner Taten sein Gewissen erleichtert und im Gegensatz zu den meisten seiner Mitangeklagten bei aller Einfachheit seiner Denkweise zu erkennen gegeben,
dass er bereit ist, für das von ihm begangene Unrecht zu sühnen.
Das Gericht hielt daher in jedem Falle eine Zuchthausstrafe von 3 Jahren - die Mindeststrafe - für die gerechte Strafe. Gemäss §74 StGB ist bei Berücksichtigung der angeführten Zumessungsgründe die Gesamtstrafe mit 3 Jahren 6 Monaten Zuchthaus gebildet worden.
R. Die Straftaten des Angeklagten Bednarek
I. Der Lebenslauf des Angeklagten Bednarek
Der Angeklagte Bednarek ist am 20.7.1907 als Sohn eines in einer Kohlengrube beschäftigten Seilwärters in Königshütte/Oberschlesien geboren. Er hatte vier Geschwister, von denen heute drei in Polen leben. Nach dem Besuch der Volksschule arbeitete der Angeklagte in einem Kohlenbergwerk. Daneben machte er eine kaufmännische Lehre durch und besuchte eine kaufmännische Abendschule in Königshütte. 1927 oder 1928 wurde er zur polnischen Armee eingezogen. Nach Ableistung des Wehrdienstes war er zwei Jahre lang arbeitslos. Etwa im Jahre 1931 fand er Arbeit bei der Vereinigten Königs-Laura-Hütte. Bei Ausbruch des Krieges wurde der Angeklagte erneut zur polnischen Armee eingezogen. Er kam jedoch alsbald in deutsche Kriegsgefangenschaft, aus der er nach drei Tagen entlassen wurde. Nun arbeitete der Angeklagte als Buchhalter in einer Ziegelei.
Am 15.4.1940 wurde er von der Gestapo verhaftet. Ihm wurde zur Last gelegt, Mitglied einer polnischen Widerstandsbewegung zu sein. Am 7.7.1940 kam er als Häftling in das KZ Auschwitz. Er erhielt die Häftlingsnummer 1325. Zunächst wurde er als Stubendienst im Stammlager eingesetzt. Dann wurde er Blockschreiber. Im Sommer 1941 wurde er zum Blockältesten des Blockes 8A ernannt. Diese Funktion übte er bis Februar 1942 aus. Dann wurde er nach Birkenau B I b verlegt. Dort war er zunächst in einem Aufräumungs- und Planierungskommando. Nach wenigen Wochen wurde er jedoch wieder als Blockältester eingesetzt. Ihm unterstanden nacheinander die Blöcke 23 und 3 im Lagerabschnitt B I b und ab Juni/Juli 1943 schliesslich der Block 11 im Lagerabschnitt B II d, in dem sich die Strafkompanie befand.
Im April oder Mai 1943 will der Angeklagte Fleckfieber gehabt haben und bis Juni/Juli 1943 im HKB gewesen sein.
Der Angeklagte blieb als Blockältester der Strafkompanie bis zur Evakuierung des Lagers im Januar 1945 eingesetzt. Auf dem Evakuierungsmarsch hatte er 30 bis 40 Kinder zu betreuen, die nach Mauthausen zu bringen waren. Wie er angibt, hat er alle Kinder wohlbehalten nach Mauthausen gebracht.
Im KZ Mauthausen blieb der Angeklagte bis zur Befreiung des Lagers durch amerikanische Truppen (5.5.1945). Dann wurde er mit anderen KZ-Insassen auf LKWs der amerikanischen Armee nach Regensburg gebracht und entlassen. Er begab sich zunächst nach Königshütte zu seiner Familie. Dort blieb er jedoch nicht lange. Er ging vielmehr nach Schirnding, wo er zunächst drei Monate bei einem Bauern arbeitete. Dann stellte er sich der amerikanischen Militärregierung als Treuhänder der Firma Trautwein zur Verfügung. Im Jahre 1947 gab er diese Tätigkeit wieder auf, da er sich selbständig machen wollte. Er eröffnete um die Weihnachtszeit 1947 die Bahnhofsgaststätte in Schirnding. Im Laufe der Zeit baute er einen Kiosk, den er neben dem Gaststättenbetrieb eröffnet hatte, zu einem Lebensmittelgeschäft aus. Im Juli 1959 erwarb er in Riederau am Ammersee ein Grundstück mit Pension und Lebensmittelgeschäft. Hierzu war er besonders durch einen Toto-Gewinn von 15000 DM, mit dem er einen Bausparvertrag abgeschlossen hatte, in der Lage. Wegen Personalmangels veräusserte er dieses Grundstück jedoch bald wieder und kehrte nach Schirnding zurück.
Vor seiner Verhaftung arbeitete er als Buchhalter in seinem früheren Lebensmittelgeschäft in Schirnding, das er an Frieda Th., mit der er zusammen lebte, verpachtet hatte. Der Angeklagte hat am 1.5.1933 geheiratet. Aus der Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen. Seine Ehefrau und seine beiden Kinder leben noch in Polen. Der Angeklagte befindet sich seit dem 25.11.1960 in Untersuchungshaft.
II. Tatsächliche Feststellungen
1. Die Tötung von Häftlingen im Block 8A des Stammlagers durch den Angeklagten Bednarek (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
Wie bereits beim Lebenslauf des Angeklagten Bednarek ausgeführt, wurde er im Sommer 1941 Blockführer des Blockes 8A, der im ersten Stock des Steingebäudes mit der Nr.8 untergebracht war. Er war damit - wie alle Blockältesten - für Ruhe, Ordnung und Sauberkeit in seinem Block der SS-Lagerführung gegenüber verantwortlich. Die SS verlangte von den Blockältesten scharfes Durchgreifen gegen die ihnen unterstellten Häftlinge. Wer zu weich erschien, musste damit rechnen, von seinem Posten abgelöst zu werden. Der Angeklagte Bednarek setzte sich gegen die ihm unterstellten Häftlinge rücksichtslos durch. Er galt unter den Häftlingen als ein sehr scharfer Vorgesetzter. Geringe "Vergehen" von Häftlingen ahndete er durch Schläge mit den Fäusten oder einem Stock. Wenn Häftlinge ihre Schlafstätte nicht richtig gemacht hatten oder eine Schüssel mit Suppe aus Unachtsamkeit zur Erde fallen liessen und den Boden beschmutzten, schrie er sie an, verfluchte sie und schlug wild auf sie ein. Besonders brutal verhielt sich der Angeklagte Bednarek bei den Appellen. Wenn Häftlinge seines Blockes zu spät zum Appell kamen, schlug er sie so lange, bis sie zu Boden fielen. Dann trat er sie noch mit den Schuhen. Die Häftlinge waren sehr häufig so zerschlagen, dass sie in den HKB gebracht werden mussten. Im Block schikanierte der Angeklagte Bednarek die Häftlinge wegen irgendwelcher kleinen Vergehen häufig durch das sog. "Sportmachen". Er liess sie oft längere Zeit in Hockstellung hinhocken und in der Hand einen Hocker halten, bis sie vor Erschöpfung hinfielen. Dann schlug er noch auf sie ein. Im Block schlug der Angeklagte die Häftlinge meist mit einem Stock oder einem Hocker, wenn sie sich - seiner Meinung nach - eines "Vergehens" schuldig gemacht hatten. (Z.B. wenn sie ihr Bett nicht richtig gemacht oder die Stube beschmutzt hatten.) Oft schlug er aber auch ohne besondere äussere Anlässe auf die Häftlinge ein.
Der Angeklagte Bednarek begnügte sich jedoch nicht damit, die Häftlinge nur zu schlagen und zu misshandeln.
a. Häftlinge, die ihm aus irgendwelchen Gründen unsympathisch oder missliebig waren, vor allem schwache Häftlinge (Muselmänner), nahm er wegen kleiner "Vergehen" mit in den Korridor des Blockes 8. Dort schlug er mit einem Stock oder einem Hocker solange auf sie ein, bis sie tot waren. In diesen Fällen wollte er von Anfang an die Häftlinge umbringen. Insgesamt hat der Angeklagte Bednarek auf dem Korridor des Blockes 8 im Jahre 1941, nachdem er im Sommer 1941 Blockältester geworden war, mindestens 5 Häftlinge durch Schläge mit einem Stock oder einem Hocker getötet. Unter diesen fünf Opfern war ein alter Häftling, der dem Angeklagten Bednarek wegen seiner Ungeschicklichkeit mehrfach aufgefallen war. Er war ihm daher unsympathisch. Eines Tages warf er diesen Häftling wegen irgendeinen kleinen "Vergehens" auf den Korridor. Dort schlug er in der Absicht, ihn zu töten, so lange auf ihn ein, bis dieser Häftling starb.
Ob Häftlinge, die er bei den Appellen so misshandelt hat, dass sie in den HKB gebracht werden mussten, gestorben sind, konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden.
b. Die Tötung eines Häftlings am Heiligen Abend 1941 (Eröffnungsbeschluss Ziffer 1)
An Weihnachten 1941 entwendete ein Häftling aus dem Block 8A einem Kameraden Brot. Er wurde dabei erwischt. Der Angeklagte Bednarek berief daraufhin als Blockältester ein "Gericht" ein, dass den Dieb aburteilen sollte. Zu Mitgliedern des "Gerichts" bestellte er zwei Häftlinge, die im Zivilberuf Richter waren. Als "Staatsanwalt" bestimmte er einen Häftling, der ebenfalls von Beruf Jurist war. Schliesslich gab er dem Dieb noch einen "Verteidiger", der ebenfalls ein Berufsjurist war, zur Seite. Das "Gericht" verhandelte dann gegen den Häftling, der das Brot entwendet hatte, in Anlehnung an die Regeln, die in einem ordentlichen Strafprozess zu beachten sind. Die beiden Richter "verurteilten" den "Angeklagten" schliesslich wegen des Diebstahls zu 50 Stockschlägen, von denen der Häftling 25 sofort und den Rest nach 14 Tagen erhalten sollte. Der Angeklagte Bednarek war jedoch mit dem "Urteilsspruch" nicht einverstanden. Er war darüber empört. Er beschimpfte die "Mitglieder des Gerichts" und trat und misshandelte den "Staatsanwalt". Dann erklärte er, er mache nun das "Gericht" selbst. Der Häftling, der das Brot entwendet hatte, musste sich auf einen Tisch legen. Dann liess sich der Angeklagte Bednarek eine schwere Stange bringen. Zwei Häftlinge, der Stubenälteste und ein Unterkapo namens Michael, mussten den Delinquenten halten. Bednarek schlug dann mit voller Wucht auf den liegenden Häftling ein, um ihn zu töten. Er erklärte, dass er dem Häftling 50 Schläge geben wolle. Hierzu kam es jedoch nicht mehr. Denn der Häftling verstarb bereits infolge der heftigen Schläge vorher. Der Angeklagte Bednarek warf die Leiche des Opfers in den Waschraum, wo sie später von Leichenträgern abgeholt wurde.
2. Die Tötung von Häftlingen in der Strafkompanie durch den Angeklagten Bednarek (Eröffnungsbeschluss: Obersatz und Ziffern 2 und 7)
Allgemeines über das Verhalten des Angeklagten Bednarek gegenüber den Angehörigen der Strafkompanie
Der Angeklagte Bednarek wurde im Juni oder Juli 1943 als Blockältester der Strafkompanie, die im Block 11 des Lagerabschnittes B II d in Birkenau untergebracht war, eingesetzt. Auch in dieser Funktion schlug und misshandelte er die ihm unterstellten Häftlinge aus den geringsten Anlässen. Er schlug die Häftlinge in der Baracke, bei den Appellen, beim Essenausteilen, beim sog. "Sportmachen" und bei den sog. Läusekontrollen. In der Baracke, in der die Strafkompanie untergebracht war, war ein grosser Raum, in dem die dreistöckigen Betten für die Häftlinge standen. Dort prügelte der Angeklagte Bednarek die Häftlinge der ihm unterstellten Strafkompanie, wenn sie ihm aus irgendwelchen Gründen aufgefallen waren. Er schlug sie mit einem Stock oder dem Bein eines Schemels, wohin er sie traf. Häufig brachen die Häftlinge zusammen und fielen zu Boden. Dann trat er sie noch mit den Stiefeln in den Bauch oder auf den Brustkorb. Von den Häftlingen der Strafkompanie war er als brutaler Schläger gefürchtet. Unter den anderen Häftlingen des Lagerabschnittes B II d hatte er den Ruf eines grausamen und brutalen Blockältesten, der die ihm unterstellten Häftlinge sehr schlecht behandelte.
Darüber hinaus machte es ihm Freude, Häftlinge, wo er nur konnte, zu schikanieren. Zum Austeilen der Suppe stellte er häufig einen Kapo, mit dem er befreundet war, hinzu, der die andrängenden Häftlinge mit der Suppenkelle über den Kopf schlagen musste. Oft liess der Angeklagte Bednarek die Häftlinge vor dem Empfang der Suppe in Kniebeuge gehen und befahl, dass sie in Hockstellung hüpfend die Suppe zu empfangen hätten. Wenn dann die Häftlinge mit den gefüllten Essnäpfen weghüpfen, konnten sie es nicht verhindern, dass ein Teil der Suppe überschwappte und auf die Erde verschüttet wurde. So ging ihnen, die ständig Hunger hatten, noch ein Teil der kärglichen Nahrung verloren. Wiederholt goss der Angeklagte den Häftlingen, die sich nach seiner Meinung beim Essenempfang nicht diszipliniert genug verhielten, auch selbst die Suppe aus, so dass sie überhaupt kein Essen bekamen.
Der Angeklagte Bednarek liebte es ferner, sog. "Deckenkontrollen" zu machen. Er liess die Häftlinge seines Blocks zunächst die Decken im Hof des Blockes 11 ausklopfen und ausschütteln. Dann liess er die Decken wieder zusammenfalten und in den Block zurücktragen. Er selbst stellte sich mit einem Stock bewaffnet an der Tür des Blockes auf. Wenn die Häftlinge mit ihren Decken an ihm vorbeikamen, um in den Block hineinzugehen, schlug er mit dem Stock kräftig auf die zusammengefalteten Decken. Wenn sich dann noch etwas Staub zeigte, was meist der Fall war, insbesondere bei Sonnenlicht, schlug er die betreffenden Häftlinge mit dem Stock voller Wucht auf den Kopf oder auf den Rücken. Auf diese Weise erhielt einmal der Zeuge Pres. von dem Angeklagten drei Schläge mit dem Stock über den Rücken, worunter er noch heute zu leiden hat.
Bei den sog. "Läusekontrollen" verabreichte der Angeklagte Bednarek den Häftlingen in der Regel für jede gefundene Laus einen Stockhieb. Manchmal liess er den Häftlingen, bei denen Läuse gefunden worden waren, eine kalte Dusche geben. Die Häftlinge mussten sich in ihren Kleidern unter die kalte Dusche stellen und wurden dann mit kaltem Wasser solange abgeduscht, bis sie völlig durchnässt waren. Anschliessend durften sie nicht in den Block hinein, sondern mussten im Freien stehen bleiben. Viele erkrankten und kamen in den HKB. Ob Häftlinge an den Folgen dieser Behandlung gestorben sind, konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden.
Der Angeklagte Bednarek beschränkte sich jedoch nicht darauf, die Häftlinge zu schlagen, zu misshandeln und zu schikanieren. In einigen Fällen schlug der Angeklagte Häftlinge auch so lange, bis sie tot waren. Im einzelnen sind folgende Fälle festgestellt worden:
a. Einmal schlug der Angeklagte Bednarek im Block 11 aus einem nichtigen Anlass mit einem Holzschemel wahllos auf einen Häftling ein. Er wollte ihn töten. Er schlug den Häftling solange, bis dieser am Boden lag und kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Dann liess er den leblosen Körper durch andere Häftlinge wegschleppen und auf den Hof legen. Am anderen Morgen stellte der Zeuge Ja. fest, dass der Häftling tot war. b. Bei einer anderen Gelegenheit wiederholte der Angeklagte Bednarek das gleiche bei einem anderen Häftling. Er schlug wiederum im Block 11 mit einem Holzschemel auf einen Häftling, dessen Namen nicht bekannt ist, ein in der Absicht, ihn zu töten. Als der Häftling leblos am Boden lag, liess er ihn durch andere Häftlinge auf den Hof legen. Auch in diesem Fall stellte der Zeuge Ja. am anderen Morgen fest, dass der Häftling tot war.
c. Um die Weihnachtszeit 1943 trieb der Angeklagte Bednarek eines Abends einen polnischen Ingenieur, der gerade in die Strafkompanie gekommen war, mit einem dicken Stock, einem Schaufelstiel, durch den Block 11, indem er auf ihn einschlug. Dann jagte er den Mann auf den Hof. Dort schlug er weiter auf ihn ein, um ihn zu töten. Schliesslich brach der Häftling zusammen und blieb leblos liegen. Der Angeklagte Bednarek forderte den Stubenältesten auf polnisch auf, den Häftling wegzubringen, indem er sagte: "Schaff' diese stinkende Scheisse fort, er hat unter sich gemacht, bringt ihn unter die kalte Dusche." Der Stubenälteste Sta. schleppte daraufhin mit drei anderen Häftlingen, unter denen sich der Zeuge Schwarz. befand, den leblosen Körper in den Waschraum. Dort zogen sie ihn aus. Dabei stellten sie fest, dass der polnische Ingenieur bereits tot war. Sta. und ein anderer Häftling wuschen dann die Leiche ab. Der Zeuge Schwarz. erfuhr anschliessend von dem Stubenältesten, dass der Angeklagte Bednarek noch eine "alte Rechnung" mit dem polnischen Ingenieur zu begleichen gehabt habe. d. Im Frühjahr 1944 erwischte der Angeklagte Bednarek nach dem Abendappell einen Häftling aus dem Lager, der einen Kameraden auf Block 11 im Lagerabschnitt B II d heimlich besuchen wollte, um ihm einige Lebensmittel zu bringen. Da die Strafkompanie von den anderen Lagerinsassen isoliert gehalten werden sollte, war es diesen verboten, den Block 11 zu betreten. Der Angeklagte Bednarek schrie den Häftling an und schob ihn auf den Korridor in den Block 11 hinein. Dort schlug er mit einem Stock wahllos auf ihn ein. Er traf ihn auf den Kopf und auf den Rücken. Der Häftling brach schliesslich zusammen und fiel auf den Boden. Nun legte der Angeklagte Bednarek dem Häftling einen Stock auf den Hals und stellte sich mit beiden Füssen auf die beiden Enden des Stockes. Dann wippte er auf den beiden Enden des Stockes stehend einige Zeit hin und her, bis der Häftling tot war.
3. Die Tötung von Häftlingen aus dem sog. Siemens-Kommando im Block 11 (Lagerabschnitt B II d)
Allgemeines über das Siemens-Kommando und das Verhalten des Angeklagten Bednarek den Angehörigen dieses Kommandos gegenüber
Im Herbst 1943 kam eine Gruppe jüdischer Häftlinge auf den Block 11, in dem die Strafkompanie untergebracht war, die nicht zur Strafkompanie versetzt worden waren, sondern als Arbeitskräfte für eine von der Firma Siemens-Schuckert Werke bei Bobrik in der Nähe von Auschwitz-Birkenau zu errichtende Fabrik ausgesucht worden waren. Diese Angehörigen des sog. Siemens-Kommandos waren von einem Oberingenieur der Firma Siemens Schuckert Werke, dem Zeugen Bund., als Facharbeiter der Werkmaschinenbranche aus jüdischen Häftlingen, die mit RSHA-Transporten, vornehmlich aus Frankreich, angekommen und in das Quarantänelager (B II a) aufgenommen worden waren, ausgewählt worden. Bis zur Errichtung der Fabrik wurden sie zunächst im Block 11 des Lagerabschnitts B II d provisorisch untergebracht. Hier sollten sie bleiben, bis die Fabrik gebaut und ein Lager für sie in der Nähe der Fabrik errichtet war. Sie gehörten nicht zur Strafkompanie, mussten jedoch mit deren Angehörigen den Raum in der Baracke teilen. Ihr Blockältester wurde der Angeklagte Bednarek. Die Häftlinge des Siemens-Kommandos sollten nach dem Wunsch der Firma Siemens eine gute Behandlung erhalten. Zunächst wurde nur ein Teil der Häftlinge für die Errichtung der Fabrik benötigt. Die anderen brauchten nicht zu arbeiten. Sie blieben tagsüber im Block 11. Sie sollten sich für den kommenden Arbeitseinsatz erholen. Sie bekamen doppelte Verpflegung, bessere Kleider und eine zusätzliche Decke, Die Fabrik war am 1.4.1944 im Rohbau fertig. An diesem Tag wurde das Richtfest gefeiert. Am 20.5.1944 kamen alle für die Fabrik ausgewählten Häftlinge, soweit sie noch am Leben waren, aus dem Block 11 auf das Fabrikgelände, wo ein eigenes Lager für sie neben der Fabrik errichtet worden war. Das Lager war von einem leichten Zaun umgeben. Das Arbeitskommando wurde von einem SS-Wachkommando bewacht.
Als das Siemens-Kommando noch in dem Block 11 war, erregte es von Anfang an das Missfallen des Angeklagten Bednarek. Dem Angeklagten passte es nicht, dass die Angehörigen des Siemens-Kommandos eine Sonderbehandlung erhalten sollten, insbesondere, dass sie nicht zu arbeiten brauchten und doppelte Verpflegung bekamen. Er schikanierte die Angehörigen des Kommandos, wo er nur konnte. Gleich nach ihrer Ankunft begrüsste er die Häftlinge des Siemens-Kommandos mit den Worten: "Ihr kommt hier von der Firma Siemens und glaubt, Ihr hättet Sonderrechte. Ihr seid hier in der Strafkompanie, zwar nicht als Bestrafte, Ihr müsst Euch aber in die Disziplin der Strafkompanie fügen." Nach dieser Ansprache schlug er sofort auf die Angehörigen des Siemens-Kommandos ohne Grund mit einem Stock ein. In der Folgezeit schikanierte er sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit. So duldete er nicht, dass sie sich tagsüber, wenn sie nicht zur Arbeit auszurücken brauchten, im Inneren der Baracke aufhielten. Sie mussten sich trotz der im Herbst und Winter herrschenden Kälte tagsüber im Hof aufhalten, ohne dass ihnen der Angeklagte Bednarek die Möglichkeit liess, sich aufzuwärmen. Als Grund für diese Massnahme gab der Angeklagte an, dass das Innere der Baracke sauber gehalten werden müsse. Wenn sich die Häftlinge des Siemens-Kommandos wegen der Kälte in den Waschraum begaben, um sich dort etwas aufzuwärmen, jagte sie der Angeklagte sofort wieder auf den Hof hinaus.
Häufig machte er mit ihnen "Sport". Dabei erklärte er zynisch: "Ich werde Euch schon in Form halten, ich werde Euch turnen lehren. Ihr braucht nicht zu arbeiten, ich werde Euch daher die nötige Medizin geben, damit Ihr in Form kommt und Eure Form behaltet." Dann machte er mit ihnen gymnastische Übungen. Ausserdem mussten die Häftlinge laufen, sich hinwerfen, wieder aufstehen, hüpfen usw. gleichgültig ob Wasser oder Schnee im Hof war.
An dem "Sport" mussten sich auch die Häftlinge beteiligen, die nicht zum Siemens-Kommando gehörten, aber wegen Erkrankungen im Block bleiben durften, also nicht mit den anderen zur Arbeit auszurücken brauchten. Wenn diese Häftlinge aus Erschöpfung den Sport nicht mitmachen konnten, schlug der Angeklagte Bednarek wild auf sie ein. Im übrigen schikanierte er die Angehörigen des Siemens-Kommandos ebenfalls mit Läuse- und Deckenkontrollen.
Der Angeklagte Bednarek begnügte sich jedoch nicht nur mit Schikanen und Misshandlungen. In folgenden Fällen tötete er auch Häftlinge.
a. und b.: Im Februar 1944 forderte der Angeklagte Bednarek eines Sonntags die Angehörigen des Siemens-Kommandos auf, sie sollten sich freiwillig für das jüdische Sonderkommando, dass die Leichen aus den Gaskammern herauszuschleppen und in den Verbrennungsöfen zu verbrennen hatte, melden. Er versuchte ihnen die Arbeit in diesem Kommando durch den Hinweis auf das gute Essen und den Schnaps, den die Angehörigen des Sonderkommandos erhielten, schmackhaft zu machen. Von den Angesprochenen meldete sich jedoch niemand freiwillig. Darüber war der Angeklagte Bednarek verärgert. Er machte deshalb mit ihnen "Sport". Die Häftlinge mussten sich hinwerfen, wieder aufstehen, im Liegen rollen, sich biegen, hüpfen und so weiter. Nachdem er die Häftlinge auf diese Weise eine Zeitlang schikaniert hatte, erklärte er plötzlich: "Jetzt werden wir Zirkus machen." Danach sagte er zu einem jüdischen polnischen Häftling namens Poliwodan, indem er auf einen anderen jüdischen Häftling deutete: "Schau mal, dieser stinkende Jude hat gesagt, dass Deine Mutter eine Hure sei. Gib ihm eins!" Tatsächlich hatte der betreffende Häftling jedoch nichts gesagt. Poliwodan reagierte daher auf die Aufforderung des Angeklagten Bednarek nicht. Bednarek forderte ihn erneut auf, den anderen jüdischen Häftling zu schlagen, indem er sagte: "Gib ihm eine in die Fresse!" Als sich Poliwodan immer noch nicht rührte, schlug ihn der Angeklagte Bednarek mit seinem Stock auf den Kopf. Nun schlug Poliwodan ein wenig auf den anderen jüdischen Häftling ein. Daraufhin wandte sich der Angeklagte Bednarek an diesen und sagte zu ihm: "Erlaubst Du, dass dieser Jude Dich schlägt? Gib ihm zurück!" Nun schlug der zweite Häftling etwas auf den Poliwodan. Dem Angeklagten Bednarek genügte dieses Schlagen jedoch nicht. Er schlug nun selbst auf die beiden Häftlinge mit einem Stock abwechselnd ein. Er hatte die Absicht, beide zu töten. Er schlug wahllos auf sie ein, wohin er sie gerade traf, bis beide blutüberströmt zu Boden fielen. Nun trat der Angeklagte Bednarek mit seinen Stiefeln auf sie ein und schlug sie erneut, bis beide reglos liegen blieben. Beide Häftlinge starben infolge der Misshandlung des Angeklagten Bednarek. Der Angeklagte Bednarek liess die leblosen Körper zu der Stelle im Block 11 bringen, wo die Leichen abgelegt wurden. Sie wurden später in das Krematorium gebracht.
c. Eines Tages machte der Angeklagte Bednarek wiederum "Sport" mit den Häftlingen des Siemens-Kommandos. Die Häftlinge mussten in einer Reihe antreten und auf Befehl des Angeklagten Bednarek "gymnastische Übungen" machen. Am Ende der Reihe befand sich ein namentlich nicht bekannter Häftling, der schliesslich so erschöpft war, dass er die verlangten Übungen nicht mehr mitmachen konnte. Er fiel zu Boden und war nicht mehr in der Lage, aufzustehen. Als der Angeklagte Bednarek dies sah, stürzte er sich auf ihn und trat ihn mit seinen Stiefeln, wohin er ihn gerade traf. Vor allem trat er ihn mit Wucht in die Herzgegend, auf den Brustkorb und in die Geschlechtsteile. Seine Absicht war es, den Häftling zu töten. Er hörte erst mit der Misshandlung des Häftlings auf, bis dieser tot war. Die Leiche liess er in eine Decke einwickeln und in der Nähe des Waschraumes ablegen.
d. Eine Woche nach diesem Vorfall hielt der Angeklagte Bednarek einen Läuseappell ab. Bei einem jüdischen Häftling namens Chaim Birnfeld, der zu dem Siemens-Kommando gehörte, fand er Läuse. Er rief daraufhin den Stubendienst herbei und befahl diesem, den Häftling zu schlagen. Der Stubendienst schlug daraufhin im Beisein des Angeklagten Bednarek mit einem Stock voller Wucht auf diesen Häftling ein. Er schlug ihn nicht nur auf das Gesäss, sondern auch auf die Wirbelsäule. Der Angeklagte Bednarek war sich bewusst und rechnete damit, dass der Häftling infolge der Schläge sterben könnte. Das nahm er jedoch in Kauf und billigte es. Nachdem der Häftling Birnfeld zusammengeschlagen war, wurde er auf sein Bett gelegt. Er hatte furchtbare Schmerzen. Er weinte und sagte zu seinen Kameraden, dass er Schmerzen an der Wirbelsäule hätte. In der Nacht jammerte und klagte er weiter. Schliesslich war er still. Am anderen Morgen stellten die Zeugen Alt. und Schwarz., die mit dem Häftling Birnfeld das gleiche Bett teilten, fest, dass er tot war. Er ist an den Folgen der durch die Schläge des Stubendienstes erlittenen Verletzungen gestorben.
III. Einlassung des Angeklagten Bednarek, Beweismittel, Beweiswürdigung
Der Angeklagte Bednarek hat entschieden in Abrede gestellt, jemals einen Häftling getötet zu haben. Er räumt allerdings ein, dass er die ihm unterstellten Häftlinge geschlagen habe, um die Disziplin im Block aufrecht zu erhalten. Zunächst habe er - so hat er sich eingelassen - Häftlinge nur mit der Hand geschlagen, wenn zwischen ihnen Streit entstanden sei oder wenn ein Häftling Brot gestohlen habe. Dieses Schlagen habe jedoch nicht immer geholfen. Jeder Häftling habe Hunger gehabt, daher sei viel Brot gestohlen worden. Viele hätten das gestohlene Brot gegen Zigaretten auf dem Schwarzen Markt im Lager verkauft. Er habe die ihm unterstellten Häftlinge darauf aufmerksam gemacht, dass jeder, der einem anderen Brot stehle, bei den kärglichen Rationen dessen Leben bedrohe. Daher habe er ihnen immer wieder schwere Strafen angedroht, wenn sie bei Brotdiebstählen erwischt würden. Als dies nichts genützt habe, habe er selbst Strafen verhängt. Er habe die Häftlinge für "Vergehen" mit vier bis sechs Stockschlägen bestraft. In seinem Block sei jedoch nie ein Häftling totgeschlagen worden. Wenn frühere Häftlinge das Gegenteil behaupteten, so sei dies unwahr. Auch als Blockältester des Blockes 11 im Lagerabschnitt B II d habe er niemals einen Häftling totgeschlagen oder totschlagen lassen.
Der Angeklagte Bednarek wird jedoch durch die Aussagen vieler Zeugen überführt, Häftlinge getötet zu haben. Im einzelnen beruhen die Feststellungen des Gerichts auf folgenden Zeugenaussagen:
1. Zu II.1a.
Der Zeuge Dr. Kl. kam im Herbst 1941 als Häftling in den Block 8A. Er blieb etwa drei bis vier Monate in dem Block. Sein Blockältester war der Angeklagte Bednarek. Der Zeuge kannte daher den Angeklagten gut. Der Zeuge hat - wie er glaubhaft bekundet hat - mit eigenen Augen gesehen, dass der Angeklagte Bednarek Häftlinge auf dem Flur des Blockes 8 mit einem Stock oder Hocker totgeschlagen hat. Der Zeuge hat sich davon überzeugen können, dass die Opfer von Leichenträgern zum Leichenkeller im Block 28 weggebracht worden sind. Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, dass die Opfer auch tatsächlich tot waren. Der Zeuge hat auch erklärt, dass der Angeklagte Bednarek diese Häftlinge wegen kleiner Vergehen getötet habe. Der Zeuge ist glaubwürdig. Er hat sich nicht - wie die Verteidigung meint - in Widersprüche verwickelt. Der Zeuge hat zwar eingeräumt, dass es mehr als 5 Häftlinge gewesen sein können, die der Angeklagte Bednarek getötet habe. Um aber jede mögliche Unsicherheit auszuschalten, hat der Zeuge nur eine Mindestzahl angegeben. Er hat mit Bestimmtheit erklärt, dass er sich an mindestens 5 Fälle erinnern könne, in denen der Angeklagte Bednarek Häftlinge in der beschriebenen Weise getötet habe. Vor allem konnte sich der Zeuge auch noch an den alten Häftling, der sich stets ungeschickt verhielt und daher dem Angeklagten Bednarek unsympathisch war, erinnern. Der Zeuge hat seine Aussage sehr zurückhaltend gemacht. Er verfügt nach dem Eindruck, den er in der Hauptverhandlung hinterlassen hat, über ein gutes Gedächtnis. Das Gericht hat daher keine Bedenken, ihm vollen Glauben zu schenken.
Seine Aussage wird im übrigen zumindest mittelbar durch die Aussagen der glaubwürdigen Zeugen Dr. F. und Dr. P. gestützt. Beide Zeugen haben übereinstimmend bekundet, dass der Angeklagte Bednarek ein brutaler Schläger gewesen sei. Der Zeuge F. war zwar nicht selbst auf dem Block 8A. Er war im Herbst 1941 bereits im HKB eingesetzt. Die Häftlingsärzte und Häftlingspfleger im HKB brauchten die allgemeinen Appelle nicht mitzumachen. Bei ihnen wurde ein besonderer Appell im HKB abgehalten, der stets sehr kurz war. Der Zeuge konnte daher den allgemeinen Appell vom Fenster des Blockes aus, in dem er beschäftigt war, beobachten. Dabei hat er gesehen - wie er glaubhaft berichtet hat -, dass der Angeklagte Bednarek Häftlinge geschlagen und misshandelt habe. Häufig habe er die Häftlinge auch - so hat der Zeuge weiter bekundet - mit einem Hocker in der Vorhalte in Kniebeuge gehen lassen. Die Häftlinge hätten dann längere Zeit in dieser Stellung verharren müssen. Viele der schwachen Häftlinge seien infolge dieser Quälerei umgefallen. Dann habe der Angeklagte Bednarek häufig so kräftig auf sie eingeschlagen, dass sie anschliessend in den HKB hätten gebracht werden müssen. Er - der Zeuge - habe zwar die misshandelten Häftlinge im HKB selbst nicht gesehen und wisse auch nicht aus eigener Anschauung, ob diese Häftlinge danach gestorben seien, da er nicht in der chirurgischen Abteilung des HKB gearbeitet habe. Von seinen Kameraden aus der chirurgischen Abteilung habe er jedoch erfahren, dass von den misshandelten Häftlingen viele gestorben seien. Auch sonst seien misshandelte Häftlinge aus dem Block 8 oder 8A in den HKB gebracht worden. Diese seien nach seiner Auffassung von dem Angeklagten Bednarek geschlagen worden. Das könne er sagen, auch wenn er selbst die Misshandlungen nicht habe mitansehen können. Denn der Blockälteste des Blockes 8 namens Kassube sei dafür bekannt gewesen, dass er die ihm unterstellten Häftlinge nicht schlage. Daher könne nur der Angeklagte Bednarek die aus dem Block 8 bzw. 8A gebrachten Opfer misshandelt haben. Im übrigen hätten die Häftlinge, die die Misshandelten in den HKB gebracht hätten, erzählt, dass Bednarek sie geschlagen habe.
Auch der Zeuge Dr. P. hat - wie er glaubhaft bekundet hat - mit eigenen Augen gesehen, dass der Angeklagte Bednarek Häftlinge, die zu spät zu den Appellen gekommen sind, brutal niedergeschlagen hat. Nach der Aussage des Zeugen hat Bednarek dann die am Boden liegenden Menschen noch getreten. Von Kameraden habe er erfahren, so hat der Zeuge weiter ausgesagt, dass später einige dieser von Bednarek misshandelten Häftlinge gestorben seien.
Der Zeuge Dr. P. hat - wie bereits mehrfach erwähnt - ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Er hat stets sehr gewissenhaft zwischen dem unterschieden, was er selbst gesehen und was er nur von anderen gehört hat. Wenn er etwas nicht genau in Erinnerung hatte, so hat er das offen zugegeben. Das Gericht hat daher seinen Angaben vollen Glauben geschenkt.
Damit ist die Bekundung des Zeugen Dr. Kl. zumindest mittelbar bestätigt worden. Nach dem von den Zeugen Dr. F. und Dr. P. geschilderten Verhalten des Angeklagten Bednarek passt die Tötung der mindestens 5 Häftlinge durch den Angeklagten Bednarek durchaus in dessen Persönlichkeitsbild und sein sonstiges Verhalten gegenüber den ihm unterstellten Häftlingen. Die Aussage des Zeugen Dr. Kl. ist daher glaubhaft.
Dass der Angeklagte Bednarek in den 5 Fällen den Tötungsvorsatz gehabt hat, hat das Schwurgericht daraus gefolgert, dass der Angeklagte Bednarek nicht eher mit dem Schlagen aufgehört hat, bis die Häftlinge tot waren. Hierfür spricht ferner, dass der Angeklagte die Häftlinge nicht im Block selbst geschlagen hat, sondern sie zunächst mit auf den Korridor herausnahm. Auch die Tatsache, dass in mehreren Fällen Häftlinge infolge der Misshandlungen des Angeklagten Bednarek unmittelbar danach gestorben sind, spricht eindeutig dafür, dass er sie nicht nur misshandeln, sondern töten wollte. Wenn der Angeklagte die Häftlinge nicht hätte töten, sondern nur schlagen wollen, hätte ihm der erste Fall, in dem ein Häftling infolge seiner Misshandlung gestorben ist, eine Lehre sein müssen, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Wenn er aber gleichwohl in den folgenden Fällen immer wieder auf die Häftlinge einschlug, bis sie tot waren, so kann nach der Überzeugung des Gerichts kein Zweifel bestehen, dass er in diesen 5 Fällen den Tod der Häftlinge gewollt hat.
2a. Zu II.1b.
Die Feststellungen unter II.1b. beruhen auf der glaubhaften Aussage des Zeugen Be. Der Zeuge hat diesen Fall, den der Angeklagte Bednarek mit Entschiedenheit bestreitet, nach seinem äusseren Verlauf widerspruchsfrei und in sich schlüssig so geschildert, wie er unter II.1b. dargestellt worden ist. Das Gericht hat keine Bedenken, dem Zeugen, der einen zuverlässigen und glaubwürdigen Eindruck hinterlassen hat, zu glauben. Über seine Glaubwürdigkeit sind bereits bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Boger Ausführungen gemacht worden. Der Zeuge machte nicht den Eindruck, dass er zu phantasievollen Erzählungen neigt. Seine Aussage war klar und bestimmt. Es erscheint daher ausgeschlossen, dass er diesen Fall erfunden hat. Die vom Angeklagten Bednarek zu seiner Entlastung benannten nachfolgend im einzelnen aufgeführten Zeugen konnten die Glaubwürdigkeit der Zeugen Dr. Kl. und Be. nicht erschüttern.
Der Zeuge U. war nach seiner Aussage um die Weinachtszeit 1941 ebenfalls auf dem Block 8A. Er will von einem "Gericht" an Weihnachten 1941 nichts erfahren habe. Er will auch nichts davon gehört haben, dass der Angeklagte an Weihnachten 1941 einen Häftling totgeschlagen habe. Der Zeuge gab zu, dass er mit dem Angeklagten Bednarek zwar nicht im Block 8A, aber später befreundet gewesen sei. Ihm gegenüber sei Bednarek "in Ordnung" gewesen. Schon wegen dieser Freundschaft zwischen dem Zeugen und dem Angeklagten Bednarek während der Lagerzeit ist seine Aussage mit besonderer Vorsicht zu werten.
Im übrigen musste der Zeuge aber einräumen, dass er am Heiligen Abend 1941 gar nicht im Block 8 bzw. 8A gewesen sei. Er habe - so hat er angegeben - am 24.12.1941 ausserhalb des Blockes während eines Zeitraumes von 12 Stunden Kartoffeln geschält. Nach Arbeitsschluss sei er dann noch einmal aus dem Block weggegangen. Es ist daher durchaus möglich, dass sich der vom Zeugen Be. geschilderte Vorfall in der Zeit abgespielt hat, in der der Zeuge U. vom Block 8 abwesend war. Wenn der Zeuge anschliessend nichts von dem Vorfall durch Kameraden erfahren hat, so zwingt das auch nicht zu dem Schluss, dass sich der Vorfall nicht abgespielt haben könne. Denn im KL Auschwitz waren Misshandlungen und Tötungen von Häftlingen so häufig, dass davon wenig Aufhebens gemacht worden ist. Es ist denkbar, dass man diese Angelegenheit nicht so wichtig genommen hat, um sie dem Zeugen U. zu berichten.
Der Zeuge Gu. war nur vom 8.2.1941 bis August 1941 im Block 8 oder 8A untergebracht. Er kann daher den Angeklagten Bednarek nicht lange als Blockältesten erlebt haben. Der Zeuge hat erklärt, dass er über das Verhalten des Angeklagten Bednarek gegenüber den Häftlingen nichts sagen könne. Der Angeklagte habe seines Wissens Häftlinge weder geschlagen noch getötet. Er habe den Häftlingen beim Appell höchstens einmal einen Schubs gegeben. Sonst sei er den Häftlingen gegenüber menschlich gewesen.
Auch diese Aussage kann die Glaubwürdigkeit der Zeugen Dr. Kl. und Be. sowie der Zeugen Dr. F. und Dr. P. nicht erschüttern. Der Zeuge kann nur kurze Zeit mit dem Angeklagten Bednarek zusammen gewesen sein. Denn der Angeklagte kam erst im Juni oder Juli 1941 als Blockältester in den Block 8A, während der Zeuge Gu. bereits im August 1941 wieder aus dem Block 8 weggekommen ist. Es ist daher denkbar und möglich, dass sich der Angeklagte Bednarek in dieser Zeit, zumal es die erste Zeit in seiner Blockältestentätigkeit gewesen ist, noch relativ anständig gegenüber den Häftlingen verhalten hat, so dass er aus der Sicht des Zeugen Gu. gesehen, als "menschlich" erschien. Im übrigen musste der Zeuge Gu. einräumen, dass er an Gedächtnisschwund leide und sich nicht mehr an alles erinnern könne. Es ist daher möglich, dass er manches bezüglich des Angeklagten Bednarek vergessen hat, zumal er nach seiner Versetzung aus dem Block 8 weiterhin im KL Auschwitz verblieb. Er war in den folgenden Jahren noch inanderen Blöcken untergebracht und hatte andere Vorgesetzte. Möglicherweise haben spätere Erlebnisse im KL Auschwitz seine Erinnerung an den Angeklagten Bednarek verblassen lassen.
Der Zeuge Poz. hat bei seiner Vernehmung erklärt, dass seiner Meinung nach in Block 8A niemand getötet worden sei, als der Angeklagte Bednarek dort Blockältester gewesen sei. Der Zeuge hat damit jedoch nur seine subjektive Auffassung zum Ausdruck gebracht, ohne überzeugende Gründe hierfür darlegen zu können. Der Zeuge war selbst nicht im Block 8 oder 8A untergebracht. Er konnte daher die von den im Block 8A untergebrachten Zeugen geschilderten Vorgänge selbst gar nicht miterleben. Der Zeuge, der selbst in Block 3 wohnte, ist nach seiner Aussage nur besuchsweise in den Block 8A gekommen. Er hat sich mit dem Angeklagten Bednarek angefreundet und ihn deshalb öfters besucht. Es ist durchaus möglich, dass der Angeklagte Bednarek während dieser Besuche Häftlinge nicht geschlagen oder getötet hat. Das schliesst jedoch nicht aus, dass sich der Angeklagte Bednarek in der ganzen übrigen Zeit, in der der Zeuge nicht in Block 8A war, ganz anders verhalten hat.
Der Zeuge Poz. erschien im übrigen nicht recht glaubwürdig. Das Gericht hatte den Eindruck, dass er den Angeklagten Bednarek im Hinblick auf seine Freundschaft aus der Lagerzeit unter allen Umständen entlasten wollte. Nach seinen eigenen Angaben hat er in den letzten 4 Jahren vor der Hauptverhandlung mit vielen Häftlingen über den Angeklagten Bednarek, insbesondere darüber, ob der Angeklagte Bednarek Häftlinge in Auschwitz getötet habe, gesprochen. Das geschah offensichtlich nur im Hinblick auf das gegen den Angeklagten Bednarek eingeleitete Ermittlungsverfahren. Der Zeuge will keinen einzigen Häftling getroffen haben, der mit eigenen Augen gesehen habe, dass Bednarek Häftlinge getötet habe. Das mag sein. Denn in Auschwitz waren Tausende von Häftlingen, die den Angeklagten Bednarek während seiner Tätigkeit in Block 8A nicht beobachten konnten. Die Tötungshandlungen wurden meist nur von wenigen Häftlingen wahrgenommen. Auch in der Hauptverhandlung haben nur die Zeugen Dr. Kl. und der Zeuge Be. als Augenzeugen von Tötungshandlungen des Angeklagten Bednarek in Block 8A berichten können. Andererseits musste der Zeuge Poz. einräumen, dass ehemalige Häftlinge, mit denen er in den letzten vier Jahren gesprochen hat, bereits damals im Lager davon gehört hätten, dass Bednarek Häftlinge getötet haben solle.
Die Aussage des Zeugen Poz. kann somit ebenfalls nicht die Bekundungen der Zeugen Dr. Kl. und Be. erschüttern.
Der Zeuge Kruc. will während seiner Lagerzeit nichts davon gehört haben, dass der Angeklagte Bednarek Häftlinge totgeschlagen habe. Er habe nur gesehen - so hat der Zeuge berichtet - dass der Angeklagte geschrien habe, herumgesprungen sei und Häftlinge geschlagen habe, Bednarek habe grossen Eifer gezeigt und "grossen Wind" gemacht. Der Zeuge war aber während seines Aufenthaltes im Stammlager nicht im Block 8 oder 8A untergebracht. Es ist daher durchaus möglich, dass er von den Vorgängen im Block 8A, über die die Zeugen Dr. Kl. und Be. berichtet haben, nichts erfahren hat.
Der Zeuge Mir. war nach seiner Aussage vom Dezember 1940 bis etwa Juni 1941 in dem Block 8A, der zunächst die Nummer 10 hatte. Der Zeuge konnte sich noch erinnern, dass der Angeklagte Bednarek erst Blockältester geworden sei, als er - der Zeuge - schon einige Zeit in dem Block gewesen ist. Der Zeuge wusste nicht mehr genau, wann er aus dem Block 8A weggekommen ist. Er glaubte sich jedoch noch mit Bestimmtheit erinnern zu können, dass er bereits in der zweiten Hälfte des August 1941 in den HKB gekommen sei. Er kann daher nicht mehr lange mit dem Angeklagten Bednarek, der erst im Sommer (Juni oder Juli 1941) Blockältester von Block 8A geworden ist, zusammen gewesen sein. Der Zeuge meint auch, dass er nur noch einen Monat im Block 8A geblieben sei, nachdem der Angeklagte Bednarek den Block 8A als Blockältester übernommen habe. Der Zeuge kann somit von den Tötungshandlungen des Angeklagten Bednarek ab September 1941 aus eigener Wahrnehmung nichts wissen. Die Aussage des Zeugen, er habe selbst nicht gesehen, dass der Angeklagte Bednarek Häftlinge totgeschlagen habe, kann daher durchaus der Wahrheit entsprechen, ohne dass damit die Aussagen der Zeugen Dr. Kl. und Be. erschüttert werden.
Im übrigen hat der Zeuge auch bekundet, dass der Angeklagte Bednarek ein "scharfer Blockältester" gewesen sei. Er habe den Ruf eines strengen und scharfen Blockältesten gehabt. In seiner Gegenwart habe der Angeklagte auch auf Häftlinge eingeschlagen. Er sei unberechenbar gewesen. Um Gründe, die Häftlinge zu schlagen, sei er nie verlegen gewesen. Es habe ihm genügt, dass ein Häftling schlecht in der Reihe gestanden habe oder sich zu langsam bewegt oder die Mütze zu spät abgenommen habe, um ihn zu schlagen. Bednarek habe mit den Häftlingen im Jahre 1941 auch "Sport" getrieben. Das sei eine Quälerei gewesen, da die Häftlinge müde von der Arbeit zurückgekommen seien und infolge der unzureichenden Verpflegung in schlechter körperlicher Verfassung gewesen seien. Nach seiner - des Zeugen - Meinung sei dieser "Sport" völlig überflüssig gewesen. Den "Sport" hätte der Angeklagte Bednarek auch anders durchführen können. Das Sportmachen habe in Hüpfen, Rollen, Kniebeugemachen usw. bestanden. Die Häftlinge seien am nächsten Tag stets vollkommen erledigt gewesen. Wer den "Sport" wegen Erschöpfung nicht richtig habe mitmachen können, sei von den Stubendiensten geschlagen worden. Viele Häftlinge seien auch liegen geblieben, die nicht mehr hätten mitmachen können. Ob Häftlinge infolge des "Sportmachens" gestorben seien, wisse er nicht. Das habe er nicht feststellen können, weil sie - die Häftlinge, die nicht liegen geblieben seien - nach dem "Sport" sofort wieder auf ihre Stuben hätten zurückgehen müssen. Der Stubendienst habe die Liegengebliebenen mitgenommen. Beim Appell am nächsten Morgen seien die Opfer des Sportes am Ende des aufgestellten Blockes hingelegt worden. Später seien sie in den HKB gekommen.
Der Zeuge war im Jahre 1943 im Lagerabschnitt B II d untergebracht. Dort hörte er - wie er glaubhaft bekundet hat - dass man sich in diesem Lagerabschnitt erzählt hat, dass der Angeklagte Bednarek auf dem Block 11 Menschen töte. Das hätten diejenigen erzählt - so hat der Zeuge berichtet - die von der Strafkompanie zurückgekommen seien.
Der Zeuge Mir. hat somit keine den Angeklagten Bednarek entlastende Aussage gemacht. Er hat im Gegenteil zumindest mittelbar die Aussage der Zeugen gestützt, die von Tötungshandlungen des Angeklagten Bednarek im Block 11 im Lagerabschnitt B II d berichtet haben.
Weitere Zeugen, die der Angeklagte Bednarek zu seiner Entlastung benannt hat, sind kommissarisch vor polnischen Gerichten vernommen worden. Die Protokolle über diese Vernehmungen sind in der Hauptverhandlung verlesen worden. Auch diese Zeugen konnten nicht die Aussagen der Zeugen Dr. Kl. und Be. erschüttern.
Der Zeuge Cz., der den Angeklagten Bednarek schon aus der Vorkriegszeit kannte, hat bekundet, dass er sich im Jahre 1941 an den Angeklagten Bednarek wegen zusätzlicher Belieferung mit Lebensmitteln gewandt habe. Bednarek habe ihm erklärt, er könne ihm etwas geben, wenn die Portionen bereits verteilt seien und er - Bednarek - allein in seinem Zimmer sei. Er - der Zeuge - sei dann von Bednarek während eines Zeitraumes von etwa zwei Monaten mit Lebensmitteln unterstützt worden. Ausserdem habe ihm Bednarek erlaubt, die Kessel in der Mittagspause zu spülen, damit er die Suppenreste, die meist noch in den Kesseln gewesen seien, erhalte. Weitere Kontakte habe er mit dem Angeklagten nicht unterhalten. Dann habe er - der Zeuge - von Kameraden erfahren, dass der Angeklagte Bednarek ein Sadist sei und die Häftlinge wegen geringer Übertretungen der Disziplin und Lagerordnung schlage. Daher habe er die Verbindung mit Bednarek abgebrochen. Der Zeuge hat zwar erklärt, ihm sei nichts davon bekannt, dass der Angeklagte Bednarek jemanden getötet habe. Er war jedoch nicht in dem Block 8 oder 8A untergebracht, sondern wohnte auf dem Block 23 (der zunächst die Nr.4 hatte). Ihm können daher, da er nur wegen der zusätzlichen Lebensmittelbesorgung mit dem Angeklagten Bednarek in Verbindung stand, Tötungshandlungen des Angeklagten nicht zur Kenntnis gekommen sein. Im übrigen stützt die Tatsache, dass der Angeklagte Bednarek - wie der Zeuge bekundet hat - bereits damals im Lager von Häftlingen als "Sadist" bezeichnet worden ist, zumindest mittelbar die Aussagen der Zeugen Dr. Kl. und Be.
Der Zeuge Za. war überhaupt nicht im KL Auschwitz. Er hat daher den Angeklagten Bednarek auch nicht kennen gelernt. Dem Zeugen ist nur von dem inzwischen verstorbenen Edward Jas. sen. berichtet worden, dass der Angeklagte Bednarek "unschuldig" sei. Das gleiche hat der Verstorbene auch seinem Sohn, dem Zeugen Edward Jas. jun. erklärt. Wenn Bednarek jemanden geschlagen habe - so hat der Vater seinem Sohn nach dessen Aussage erzählt - sei dieses nur im Interesse des betreffenden Häftlings erfolgt. Beiden Zeugen gegenüber hat der Verstorbene berichtet, dass der Angeklagte Bednarek sich um die in das Lager verbrachten Kinder gekümmert und ihnen zusätzlich Lebensmittel verschafft habe. Vor allem habe er sich während des Evakuierungsmarsches um eine Gruppe von Kindern besorgt gezeigt.
Auch diese gute Meinung des verstorbenen Edward Jas. sen. über den Angeklagten Bednarek vermag die Aussagen der Zeugen Dr. Kl. und Be. nicht zu erschüttern. Zunächst steht nicht fest, ob der Verstorbene überhaupt jemals im Block 8A untergebracht war. Nach der Aussage des Zeugen Edward Jas. jun. hat sein Vater den Angeklagten Bednarek erst als Blockältesten der Strafkompanie kennengelernt. Es ist daher durchaus möglich, dass der Vater des Zeugen von den Misshandlungen des Angeklagten Bednarek im Block 8A nichts erfahren hat. Es mag auch sein, dass der Angeklagte Bednarek gut zu Kindern war. Auch andere Zeugen haben berichtet, dass sich der Angeklagte Bednarek um Kinder gekümmert habe. Das schliesst jedoch nicht aus, dass sich der Angeklagte den erwachsenen Häftlingen gegenüber ganz anders verhalten hat.
Der Zeuge Za. hat keine Kenntnis davon, ob der Verstorbene Jas. jemals als Häftling im Block 11, in dem die Strafkompanie untergebracht war, gewesen ist. Auch nach der Aussage des Zeugen Jas. ist dies zumindest zweifelhaft. Der Zeuge Edward Jas. jun. hat zwar auf eine Frage des Staatsanwalts erklärt, dass sein Vater Verbindung mit dem Angeklagten Bednarek gehabt habe, als er - der Vater - in der Strafkompanie gewesen sei, als auch dann, als er zu anderen Blocks gehört habe. Später hat der Zeuge jedoch erklärt, dass er nicht in der Lage sei, anzugeben, auf welchem Lagerabschnitt sein Vater gewesen sei. Er wisse nur, dass sein Vater in Birkenau gewesen sei. Es ist daher möglich, dass der Zeuge irrig annimmt, dass sein Vater einmal in der Strafkompanie gewesen ist. Möglicherweise war der Verstorbene nie in der Strafkompanie, sondern hat den Angeklagten Bednarek nur in dem Block 11 besucht. Selbst wenn der später Verstorbene einmal in der Strafkompanie gewesen sein sollte, steht nicht fest, wie lange er sich dort aufgehalten hat. Möglicherweise war er dort nur kurze Zeit. Es ist daher denkbar, dass er von den Tötungshandlungen des Angeklagten Bednarek überhaupt nichts erfahren hat. Wenn er den beiden Zeugen gegenüber nur Gutes über den Angeklagten Bednarek berichtet hat, so mag das seiner inneren Überzeugung entsprochen haben, ohne dass aber nachgeprüft werden kann, worauf der Verstorbene seine gute Meinung über den Angeklagten Bednarek gestützt hat.
Aus den Aussagen der beiden Zeugen Za. und Jas. jun. kann daher gegen die Glaubwürdigkeit der Zeugen Dr. Kl. und Be., aber auch gegen die Glaubwürdigkeit der Zeugen, die von Tötungshandlungen des Angeklagten Bednarek im Block 11 berichtet haben, auf die noch zurückzukommen sein wird, nichts hergeleitet werden.
Schliesslich ist noch der Zeuge Tar. als Entlastungszeuge des Angeklagten Bednarek vernommen worden. Dieser Zeuge hat bekundet, dass er ebenfalls nichts davon gehört habe, dass der Angeklagte Bednarek jemanden getötet habe oder dass Häftlinge infolge von Schlägen, die der Angeklagte Bednarek oder ein anderer auf seine Anweisung hin gegeben habe, gestorben sei. Der Zeuge war aber ebenfalls nicht mit dem Angeklagten Bednarek auf Block 8 oder 8A zusammen. Auch in der Strafkompanie in Birkenau war er nicht. Er kam nach seiner Aussage nur gelegentlich auf den Block 8, um Kameraden zu besuchen. Wenn er nichts von Tötungshandlungen des Angeklagten Bednarek gesehen oder gehört habe, beweist das nicht, dass die Aussagen der Zeugen Dr. Kl. und Be. nicht der Wahrheit entsprechen. Im übrigen hat der Zeuge Tar. nur Ungünstiges über den Angeklagten Bednarek berichtet. So hat er bekundet, dass ihn der Angeklagte Bednarek mit Geschrei aus dem Block "hinausgeschmissen" habe, als er einen Kameraden habe besuchen wollen. Erst später habe Bednarek seine Besuche toleriert, als er von anderen Häftlingen über ihn, den Zeugen, aufgeklärt worden sei. Von Kameraden habe er gehört, dass der Angeklagte Bednarek ein "schlechter Mensch" sei und dass er den Häftlingen durch die Stubendienste wegen Verschmutzung des Blocks und wegen mangelhafter Ordnung Prügelstrafen verabreichen lasse. Er - der Zeuge - habe selbst vier- bis fünfmal dem Vollzug dieser Prügelstrafen zugesehen.
Zusammenfassend muss daher festgestellt werden, dass die Aussagen der von dem Angeklagten Bednarek benannten Entlastungszeugen die Glaubwürdigkeit der Zeugen Dr. Kl. und Be. nicht erschüttern konnten und die von diesen Zeugen geschilderten Tötungshandlungen des Angeklagten nicht widerlegen.
2b. Zu II.2a und b.
Die Feststellungen unter II.2a und b. beruhen auf der Aussage des Zeugen Ja. Der Zeuge hat mit eigenen Augen gesehen - wie er glaubhaft berichtet hat -, dass der Angeklagte Bednarek im Block 11 mindestens zwei Häftlinge zusammengeschlagen hat. Der Zeuge hat sich zwar nicht unmittelbar davon überzeugen können, dass die beiden Häftlinge sofort tot waren. Er hat aber beobachtet, dass der Angeklagte Bednarek die Opfer auf den Hof hat bringen und niederlegen lassen. Am nächsten Morgen hat er festgestellt, dass beide tot waren.
Seine Aussage in der Hauptverhandlung weicht allerdings etwas von seiner Bekundung, die er bei seiner Vernehmung im Ermittlungsverfahren gemacht hat, ab. Bei seiner früheren Vernehmung hat er erklärt, er habe mit eigenen Augen gesehen, "dass Bednarek Häftlinge totgeschlagen habe". Die Unterschiede in den beiden Aussagen bedeuten jedoch nur einen scheinbaren Widerspruch. Denn der Zeuge konnte sich am nächsten Morgen selbst davon überzeugen, dass die beiden Häftlinge tot waren. Damit war seine Schlussfolgerung berechtigt, dass der Angeklagte Bednarek die beiden Häftlinge totgeschlagen habe. Diese Schlussfolgerung hat er offensichtlich bei seiner früheren Vernehmung bereits selbst gezogen. Da er selbst gesehen hat, wie der Angeklagte die Häftlinge zusammengeschlagen hat, die am nächsten Morgen tot waren, konnte er - aus seiner Sicht - mit Recht behaupten, dass er Augenzeuge des Totschlags der beiden Häftlinge gewesen war. Die genaue Schilderung des Zeugen in der Hauptverhandlung über das, was er selbst gesehen hat, ist mit der genaueren und exakteren Befragung in der Hauptverhandlung zu erklären. Die Aussage des Zeugen verliert deswegen nicht an Wert. Das Gericht konnte dem Zeugen vollen Glauben schenken trotz dieser beiden feinen Unterschiede zwischen den beiden Aussagen des Zeugen.
Die Tatsache, dass der Angeklagte Bednarek die beiden zusammengeschlagenen Häftlinge auf den Hof hat bringen lassen und dort während der Nacht liegen liess, zeigt, dass der Angeklagte selbst davon überzeugt war, dass die Häftlinge bereits tot seien oder in den nächsten Stunden sterben würden. Aus dieser Tatsache ist ferner zu ersehen, dass er die Häftlinge nicht nur misshandeln, sondern töten wollte. Andernfalls hätte er sie entweder auf ihr Bett im Block 11 legen oder in den HKB bringen lassen. Ob die Häftlinge bereits im Block 11 tot waren, was der Zeuge nicht weiss, und was daher nicht festgestellt werden kann, oder erst während der Nacht auf dem Hof gestorben sind, spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass die Häftlinge infolge der Schläge des Angeklagten Bednarek gestorben sind, was nach den Umständen nicht zweifelhaft sein kann, und dass der Angeklagte diesen Tod auch gewollt hat.
3. Zu II.2c.
Die Feststellungen unter II.2c. beruhen auf den glaubhaften Aussagen der Zeugen Schwarz. und Zi. Beide Zeugen waren Angehörige des sog. Siemens-Kommandos, über das unter II.3. Ausführungen gemacht worden sind. Sie waren beide im Block 11 des Lagerabschnitts B II d untergebracht. Der Zeuge Schwarz. hat nach seiner glaubhaften Bekundung mit eigenen Augen gesehen, wie der Angeklagte Bednarek mit einem dicken Stock, einem Schaufelstiel, bewaffnet, den polnischen Ingenieur durch den Block 11 auf den Hof hinausgetrieben und dort mit dem Schaufelstiel zusammengeschlagen hat. Der Zeuge hat dann die oben zitierte Erklärung des Angeklagten Bednarek gehört und hat mit dem Stubenältesten Sta. und anderen Häftlingen das Opfer zu dem Waschraum getragen, wo er sich davon überzeugt hat, dass der Häftling bereits tot war.
Der Zeuge Zi. musste damals - wie er glaubhaft bekundet hat - den Waschraum reinigen. Er hat gesehen, wie der Angeklagte Bednarek den Häftling auf dem Hof zusammengeschlagen hat. Dann hat er gesehen, wie der Häftling in den Waschraum getragen wurde. Auch er hat sich davon überzeugt, dass der zusammengeschlagene Häftling bereits tot war.
Beide Zeugen haben ihre Aussagen unabhängig voneinander gemacht. Sie haben den Vorfall von verschiedenen Standpunkten aus beobachtet. Ihre Aussagen stimmen darin völlig überein, dass der Angeklagte Bednarek den Polen auf dem Hof zusammengeschlagen hat und dass das Opfer unmittelbar danach tot war. Beide Zeugen haben einen glaubwürdigen Eindruck gemacht. Das Gericht hat keine Bedenken, ihren Aussagen zu folgen. Aus der Tatsache, dass der polnische Ingenieur unmittelbar nach der Misshandlung durch den Angeklagten Bednarek gestorben ist, hat das Gericht die Überzeugung gewonnen, dass der Angeklagte auch in diesem Falle den Häftling nicht nur misshandeln, sondern töten wollte. Hierfür spricht auch, dass der Angeklagte, wie der Stubenälteste Sta. dem Zeugen Schwarz. erklärt hat, eine "alte Rechnung" mit dem polnischen Ingenieur begleichen wollte. Dagegen spricht nicht, dass der Angeklagte Bednarek den misshandelten Häftling in den Waschraum bringen liess. Dies geschah - wie sich aus der zitierten Äusserung des Angeklagten gegenüber dem Stubenältesten ergibt - deswegen weil der Häftling seine Notdurft nicht hatte halten können und sich beschmutzt hatte. Bednarek wollte offensichtlich nur den unangenehmen Geruch, den das Opfer infolge dieser Verschmutzung verbreitete, beseitigen. Es ist jedoch nicht gesagt, dass er den Häftling wieder hätte zur Besinnung bringen wollen.
4. Zu II.2d.
Die Feststellungen unter II.2d. beruhen auf der glaubhaften Aussage des Zeugen Doe. Der Zeuge hat den Vorfall so, wie er oben unter II.2d. dargestellt worden ist, geschildert. Über die Glaubwürdigkeit des Zeugen sind bereits bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Kaduk Ausführungen gemacht worden. Der Zeuge erschien auch in diesem Punkt unbedingt glaubwürdig und zuverlässig. Er hat seine Aussage klar, präzise und widerspruchsfrei gemacht. Obwohl er nur der einzige Zeuge ist, der den Vorfall beobachtet hat, hat das Gericht keine Bedenken gehabt, seiner Aussage zu glauben. In diesem Fall liegt es klar auf der Hand, dass der Angeklagte Bednarek den Häftling töten wollte. Denn die geschilderte Behandlung des Häftlings musste unbedingt zu seinem Tode führen.
5. Zu II.3.
Die Feststellungen über das allgemeine Verhalten des Angeklagten Bednarek gegenüber den Angehörigen der Siemens-Kommandos beruhen auf den glaubhaften Aussagen der Zeugen Schaf., Alt., Pick., Schwarz., Zi., Pres., Wolo. und Steinf., die alle zu diesem Siemens-Kommando gehörten, und schliesslich auf der Aussage des Zeugen Was., der eine Zeitlang in der Strafkompanie war.
Der Angeklagte Bednarek hat bestritten, dass bei ihm im Block überhaupt jemals Angehörige des sog. Siemens-Kommandos untergebracht gewesen seien. Die Zeugen haben aber übereinstimmend bekundet, dass sie von dem Zeugen Bund. für die Errichtung und den Betrieb einer in Bobrik für die Firma Schuckert Werke zu bauenden Fabrik ausgesucht worden seien und zunächst in dem Gebäude, in dem die Strafkompanie - die Zeugen nannten sie Strafkommando - untergebracht gewesen sei, gewohnt hätten. Alle Zeugen haben weiter erklärt, dass sie den Angeklagten Bednarek als Blockältesten gehabt hätten. Es erscheint ausgeschlossen, dass sich die Zeugen alle insoweit geirrt haben könnten. Wenn sie nicht in Block 11 untergebracht gewesen wären und den Angeklagten Bednarek überhaupt nicht gekannt hätten, wäre kein Grund ersichtlich, warum sie den Angeklagten, der ebenso wie sie Häftling im KL Auschwitz war, zu Unrecht hätten belasten sollen.
Die Feststellungen unter II.3a und b. beruhen auf den glaubhaften Aussagen der Zeugen Zi. und Schwarz. Beide Zeugen mussten den sog. "Sport" mitmachen. Sie haben dann - wie sie unabhängig voneinander und übereinstimmend glaubhaft bekundet haben - mitangesehen, wie der Angeklagte die beiden jüdischen Häftlinge aufeinandergehetzt und schliesslich zusammengeschlagen hat. Der Zeuge Schwarz. hat erklärt, dass beide "erledigt" gewesen seien. Auf die Frage, ob beide tot gewesen seien, hat er allerdings gemeint, er sei kein Arzt, um sicher den Tod eines Menschen feststellen zu können. Nach seinem Eindruck seien beide nach der Misshandlung des Angeklagten Leichen gewesen. Auch der Zeuge Zi. hat bekundet, dass der Angeklagte beide Häftlinge "fertig" gemacht habe. Beide seien bewusstlos gewesen und nicht wieder zum Leben gekommen. Beide Opfer seien dann in die sog. Totenkammer gekommen, d.h., einen Ort in der Nähe der Waschbaracke, wo die Leichen üblicherweise abgelegt worden seien.
An dieses Detail konnte sich der Zeuge Schwarz. allerdings nicht mehr erinnern. Er meinte, die Opfer seien in den HKB gebracht worden. Das konnte der Zeuge jedoch nicht sehen, da der Hof des Blockes 11, wo sich der Vorfall abgespielt hat, mit einer Mauer umgeben war. Möglich ist, dass der Zeuge später gesehen hat, wie die Opfer von der sog. Totenkammer in Richtung HKB weggebracht worden sind. Dort war ein Leichenkeller, wo die Leichen aus dem ganzen Lagerabschnitt niedergelegt wurden, bis sie in das Krematorium weggeschafft wurden. Wahrscheinlich hat der Zeuge Schwarz. nach der langen Zeit nicht mehr genau in Erinnerung, dass die Opfer zunächst in die Totenkammer gebracht worden sind. Im Vergleich zu dem furchtbaren Geschehen, was er mit ansehen musste, war es damals für den Zeugen von untergeordneter Bedeutung, wohin man zunächst die Opfer gebracht hat. Seine Aussage widerspricht daher nicht der Bekundung des Zeugen Zi.
Beide Zeugen haben nach diesem Vorfall nichts mehr von beiden Opfern gehört.
Das Gericht ist daher überzeugt, dass die von dem Angeklagten Bednarek zusammengeschlagenen Häftlinge unmittelbar nach der Misshandlung gestorben sind. Aus der Tatsache, dass der Angeklagte Bednarek die beiden Häftlinge, nachdem sie bereits blutüberströmt zu Boden gefallen waren, noch weiter geschlagen und getreten hat, bis sie reglos liegen blieben, dass die Zuschauer den Eindruck gewinnen mussten, dass sie tot seien, hat das Gericht weiter die Überzeugung gewonnen, dass der Angeklagte Bednarek die beiden Opfer nicht nur misshandeln sondern töten wollte.
6. Zu II.3c.
Die Feststellungen unter II.3c. beruhen auf den glaubhaften Aussagen der Zeugen Alt. und Pres. Der Zeuge Alt. musste nach seiner glaubhaften Bekundung den Sport selbst mitmachen. Er hat mit eigenen Augen gesehen, wie der Angeklagte Bednarek den erschöpften Häftling misshandelt hat. Er hat den Vorfall im wesentlichen so geschildert, wie er oben unter II.3c. dargestellt worden ist. Der Zeuge Pres. hat die Schilderung des Zeugen noch in Einzelheiten ergänzt.
Ein Irrtum des Zeugen Alt. über ein so schreckliches Erlebnis erscheint ausgeschlossen. Der Zeuge müsste den Vorfall allenfalls erfunden haben. Dafür bestehen jedoch keine Anhaltspunkte. Der Zeuge machte auch nicht den Eindruck, dass er zu phantasievollen Erzählungen neigt. Der Zeuge hat klar und präzise und widerspruchsfrei über seine Eindrücke und Erlebnisse im Block 11 berichtet. Er hat einen glaubwürdigen Eindruck gemacht. Auch ein Irrtum in der Person des Angeklagten Bednarek erscheint nicht möglich. Denn der Zeuge war längere Zeit im Block 11. Der Angeklagte Bednarek war sein Blockältester. Er musste ihn daher täglich sehen und daher genau kennen.
Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Zeugen in diesem Punkt können auch nicht daraus hergeleitet werden, dass er behauptet hat, der Oberingenieur Bund. sei wiederholt zu ihnen - den Häftlingen - in das Lager gekommen, während der Zeuge Bund. erklärt hat, er habe das Schutzhaftlager als Zivilist nicht betreten dürfen. Diese Differenz zwischen den Aussagen der beiden Zeugen ist für die Frage der Zuverlässigkeit des Zeugen Alt. bezüglich des von ihm geschilderten Vorfalls nach Auffassung des Schwurgerichts von untergeordneter Bedeutung. Denn im Vergleich zu dem furchtbaren Geschehen im Block 11, über das der Zeuge Alt. berichtet hat, spielt es - auch aus der Sicht des Zeugen gesehen - kaum eine Rolle, ob der Oberingenieur Bund. in dem Lagerabschnitt d gewesen ist oder nicht. Es ist daher durchaus denkbar, dass sich der Zeuge in diesem nebensächlichen Punkt geirrt hat. Daraus kann jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass sich der Zeuge auch bezüglich des von ihm geschilderten Erlebnisses geirrt haben könnte. Denn hierbei handelt es sich um ein für jeden Zuschauer erschütterndes und tiefgreifendes Erlebnis, das sich erfahrungsgemäss unauslöschlich in das Gedächtnis einprägt.
Im übrigen wird die Aussage des Zeugen Alt. bezüglich des von ihm geschilderten Vorfalls durch den Zeugen Pres. bestätigt. Der Zeuge hat ebenfalls geschildert, dass der Angeklagte Bednarek beim Sportmachen einen Häftling, der zu Boden gefallen sei und nicht mehr habe aufstehen können, mit dem Stiefel in die Herzgegend und auf den Brustkorb getreten habe, bis der Häftling tot gewesen sei.
Auch in diesem Fall hat das Gericht keinen Zweifel, dass der Angeklagte den Häftling töten wollte. Es ergibt sich daraus, dass er den Häftling auf besonders empfindliche Körperstellen (Herzgegend, Brustkorb, Geschlechtsteile) getreten hat und nicht eher mit den Misshandlungen aufgehört hat, bis der Häftling tot war.
7. Zu II.3d.
Die Feststellungen bezüglich des Falles Birnfeld beruhen auf den glaubhaften Bekundungen der Zeugen Alt. und Schwarz. Beide Zeugen haben im gleichen Bett wie Birnfeld geschlafen. Der Zeuge Alt. hat ausgesagt, dass der Angeklagte Bednarek bei dem Häftling Birnfeld bei einer Läusekontrolle Läuse gefunden habe. Der Angeklagte Bednarek habe daraufhin dem Stubendienst befohlen, den Häftling zu schlagen. Dieser habe dann im Beisein Bednareks auf Birnfeld eingeschlagen. Ohne Genehmigung des Angeklagten hätte er nicht schlagen dürfen. In der Nacht haben beide Zeugen den Häftling Birnfeld weinen, jammern und klagen hören. Birnfeld hat vor allem über Schmerzen an der Wirbelsäule geklagt. Daraus ist zu ersehen, dass der Stubendienst den Birnfeld nicht nur auf das Gesäss, sondern auch auf die Wirbelsäule geschlagen hat. Die Zeugen haben dann - wie sie unabhängig voneinander und übereinstimmend glaubhaft bekundet haben - am nächsten Morgen festgestellt, dass der Häftling Birnfeld tot war. Danach kann es keinem Zweifel unterliegen, dass Birnfeld infolge der Schläge durch den Stubendienst gestorben ist.
In diesem Fall konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass der Angeklagte mit direktem Tötungsvorsatz den Häftling Birnfeld hat schlagen lassen, weil der Häftling nicht auf der Stelle getötet worden ist. Aus der Tatsache, dass der Angeklagte den Häftling jedoch nicht nur auf das Gesäss, sondern auch auf die Wirbelsäule hat schlagen lassen, also auf eine Art misshandeln liess, die mit Lebensgefahr für das Opfer verbunden sein konnte, und dass der Angeklagte in vielen anderen Fällen sich nicht gescheut hat, Häftlinge unmittelbar totzuschlagen, hat das Gericht die Überzeugung gewonnen, dass sich der Angeklagte bewusst war und damit gerechnet hat, dass der Häftling infolge der Schläge sterben könnte und dass er das bewusst billigend in Kauf genommen hat.
IV. Rechtliche Würdigung
Die unter Ziffern II.1., II.2. und II.3a und c. aufgeführten Fälle sind rechtlich gleich zu beurteilen. In all diesen Fällen ist der Tatbestand des Mordes erfüllt. Der Angeklagte Bednarek hat in jedem der unter den genannten Ziffern aufgeführten Fälle die Häftlinge vorsätzlich getötet. Denn nach den getroffenen Feststellungen hat er den Tod der Opfer in Tötungsabsicht durch die in jedem einzelnen Fall geschilderte Behandlung (Schlagen, Treten, Erwürgen) unmittelbar herbeigeführt.
Die Tötung der Häftlinge erfolgte in jedem der
genannten Fälle auf grausame Art und Weise. Denn der Angeklagte Bednarek hat seinen Opfern aus einer gefühllosen und unbarmherzigen Gesinnung heraus besondere Schmerzen und Qualen körperlicher und seelischer Art zugefügt. Nur ein gefühlloser, unbarmherziger Mensch konnte die Häftlinge, die schon genug unter dem Hunger, der Arbeitsfron und der jeder Menschenwürde hohnsprechenden Behandlung im KL Auschwitz litten, noch zusätzlich, ohne dass triftige oder menschlich verständliche Gründe vorlagen, auf die in den einzelnen Fällen geschilderte Art und Weise umbringen. Der Angeklagte Bednarek kannte das schwere Los der Häftlinge aus eigener Anschauung. Denn er lebte selbst in der den Häftlingen feindlichen Atmosphäre des KL und hatte ihre menschenunwürdige Behandlung durch die SS und die ihnen ergebenen Kapos und Blockältesten täglich vor Augen. Wenn er, anstatt ihr Los zu erleichtern, wozu er als Blockältester zumindest in gewissem Umfang in der Lage gewesen wäre, sich ganz die Methoden der SS zu eigen gemacht und die Häftlinge in der geschilderten Weise misshandelt, bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen und in den angeführten Fällen sogar getötet hat, so zeugt das davon, dass er weder Mitleid noch Erbarmen kannte, sondern durch die Atmosphäre des KL völlig verroht war. Besonders krass tritt diese Gesinnung des Angeklagten Bednarek in dem vom Zeugen Doe. geschilderten Fall (II.2d.) und den Fällen II.3a und b. zu Tage.
Die Opfer haben vor ihrem Tod durch die Schläge des Angeklagten Bednarek mit dem Stock bzw. die Tritte mit den Stiefeln - das Opfer im Fall II.2d. zusätzlich noch durch das Erwürgen mit dem Stock - erhebliche körperliche Schmerzen erdulden müssen. Es bedarf keiner Frage, dass Schläge mit dem Stock und Tritte mit den Stiefeln, die gegen empfindliche Körperteile geführt werden und zwar so, dass sie den Tod danach zur Folge haben, bei den Opfern erhebliche Schmerzen hervorrufen. Ausserdem mussten die Opfer auch seelische Qualen erleiden. Daran kann kein Zweifel bestehen, wenn man bedenkt, dass sie aus der Art der Behandlung durch den Angeklagten erkennen mussten, dass sie ohne jede menschliche Hilfe und ohne tröstenden Zuspruch in einer feindseligen Atmosphäre unschuldig wie ein Stück Vieh auf eine menschenunwürdige Weise umgebracht werden sollten. Das musste sie ausser mit der normalen Todesangst noch zusätzlich mit Verzweiflung und Bitterkeit erfüllen.
Der Angeklagte Bednarek hat die Häftlinge nach der Überzeugung des Gerichts aus Mordlust getötet.
Die Art und Weise, wie er die ihm unterstellten Häftlinge behandelt, misshandelt und umgebracht hat, zeigt, dass er im KL Auschwitz völlig pervertiert war. Besonders deutlich zeigt sich dieser Sadismus in den unter II.3a und b. geschilderten Fällen, in denen er, ohne dass ihm die beiden jüdischen Häftlinge einen Anlass gegeben hätten, beide aufeinandergehetzt und, als seine Methode nicht den erwarteten Erfolg brachte, auf eine scheussliche Art umgebracht hat. Mit Wut oder Erregung des Angeklagten über Disziplinlosigkeit oder sonstige "Vergehen" von Häftlingen ist seine Handlungsweise keinesfalls zu erklären. In dem Fall, in dem er die beiden Häftlinge aufeinanderhetzte, hatte niemand etwas getan, was die Wut oder Erregung des Angeklagten hätte hervorrufen können. Auch im Falle II.3c. hat das Opfer dem Angeklagten Bednarek keine Veranlassung gegeben, in Erregung oder Wut zu geraten. Es musste für jeden - auch den Angeklagten Bednarek - klar sein, dass der Häftling nur aus Erschöpfung, also ohne eigene Schuld, den geforderten Sport nicht mehr mitmachen konnte. In den übrigen Fällen waren es auch nur nichtige Anlässe, die zu den Tötungshandlungen führten. Die Handlungsweise des Angeklagten Bednarek kann daher nur damit erklärt werden, dass es ihm unnatürliche Freude bereitet hat, Menschenleben zu vernichten. Ein anderes Motiv ist auch nicht in den Fällen ersichtlich, in denen die Häftlinge dem Angeklagten durch Disziplinwidrigkeiten und sonstige Vergehen (möglicherweise in den Fällen II.1a. und II.2a und b., II.1b. (Diebstahl von Brot), im Fall II.2d. (Übertretung des Verbotes den Block 11 zu betreten) einen äusseren Anlass für eine Bestrafung gegeben haben mögen. Hätte es dem Angeklagten Bednarek auch in diesen Fällen nicht unnatürliche Freude bereitet, die Häftlinge umzubringen, hätte er sich nach Auffassung des Gerichts mit einer Bestrafung durch Stockschläge auf das Gesäss begnügt. Im Falle II.1b. hätte ihm die durch das "Gericht" verhängte Strafe von zweimal 25 Stockschlägen genügt. Dass er in diesem Falle über die von dem "Gericht" verhängte - an sich schon sehr harte - Strafe von zweimal 25 Stockschlägen ungehalten war und anschliessend den Häftling eigenhändig getötet hat, beweist, dass es ihm gar nicht auf eine angemessene Bestrafung für ein Vergehen ankam, sondern dass er aus einer unnatürlichen Freude an der Vernichtung von Menschenleben den Tod des Häftlings von vornherein wollte.
Dass die Tötung der Häftlinge rechtswidrig war, bedarf keiner näheren Begründung. Der Angeklagte Bednarek war - auch nach den Richtlinien der SS-Führung - nicht befugt, die Häftlinge eigenmächtig zu töten. Wenn seine Handlungsweise von den im KL Auschwitz beschäftigten SS-Angehörigen stillschweigend geduldet wurde, kann das seine Handlungsweise nicht rechtfertigen. Denn ihnen stand - auch nach der Auffassung der SS-Führung - nicht das Recht zu, über Leben und Tod eines Häftlings zu bestimmen. Dem Angeklagten Bednarek war nach der Überzeugung des Gerichts auch bewusst, dass er Unrecht tat. Denn seine eigenmächtigen Tötungshandlungen verstiessen in so krasser Weise gegen das - auch dem primitivsten Menschen bekannte - Recht eines jeden Menschen auf sein Leben, dass er nicht geglaubt haben kann und nach der Überzeugung des Gerichts auch nicht geglaubt hat, er handele nicht unrechtmässig, wenn er die Häftlinge umbringe. Der Angeklagte Bednarek hat selbst auch nie behauptet, dass er der Auffassung gewesen sei, er dürfe Häftlinge, die sich gegen die Disziplin und Lagerordnung vergangen hätten oder sich sonstiger Vergehen schuldig gemacht hätten, einfach töten.
Der Angeklagte Bednarek kannte auch die gesamten Umstände, die die Tötungshandlungen als grausam kennzeichnen. Denn er war es selbst, der die Häftlinge in der geschilderten Art und Weise misshandelte und zu Tode brachte. Nicht erforderlich ist, dass er die Tötungen selbst als grausam empfand und wertete. Wenn er die Häftlinge aus unnatürlicher Freude an der Vernichtung ihres Lebens getötet hat, war er sich nach Überzeugung des Gerichts dessen auch bewusst, ohne dass es darauf ankomme, dass ihm klar geworden ist, dass sein Motiv als "Mordlust" zu bewerten ist.
Damit ist der Tatbestand des Mordes in jedem der oben angeführten Fälle auch in subjektiver Hinsicht erfüllt. Für irgendwelche Schuldausschliessungsgründe liegen keine Anhaltspunkte vor. In keinem der angeführten Fälle ist dem Angeklagten Bednarek befohlen worden, die Häftlinge zu töten. Er hat eigenmächtig und selbständig gehandelt.
Der unter II.3d. geschilderte Fall muss rechtlich zwar etwas anderes als die anderen Fälle beurteilt werden. Er erfüllt aber ebenfalls den Tatbestand des Mordes.
Der Angeklagte Bednarek hat den Häftling Birnfeld zwar nicht eigenhändig und unmittelbar getötet, er hat aber seinen Tod dadurch verursacht, dass er ihm durch den Stubendienst Schläge mit dem Stock verabreichen liess, die den Tod des Häftlings zur Folge hatten. Er hat den Tod des Häftlings Birnfeld auch vorsätzlich verursacht. Zwar konnte nicht festgestellt werden, dass er den Tod unmittelbar beabsichtigt, also mit direktem Tötungsvorsatz dem Stubendienst den Befehl zum Schlagen des Häftlings gegeben hat. Nach den getroffenen Feststellungen hat er jedoch den Tod des Häftlings, mit dem er gerechnet hat, billigend in Kauf genommen, somit mit bedingtem Vorsatz gehandelt. Das genügt.
Der Tod des Häftlings ist auf grausame Art und Weise herbeigeführt worden. Die Schläge auf den Rücken und die durch die Schläge hervorgerufenen Verletzungen des Häftlings an der Wirbelsäule, die Birnfeld ohne Zweifel erlitten haben muss, haben ihm für längere Zeit schwere körperliche Schmerzen bereitet. Das ist daraus ersichtlich, dass der Häftling während der Nacht geweint und gejammert und über Schmerzen an der Wirbelsäule geklagt hat. Der Angeklagte Bednarek hat den Häftling einfach seinen Schmerzen überlassen. Die Tatsache, dass er den Häftling auf rohe Art und Weise misshandeln liess und ihn nach der Misshandlung einfach seinem Schicksal überlassen hat, ohne ihn in ärztliche Behandlung zu geben, zeigt seine gefühllose und unbarmherzige Gesinnung dem misshandelten und sterbenden Häftling gegenüber. Erbarmungslosigkeit und Roheit liegen bereits auch darin, dass er den Häftling allein deswegen auf schwere Art und Weise schlagen liess, weil bei ihm Läuse gefunden worden waren. Denn wegen der im KL Birkenau herrschenden allgemeinen Verhältnisse konnte er dem Häftling daraus keinen Vorwurf machen. Der Häftling hatte die Lagerverhältnisse, die das Gedeihen des Ungeziefers begünstigten, nicht zu vertreten. Das musste auch dem Angeklagten Bednarek, der selbst Häftling war, klar sein. Der Angeklagte Bednarek hat auch die gesamten Umstände, die das Tatbestandsmerkmal der Grausamkeit erfüllten, gekannt. Denn er war selbst dabei, wie der Häftling misshandelt wurde und rechnete damit, dass der Häftling infolge der Misshandlungen in nächster Zeit sterben könnte. Gleichwohl überliess er ihn seinem Schicksal. Ob er selbst seine Handlungsweise als grausam bewertete, spielt keine Rolle.
Damit sind die Tatbestandsmerkmale des Mordes auch in diesem Fall in objektiver und subjektiver Hinsicht erfüllt.
Der Angeklagte Bednarek war daher wegen Mordes in 14 Fällen (§§211, 74 StGB) zu 14mal lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen. Dass jeder einzelne Fall als selbständige Handlung im Sinne des §74 StGB anzusehen ist, bedarf keiner näheren Begründung.
4. Abschnitt: Die Schuldvorwürfe gegen die freigesprochenen Angeklagten Sch., B. und Dr. Sc.
1. Die Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Sch.
Dem Angeklagten Sch. wird zur Last gelegt in der Zeit von 1943 bis Ende 1944
a. in einer unbestimmten Zahl von Fällen gemeinschaftlich mit dem SS-Unterscharführer Werner Kristan Erschiessungen von Häftlingen im sog. alten Krematorium durchgeführt zu haben,
b. im Sommer 1944 mindestens einmal während der Nacht an der Rampe von Birkenau bei der Selektion ankommender Häftlingstransporte mitgewirkt zu haben, wobei zahlreiche Personen zur Vergasung ausgesondert und getötet worden sein sollen,
c. mindestens einmal bei einer Vergasungsaktion im Krematorium II tätig mitgewirkt zu haben, wobei er an Hand einer Liste die Vergasung der Häftlinge überwacht haben soll.
Das Schwurgericht hat hierzu auf Grund der Einlassung des Angeklagten Sch., soweit ihr gefolgt werden konnte und der Aussagen der Zeuginnen Scha. und Kag. folgendes festgestellt:
Der Angeklagte Sch. wurde am 17.12.1922 als uneheliches Kind einer Bauerntochter in ... geboren. Sein Vater, der damals als Müllergehilfe in ... gearbeitet hatte, verliess ... nach zwei bis drei Jahren und kümmerte sich in der Folgezeit nicht mehr um sein Kind. Der Angeklagte wuchs bei seiner Mutter auf, die auf dem Bauernhof ihrer Eltern lebte und arbeitete. Sie blieb unverheiratet. Nach dem Tod ihrer Eltern übernahm sie deren Bauernhof. Sie bewirtschaftet ihn auch heute noch.
Der Angeklagte besuchte in ... sieben Jahre lang die Volksschule von 1929 bis 1936. Nach der Schulentlassung arbeitete er in der mütterlichen Landwirtschaft. Daneben besuchte er drei Jahre lang die Fortbildungsschule. Mit 15 Jahren begann er als Waldarbeiter bei dem Baron von Au. zu arbeiten. Diese Tätigkeit übte er bis zum Februar 1941 aus. Der Angeklagte war Mitglied der HJ bis zum 18. Lebensjahr. Er glaubt, dass er anschliessend automatisch in die NSDAP übernommen worden sei.
Im Februar 1941 wurde der Angeklagte zur Waffen-SS eingezogen und zwar zu einer in Dresden stationierten Pioniereinheit. Er gibt an, er habe bei der HJ eine vormilitärische Ausbildung erhalten und sei eines Tages mit anderen HJ-Angehörigen durch einen SS-Offizier und SS-Arzt für die Waffen-SS ausgesucht worden. Bei der Pioniereinheit in Dresden erhielt er eine achtwöchige Ausbildung und wurde dann mit seiner Einheit nach Norwegen verlegt. Dort blieb er bis zum Kriegsausbruch mit der Sowjetunion (22.Juni 1941). Er kam dann mit seiner Einheit in Lappland zum Fronteinsatz und wurde zweimal verwundet. Wegen der ersten Verwundung (am Knie) wurde er lediglich im Frontlazarett behandelt. Im März 1942 erhielt er einen schweren Bauchschuss, der eine Verlegung in ein Heimatlazarett notwendig machte. Der Angeklagte kam zunächst nach Kiel und dann nach Dresden, wo er nach seiner Wiederherstellung einer Genesungskompanie zugeteilt wurde. Im November 1942 kam er mit einer SS-Totenkopfeinheit, der er als Pionier zugeteilt worden war, erneut zum Fronteinsatz und wurde nach fünf Wochen schwer verwundet. Er erhielt einen Beckenschuss mit Rückgratverletzung und einen Schuss in die linke Brustseite mit Absplitterungen in die Lunge, wodurch er frontdienstunfähig wurde. Nach längerem Aufenthalt in mehreren Lazaretten wurde er im Februar 1943 wieder einer Genesungseinheit in Dresden zugeteilt. Dort blieb er einige Wochen. Dann wurde er mit zwei weiteren SS-Angehörigen zum KL Auschwitz versetzt und der ersten Kompanie des Wachsturmbannes zugeteilt. Da seine Verwundung noch nicht restlos ausgeheilt war, wurde er nach acht Tagen von dem zuständigen Truppenarzt in das Lazarett Kattowitz eingewiesen, wo er acht Wochen blieb. Anschliessend kehrte er wieder nach Auschwitz zurück. In der Folgezeit wurde er ca. drei Wochen lang der Poststelle der ersten Kompanie und anschliessend - im Sommer 1943 - dem Standesamt, das zu der Politischen Abteilung im KL Auschwitz gehörte, zugeteilt. Im Frühjahr 1944 wurde er zum SS-Unterscharführer befördert. Die Aufgabe des Angeklagten Sch. im Standesamt war es, die Todesurkunden verstorbener Häftlinge, die von Häftlingsschreiberinnen ausgeschrieben wurden, anhand der Personalakten der Verstorbenen auf ihre Richtigkeit zu überprüfen und dem SS-Unterscharführer Kristan, der als Standesbeamter fungierte, zur Unterschrift vorzulegen. Der Angeklagte hatte ferner die Häftlingsschreiberinnen, die im Standesamt eingesetzt waren, ein- bis zweimal in der Woche von ihrer Unterkunft abzuholen und zu ihren Schreibbüros zu begleiten.
Bezüglich der einzelnen Schuldvorwürfe konnte nur folgendes festgestellt werden:
Zu a.
Der Angeklagte Sch. hat gelegentlich an Erschiessungen von Zivilisten im kleinen Krematorium teilgenommen. Der Angeklagte Sch. bestreitet allerdings, jemals an Erschiessungen mitgewirkt zu haben. Er hat sich dahin eingelassen, dass er das kleine Krematorium nie betreten habe. Die Zeugin Scha., die im Standesamt die Krematoriumsbücher führte und den Angeklagten Sch. gut kannte, hat glaubhaft bekundet, dass sie wiederholt gesehen habe, dass man kleine Trupps von Leuten, die von der Gestapo eingeliefert worden seien, in das kleine Krematorium geführt habe. Der Angeklagte Sch. sei dann mit umgehängtem Gewehr in Richtung des kleinen Krematorium gegangen. Später sei er zurückgekommen mit glitzernden, blutunterlaufenen Augen. Auch der SS-Unterscharführer Kristan sei nach der Einlieferung der Menschen in das kleine Krematorium gegangen.
Die Zeugin hat zwar selbst nicht gesehen, dass der Angeklagte Sch. an Erschiessungen teilgenommen hat. Sie hat auch nichts davon gehört, Aus den von ihr geschilderten Umständen ergibt sich jedoch, dass der Angeklagte Sch. bei den Erschiessungen von Zivilisten dabeigewesen sein muss. Wenn die Zivilisten in das kleine Krematorium geführt worden sind, so kann kein Zweifel bestehen, dass sie dort getötet wurden. Denn ein anderer Grund, warum sie in das kleine Krematorium hätten geführt werden sollen, ist nicht ersichtlich. Das kleine Krematorium ist auch - ebenso wie die Schwarze Wand - in vielen Fällen als Hinrichtungsstätte benutzt worden. In diesem Zusammenhang kann auf die Feststellungen bezüglich des Angeklagten St. verwiesen werden. Da es sich nur um kleine Gruppen von Menschen gehandelt hat, kann auch nicht angenommen werden, dass sie vergast worden sind. Denn kleine Gruppen von Menschen hat man wegen des für eine Vergasung erforderlichen Aufwandes nicht vergast. Im Jahre 1943 wurden die Vergasungen auch bereits in den neu erbauten Krematorien durchgeführt. Hätte man die Menschen vergasen wollen, hätte man sie ohne Zweifel dorthin gebracht.
Die Tatsache, dass der Angeklagte Sch. nach der Einlieferung der Zivilisten in das kleine Krematorium mit umgehängtem Gewehr gegangen ist, spricht auch eindeutig dafür, dass die Menschen dort erschossen worden sind. Da kein Augenzeuge den Erschiessungen beigewohnt hat, kann jedoch nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass der Angeklagte Sch. eigenhändig die Menschen erschossen hat. Es kann aber angenommen werden, dass er in irgend einer Weise die Erschiessungen gefördert hat, zumindest dadurch, dass er das für die Exekution erforderliche Gewehr zu der Exekutionsstätte hingebracht hat.
Gleichwohl konnte dem Angeklagten Sch. eine strafbare Mitwirkung an Mordtaten nicht nachgewiesen werden. Denn es konnte nicht geklärt werden, warum die eingelieferten Menschen erschossen worden sind. Es ist immerhin möglich, auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, dass gegen die Menschen, die unter der Mitwirkung des Angeklagten Sch. erschossen worden sind, Todesurteile irgend eines Sonder- oder Polizeistandgerichts ergangen waren. Die Erschiessungen können die Vollstreckung dieser Todesurteile gewesen sein. Dagegen spricht nicht unbedingt die Art der Vollstreckung. Denn im KL Auschwitz wurden Todesurteile nur in der ersten Zeit durch ein Exekutionskommando vollstreckt. Zivilisten, die durch ein Gericht verurteilt worden waren, hat man im KL Auschwitz später durch Genickschüsse getötet. Da weder die Gerichte bekannt sind, die diese zu Gunsten des Angeklagten Sch. zu unterstellenden Todesurteile verhängt haben, noch die Urteile selbst, konnte nicht geklärt werden, ob die Urteile rechtmässig waren oder ob sie gegen rechtsstaatliche Grundsätze verstiessen und nur auf Grund eines Scheinverfahrens - etwa wie die Standgerichtsurteile im KL Auschwitz - verhängt worden waren. Es konnte daher nicht festgestellt werden, ob die Erschiessungen rechtswidrig waren, wenn hierfür auch vieles sprechen mag.
Aber auch wenn man unterstellt, dass die Erschiessungen rechtswidrig waren, kann die Mitwirkung des Angeklagten Sch. an diesen Erschiessungen nicht zu seiner Verurteilung führen. Zu seinen Gunsten muss unterstellt werden, dass er zu dieser Mitwirkung befohlen worden ist. Da er Angehöriger der Waffen-SS war, wäre er für seine Beteiligung an den Erschiessungen strafrechtlich nur verantwortlich, wenn er erkannt hätte, dass die Erschiessungen allgemeine Verbrechen waren. Das kann ihm jedoch nicht nachgewiesen werden. Da der Angeklagte überhaupt bestreitet, an den Erschiessungen teilgenommen zu haben, war nicht zu klären, was ihm von seinen Vorgesetzten über den Grund der Erschiessungen mitgeteilt worden ist. Die Möglichkeit, dass ihm gesagt worden ist, die Zivilisten seien zum Tode verurteilt und sie müssten deswegen erschossen werden, kann nicht ausgeschlossen werden. Für den Angeklagten Sch. bestand keine Möglichkeit zu überprüfen, ob dies der Wahrheit entsprach oder ob ein ergangenes Todesurteil rechtmässig war oder nicht. Die Tatsache, dass er geleugnet hat, überhaupt an Erschiessungen teilgenommen zu haben, lässt auch nicht den zwingenden Schluss zu, dass er sich damals über den verbrecherischen Charakter der Tötung im klaren gewesen sei. Denn der wenig intelligente, ungebildete und etwas primitiv wirkende Angeklagte konnte nicht übersehen, wie weit ein Freispruch noch erwartet werden konnte, wenn er seine Mitwirkung an den Tötungshandlungen zugab. Es kann daher möglich sein, dass er aus Angst vor Bestrafung geleugnet hat, ohne dass ihm damals im KL Auschwitz der verbrecherische Charakter der Erschiessungen klar gewesen ist, sofern die Tötungen der Zivilisten überhaupt rechtswidrig waren.
Der Angeklagte Sch. musste daher in diesem Anklagepunkt mangels Beweises freigesprochen werden.
Zu b.
Dem Angeklagten Sch. konnte nicht nachgewiesen werden, dass er jemals an einer Selektion auf der Rampe mitgewirkt und die Vernichtungsaktionen von sog. "RSHA-Juden" in irgend einer Weise gefördert hat.
Der Angeklagte Sch. bestreitet, jemals auf der Rampe gewesen zu sein und selektiert zu haben.
Kein Zeuge hat den Angeklagte Sch. auf der Rampe gesehen. Es hat auch niemand bekundet, dass der Angeklagte Sch. zum Rampedienst eingeteilt worden sei. Es ist durchaus möglich, dass er vom Rampendienst wegen seiner schweren Verwundung befreit worden ist. Nur die Zeugin Kag. hat gemeint, dass der Angeklagte Sch. auch Rampendienst gemacht haben müsse. Sie hat ihre Auffassung jedoch nicht überzeugend begründen können. Sie hat eingeräumt, dass sie den Angeklagten Sch. nie auf der Rampe gesehen habe. Sie hat allein aus der Tatsache, dass die Angehörigen der Politischen Abteilung für den Rampendienst eingeteilt worden sind, den Schluss gezogen, dass dann auch der Angeklagte Sch. als Angehöriger der Politischen Abteilung zum Rampendienst eingeteilt worden sein müsse. Sie hat - wie sie zugegeben hat - die Dienstpläne, auf denen die Angehörigen der SS aufgeführt waren, selbst nicht gesehen, konnte daher auch nicht feststellen, ob der Angeklagte Sch. eingeteilt war. Ihre Schlussfolgerung ist nicht zwingend. Denn der Angeklagte Sch. kann wegen seiner schweren Verwundungen vom Rampendienst befreit worden sein.
Die Zeugin hat aus einigen Umständen den Schluss gezogen, dass der Angeklagte Sch. mindestens einmal Rampendienst gemacht haben müsse. Sie hat geschildert, dass der Angeklagte Sch. eines Morgens mit gerötetem Gesicht und blutunterlaufenen Augen in verschmutzter Kleidung und mit umgehängtem Gewehr zum Standesamt gekommen sei. Er habe sich "wie ein Sack" in einen Stuhl gesetzt. In ihrer früheren Vernehmung im Ermittlungsverfahren hat die Zeugin ausserdem noch angegeben, dass der Angeklagte Sch. bei dieser Gelegenheit betrunken gewesen sei.
Aus diesen Umständen schloss die Zeugin, dass der Angeklagte von einer Selektion gekommen sein müsse. Sie erklärte, man habe "gespürt", dass er von einer Selektion gekommen sei. Sie nehme an, dass der Angeklagte in der vorhergehenden Nacht nicht bei einer Erschiessung, sondern eher bei einer Selektion gewesen sei.
Die Schlussfolgerung der Zeugin ist jedoch nicht überzeugend. Die von ihr geschilderten Umstände sind noch keine eindeutigen Beweisanzeichen dafür, dass der Angeklagte Sch. in der vorhergehenden Nacht tatsächlich an einer Vernichtungsaktion eines RSHA-Transportes teilgenommen hat. Zunächst spricht die Tatsache, dass der Angeklagte ein Gewehr trug, eher gegen als für einen vorangegangenen Rampendienst. Denn die Angehörigen der Politischen Abteilung trugen beim Rampendienst in der Regel kein Gewehr. Mit Gewehren waren die SS-Wachtposten bewaffnet, die einen Ring um die angekommenen jüdischen Menschen bildeten. Auch die verschmutzte Kleidung des Angeklagten lässt sich nicht durch einen Rampendienst erklären. Die Röte im Gesicht und die "blutunterlaufenen" Augen können auch die Folge einer durchzechten Nacht gewesen sein. Die verschmutzte Kleidung fände darin eher eine Erklärung. Die Zeugin hat in ihrer früheren Vernehmung auch davon gesprochen, dass der Angeklagte betrunken gewesen sei. Hierfür spricht auch, dass er sich "wie ein Sack" in den Stuhl fallen liess.
Schliesslich kann der Angeklagte Sch. auch von einer Erschiessung gekommen sein. Es ist immerhin möglich, dass er vor Antritt seines Dienstes im Standesamt an der Erschiessung von Zivilisten hat teilnehmen müssen, was jedoch - wie oben bereits ausgeführt - nicht zu einer Verurteilung führen kann.
Auf Grund der Aussage der Zeugin Kag. konnte daher nicht festgestellt werden, dass der Angeklagte Sch. an Selektionen auf der Rampe teilgenommen und an der Vergasung von jüdischen Menschen in irgend einer Weise mitgewirkt hat. Er war daher auch in diesem Punkt mangels Beweises freizusprechen.
Zu c.
Der Vorwurf, der Angeklagte habe einmal bei einer Vergasungsaktion beim Krematorium II mitgewirkt, indem er anhand einer Liste die Vergasung überwacht habe, hat in der Beweisaufnahme ebenfalls keine Bestätigung gefunden. Der Angeklagte bestreitet es. Der Schuldvorwurf beruht allein auf der Aussage des im Ermittlungsverfahren vernommenen Zeugen Ce. Auf diesen Zeugen ist jedoch in der Hauptverhandlung allseits verzichtet worden. Andere Zeugen sind nicht vorhanden, die den Schuldvorwurf bestätigt hätten. Es erscheint auch unwahrscheinlich, dass der Angeklagte Sch. anhand einer Liste die Vergasung von Personen überwacht haben soll. Das gehörte nicht zu den Aufgaben des Standesamtes.
Der Angeklagte war daher auch in diesem Punkt mangels Beweises freizusprechen.
2. Der Schuldvorwurf gegen den Angeklagten B.
Dem Angeklagten B. wird zur Last gelegt, im Oktober 1941 als SS-Rottenführer und Desinfektor bei der ersten Vergasung von Menschen im KL Auschwitz, die im Keller des Blockes 11 durchgeführt worden sei, das Zyklon B in die Kellerräume eingeworfen zu haben, so dass etwa 850 sowjetrussische Kriegsgefangene und etwa 220 kranke Häftlinge aus dem HKB des Stammlagers getötet worden seien.
Hierzu hat das Gericht auf Grund der Einlassung des Angeklagten B., soweit ihr gefolgt werden konnte, und der Aussagen der Zeugen Dr. Gl. und Stor., der Niederschrift des Angeklagten Broad im Jahre 1945 (sog. Broad-Bericht) und den Aufzeichnungen des früheren Lagerkommandanten Höss folgendes festgestellt:
Der Angeklagte B. ist am 31.7.1910 als ältester Sohn eines Kellners in Lemberg/Polen geboren. Er hat noch drei Schwestern und einen Bruder. Er besuchte in Lemberg die deutsche Volksschule und anschliessend das deutsche humanistische Gymnasium, an dem er im Jahre 1931 die Reifeprüfung bestand. Danach studierte er an der Universität in Lemberg Rechtswissenschaft. Im Herbst 1936 schloss er sein Studium mit dem "Magister Juris" ab, was etwa dem Referendarexamen entspricht. Während seines Studiums wurde er Mitglied der "Jungdeutschen Partei". Er gehörte dieser Partei zwei Jahre an. Nach Abschluss seines Studiums war er in verschiedenen Firmen als kaufmännischer Angestellter tätig. Er übersetzte vornehmlich deutsche Schriftstücke ins Polnische. Von Juni 1939 an arbeitete er als Rechtsberater im "Wirtschaftsverband technischer Berufe" in Bromberg.
Am 1.9.1939 wurde er von der polnischen Polizei verhaftet. Ein Grund für die Verhaftung wurde ihm nicht angegeben. Er war bis zum 3.9.1939 in Bromberg in Haft. Dann wurden er und die mit ihm inhaftierten Deutschen zu Fuss nach Osten in Marsch gesetzt. Nach einem sechstägigen Fussmarsch kamen sie nach Lowitsch. Dort wurden sie von deutschen Truppen am 9.9.1939 befreit. Am 17.9.1939 kehrte der Angeklagte nach Bromberg zurück. Er trat dem sog. Selbstschutz bei und nahm eine Tätigkeit bei der Industrie- und Handelskammer als Referent für Binnenschiffahrt und Hilfsgewerbe auf.
Am 21.11.1939 wurde der Angeklagte zur Waffen-SS eingezogen. Als Grund für seinen Eintritt in den Selbstschutz und in die SS gibt der Angeklagte an, dass man damals den Deutschen in Bromberg gesagt habe, sie müssten sich zu ihrer eigenen Sicherheit zum Selbstschutz melden. Beim Selbstschutz wiederum habe man ihm klargemacht, dass er sich zu einem militärischen Lehrgang melden müsse. Das habe er auch getan. Daraufhin habe er den Befehl erhalten, sich am 21.11.1939 an einer bestimmten Stelle zu melden. Die Meldestelle sei eine SS-Einheit gewesen. Das habe er vorher nicht gewusst. Der Angeklagte wurde in Warschau, Buchenwald und dann wieder in Warschau militärisch ausgebildet. Im Mai 1940 wurde er in das KL Auschwitz abkommandiert. Er wurde zunächst als Schreiber eingesetzt. Dann kam er im August 1940 auf die Bekleidungskammer als Kammerwart. Im Sommer 1941 nahm er an einem Lehrgang im Umgang mit Zyklon B teil. Mit diesem Gas wurden nämlich die Unterkünfte der SS-Truppe und der Häftlingslager entwest. Die Unterweisung im Umgang mit Zyklon B erfolgte in Auschwitz durch zwei Angestellte der Firma Tesch und Stabenow in Hamburg.
In der Folgezeit war dann der Angeklagte im sog. Entwesungskommando eingesetzt. Weil er - wie er angibt - das Gas nicht vertrug und magenkrank wurde, kam er von dem Entwesungskommando später wieder weg und wurde zu einem Kommando in einer Lederfabrik versetzt, wo er einige Monate tätig war. Anschliessend kam er wieder zur Schreibstube zurück. Schliesslich wurde er - im Frühjahr oder Sommer 1942 - Kammerwart in der Unterkunftskammer, wo er Unterkunftsgeräte der SS und des Häftlingslagers zu verwalten hatte. Der Angeklagte wurde in Auschwitz am 1.10.1940 zum SS-Sturmmann, am 1.7.1941 zum SS-Rottenführer und am 1.2.1943 zum SS-Unterscharführer befördert. Später wurde er in das Lager Monowitz versetzt. Dort war er wieder als Kammerwart in der Unterkunftskammer tätig.
Im Herbst 1941, als der Angeklagte B. in dem sog. Entwesungskommando tätig war, wurde im Keller des Blockes 11 die erste Vergasung von sowjetrussischen Kriegsgefangenen und kranken Häftlingen aus dem HKB durchgeführt. Zuvor hatte man die Arrestzellen geleert und die Fenster und Türen des sog. Arrestbunkers abgedichtet. Dann wurden einige hundert russische Kriegsgefangene und Kranke aus dem HKB, die nicht mehr nützlich erschienen, in die Arrestzellen und den Keller hineingeführt, dort auf engstem Raum zusammengepfercht und eingeschlossen. Dann wurde durch Öffnungen Zyklon B in die abgedichteten Räume hineingeworfen. Die sich entwickelnden Gase töteten die im Bunker eingeschlossenen Menschen. Der Angeklagte B. bestreitet, dass er - wie ihm zur Last gelegt wird - das Zyklon B eingeworfen habe. Er hat sich dahin eingelassen, dass er nie an Vergasungen von Menschen teilgenommen habe. Er wisse überhaupt nicht, ob im Herbst (Oktober) 1941 Menschen im Block 11 vergast worden seien. Erst später habe er davon erfahren, dass in Auschwitz Menschen vergast würden. Das habe sich herumgesprochen.
Wenn auch ein erheblicher Verdacht besteht, dass man damals den Angeklagten B., der als Angehöriger des Entwesungskommandos einen Lehrgang über den Umgang mit Zyklon B absolviert hatte, zu dieser Vergasung herangezogen hat, konnte die Beweisaufnahme nicht den sicheren Beweis erbringen, dass der Angeklagte B. tatsächlich an dieser ersten Vergasung beteiligt war. Ausser dem Zeugen Petz. hat kein Zeuge bekundet, dass er den Angeklagten B. bei dieser ersten Vergasung gesehen habe. Der Zeuge Petz. will den Angeklagten B. dabei beobachtet haben, wie er unter dem Schutz einer Gasmaske an der Luke des Kellergeschosses des Blockes 11 herumhantiert habe.
Der Zeuge Petz. ist jedoch unglaubwürdig. Im einzelnen hat der Zeuge seine Beobachtungen wie folgt geschildert:
Im September oder Oktober 1941 sei eines Morgens der Bunker im Block 11 von Arrestanten geleert worden. Dann seien Häftlinge aus dem HKB, die nur mit Hemd und Unterhose bekleidet gewesen seien, in dem Bunker geführt worden. Abends sei strenge Blocksperre angeordnet worden. Etwa gegen 21 Uhr oder 21.30 Uhr seien ca. 850 russische Kriegsgefangene in den Bunker gebracht worden. Man habe sie auf der Lagerstrasse, die beleuchtet gewesen sei, in das Lager hereingetrieben, dann in den Hof zwischen Block 10 und 11 geführt und von dort durch den Mittelgang in den Block 11 und den Bunker hineingeprügelt. Er habe das von dem Giebelfenster des Blockes 27 aus, in dem die Bekleidungskammer untergebracht war, beobachtet. Zwischen dem Block 27 und dem Hof zwischen Block 10 und 11 sei noch der Block 21 gewesen. Dieser sei damals noch nicht aufgestockt gewesen. Daher habe er von dem Giebelfenster aus gut in den Hof zwischen Block 10 und 11 hineinsehen können. Über der Tür, durch die die Kriegsgefangenen in den Block 11 hineingeprügelt worden seien, habe eine Glühbirne gebrannt. Er habe dann zwei SS-Männer gesehen, die sich mit dem Gas beschäftigt hätten. Der eine der beiden sei der Angeklagte B. gewesen. Er habe ihn bestimmt im Hof gesehen. Er sei der erste Mann gewesen, den die Firma Tesch und Stabenow im Umgang mit Zyklon B ausgebildet habe. Er habe den Angeklagten B. aus einer Entfernung von ca. 60 m gesehen. Er habe ihn klar erkannt und zwar nicht nur an seiner Gestalt und seinen Bewegungen, sondern auch an den Dingen, die er durch den täglichen Umgang mit dem Angeklagten B. gekannt habe. B. sei schon mit der Gasmaske in das Lager gekommen. Er - der Zeuge - habe allerdings nicht gesehen, wie er die Gasmaske aufgesetzt habe. Er wisse nur, dass er - der Angeklagte - sich an der Einwurfluke beschäftigt habe. Die beiden SS-Männer seien zu dem Keller hingegangen und er - der Zeuge - habe gesehen, wie der Angeklagte B. dort herumhantiert habe. Ob er auch Gas eingeworfen habe, das könne er nicht sagen. Jedenfalls habe der Angeklagte eine Gasmaske aufgehabt. Unter dem Schutz der Gasmaske habe er ebenso wie der andere SS-Mann an der Luke herumhantiert.
Die Behauptung des Zeugen, er habe die Vorgänge auf dem Hof zwischen Block 10 und 11 von dem Giebelfenster des Blockes 27 aus beobachtet, kann nicht der Wahrheit entsprechen. Denn vom Block 27 aus war der Hof zwischen Block 10 und 11 überhaupt nicht einzusehen. Die durch den beauftragten Richter durchgeführte Ortsbesichtigung auf dem früheren Lagergelände des KL Auschwitz hat ergeben, dass von keinem der im Block 27 vorhandenen Fenster aus wegen der vor dem Hof zwischen Block 10 und 11 befindlichen Mauer der Hof selbst einzusehen ist. Auch die Kellerfenster und die Treppe, die zu dem Mitteleingang des Blockes 11 führt, können vom Block 27 aus nicht gesehen werden. Im günstigsten Fall kann man vom Innern des Blockes 27 aus nur den oberen Rand der Fenster im Erdgeschoss des Blockes 11 erkennen. Die Ortsbesichtigung hat ferner ergeben, dass im Block 27 überhaupt kein Giebelfenster vorhanden ist. Der Zeuge Sm., der selbst als Häftling im Stammlager war, hat bekundet, dass im Block 27 niemals ein Giebelfenster gewesen sei. Er hat ferner ausgesagt, dass sich die Mauer vor dem Hof zwischen Block 10 und 11 seit 1941 nicht verändert habe, sie sei immer gleich hoch geblieben. Die Höhe des Blockes 21 spielt überhaupt keine Rolle. Denn - wie ebenfalls die Ortsbesichtigung ergeben hat - man sieht aus dem Block 27 an dem Block 21 vorbei, wenn man in Richtung Block 11 schaut. Trotzdem ist es nicht möglich, über die Mauer vor dem Hof zwischen dem Block 10 und 11 hinwegzusehen. Der Zeuge Petz. muss daher die Schilderung der angeblichen Vorgänge in dem Hof zwischen Block 10 und 11 erfunden haben. Auf seine Aussage konnten daher keine Feststellungen gestützt werden.
Ausser dem Zeugen Petz. hat noch der Zeuge Mot. den Angeklagten belastet. Dieser Zeuge hat zwar nicht behauptet, selbst den Angeklagten beim Hantieren mit Zyklon B oder sogar beim Einwerfen dieses Giftgases in den Keller des Blockes 11 gesehen zu haben. Er will aber dabei gewesen sein, wie am Tag und nicht nach Eintritt der Dunkelheit die SS-Angehörigen Grabner, Lachmann, Dylewski, St., Stiebitz, Hössler und Palitzsch auf die Bekleidungskammer zu dem Angeklagten B. gekommen seien, nachdem etwa 100 bis 200 sowjetrussische Kriegsgefangene morgens und 150 bis 200 Kranke aus dem HKB in den Block 11 gebracht worden seien. B. habe dann, so hat der Zeuge weiter ausgesagt, zwei bis drei Dosen genommen, habe zwei Dosen noch einem anderen SS-Mann gegeben und habe sich dann mit den genannten SS-Angehörigen zu dem Block 11 begeben. Nach einer Stunde sei B. wieder zurückgekommen. Er sei ärgerlich gewesen, weil irgend etwas nicht geklappt habe. Am nächsten Tag sei dann noch eine zusätzliche Vergasung gewesen, weil die erste Vergasung nicht geklappt habe. Ein bis zwei Tage später hätten dann die Leichenträger auf Rollwagen die Leichen abtransportiert. Schon kurz vor dieser ersten Vergasung im Block 11 habe der Angeklagte B. den ersten Versuch gemacht, schmutzige Wäsche mit Zyklon B zu entwesen. Dieser Versuch hätte in der Bekleidungskammer stattgefunden. Sie - die Häftlinge - hätten die Ritzen der Fenster und Türen zukleben müssen. B. habe dann auf die schmutzige Wäsche unter dem Schutz einer Gasmaske Zyklon B gestreut. Am nächsten Tage habe B. dann die Türen und Fenster wieder geöffnet. Zu seinem Stellvertreter habe er zufrieden gesagt: "Jetzt haben wir endlich das Mittel nicht nur zur Desinfektion der Wäsche, sondern auch zur Vernichtung der Häftlinge."
Auch der Zeuge Mot. ist unglaubwürdig. Abgesehen davon, dass seine Aussage mehrere Unwahrscheinlichkeiten enthält, hat er - wie bereits bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Dylewski ausgeführt worden ist - den Angeklagten St. nachweislich zu Unrecht belastet. Das Gericht hat daher bereits seinen Bekundungen zum Nachteil des Angeklagten Dylewski keinen Glauben geschenkt. Auch hier besteht der Verdacht, dass der Zeuge ebenso wie bezüglich des Angeklagten St. die Dinge, die er geschildert hat, erfunden oder aus Gerüchten und Erzählungen anderer während oder nach der Lagerzeit sich selbst zusammengereimt hat. Das Gericht hat daher auf seine Aussage keine sicheren Feststellungen stützen können.
Schliesslich hat noch der Zeuge Schl., der zunächst im Range eines SS-Sturmmannes und zuletzt nach mehreren Beförderungen als SS-Oberscharführer als Sachbearbeiter für die Bekleidung der SS-Angehörigen und Häftlinge im KL Auschwitz war, bekundet, er habe von der ersten Vergasung in dem Stammlager gehört. Diese müsse in einer Nacht vom Samstag auf Sonntag gewesen sein. Denn sie - die SS-Angehörigen - hätten an einem Sonntag zu einem Fussballspiel irgendwohin fahren wollen. Da habe es geheissen, dass in der Nacht zuvor russische Kriegsgefangene vergast worden seien. Bei diesen Erzählungen sei auch der Name B. gefallen. Andere Namen habe er im Zusammenhang mit dieser ersten Vergasung nicht gehört. Auch diese Aussage reicht zu einer Verurteilung des Angeklagten B. nicht aus. Der Zeuge hat bei seiner früheren Aussage im Ermittlungsverfahren, was ihm in der Hauptverhandlung von dem Verteidiger des Angeklagten B. vorgehalten und von dem Zeugen bestätigt worden ist, den Namen des Angeklagten B. im Zusammenhang mit der ersten Vergasung im KL Auschwitz nicht genannt. Der Zeuge hat als Erklärung hierfür angegeben, dass er auf diesen Namen nach der früheren Vernehmung "gestossen" worden sei. Ihm sei dann wieder die Erinnerung gekommen, dass ihm das damals so erzählt worden sei.
Schon hier setzen Bedenken ein, ob damals vor über 20 Jahren tatsächlich der Name B. gefallen ist, als man über die erste Vergasung im Kreise der SS-Angehörigen gesprochen habe. Möglich ist, dass der Zeuge, nachdem man ihn auf den Namen B. hingewiesen hat, jetzt irrtümlich glaubt, der Name sei damals bereits gefallen. Ferner soll sich - nach der Aussage des Zeugen Schl. - die Erzählung der anderen SS-Angehörigen auf eine Vergasung im kleinen Krematorium bezogen haben. Er - der Zeuge - habe später, wenn er am kleinen Krematorium vorbeigegangen sei, stets gedacht: "Artur (B.) wie konntest Du nur so etwas machen."
Die Aussage des Zeugen liefert daher für die Beteiligung des Angeklagten B. an der ersten Vergasung im Block 11 (die ihm allein zur Last gelegt wird) keinen Beweis. Aus der Aussage kann aber auch nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass der Angeklagte B. sich an einer Vergasung im kleinen Krematorium beteiligt hat. Denn es ist nicht nachzuprüfen, ob das Gerede, das damals unter den SS-Angehörigen und wahrscheinlich auch unter den Häftlingen umging, den Tatsachen entsprochen hat oder nur auf Vermutungen beruhte.
Zwar besteht nach wie vor ein begründeter Verdacht gegen den Angeklagten B., dass er an der ersten Vergasung teilgenommen hat. Denn die Tatsache, dass er als Angehöriger des Entwesungskommandos im Umgang mit Zyklon B ausgebildet war, lässt diese Beteiligung wahrscheinlich erscheinen. Hierfür spricht auch, dass damals unter SS-Angehörigen und Häftlingen darüber gesprochen worden sein muss, dass er an einer Vergasung beteiligt gewesen sei. Gleichwohl konnte ihm dies mit den vorhandenen Beweismitteln nicht mit der zu einer Verurteilung ausreichenden Sicherheit nachgewiesen werden. Er war daher mangels Beweises freizusprechen.
3. Der Schuldvorwurf gegen den Angeklagten Dr. Sc.
Dem Angeklagten Dr. Sc. wird zur Last gelegt, in der Zeit von Frühjahr bis Herbst 1944 als SS-Untersturmführer und SS-Zahnarzt in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen nach der Ankunft von jüdischen Häftlingstransporten auf der Rampe in Birkenau Selektionen durchgeführt, beziehungsweise überwacht zu haben, wobei eine unbestimmte Anzahl von Häftlingen ausgesondert und anschliessend zur Vernichtung in die Gaskammern gebracht worden sein soll. Bei den Gaskammern soll der Angeklagte Dr. Sc. das Einwerfen des Zyklon B überwacht haben.
Hierzu hat das Schwurgericht auf Grund der Einlassung des Angeklagten Dr. Sc., soweit ihr gefolgt werden konnte, folgendes festgestellt:
Der Angeklagte Dr. Sc. ist als Sohn eines Dentisten am 1.2.1905 in Hannover geboren. Er besuchte in Hannover eine Vorschule und anschliessend das Gymnasium bis zum Abitur. Danach studierte er in Göttingen 10 Semester Zahnmedizin. Das Staatsexamen legte er im Jahre 1932 ab. Ende 1932 promovierte er zum Dr. der Zahnmedizin, 1933 trat er in die NSDAP ein. Er gibt an, man habe ihm klar gemacht, dass er keine Zulassung zu den Kassen erhalten könne, wenn er nicht in die Partei eintrete. Das habe er geglaubt. Nur um diese Zulassung zu erhalten, sei er in die Partei eingetreten. Denn ohne Kassenzulassung könne ein Zahnarzt nicht existieren. Der Angeklagte Dr. Sc. liess sich in Hannover als Zahnarzt nieder. Er betrieb die Zahnarztpraxis bis zu seiner Einberufung zur Wehrmacht im Jahre 1940.
Der Angeklagte war auch Mitglied der SA. Nachdem er wegen Beihilfe zur Abtreibung durch Urteil des Schöffengerichts Hannover vom 4.10.1937 - 8 Ms 38/37 - zu einer Geldstrafe von 400.- RM verurteilt worden war, wurde er am 30.11.1939 aus der NSDAP ausgeschlossen.
Die Einberufung zur Wehrmacht im Jahre 1940 erfolgte zu einem Landesschützenbataillon in Hannover. Diese Einheit wurde alsbald nach Dessau verlegt. Dort erhielt sie ihre infanteristische Ausbildung. Danach wurde sie zur Bewachung von Pioniergerät eingesetzt. Dann wurde sie wieder nach Hannover zurückverlegt. Der Angeklagte war bei dem Landesschützenbataillon als Kraftfahrer und Kurier eingesetzt. Er war im Mai 1940 zum Obersoldaten und im Jahre 1941 zum Gefreiten und im Jahre 1942 zum Obergefreiten befördert worden. Ende 1942 wurde der Angeklagte nach Bückeburg zu einer Sanitätseinheit versetzt. Anfang 1943 kam er als Sanitätsobergefreiter zur Heereszahnstation nach Hannover. Hier arbeitete er als Zahnarzt und wurde bald zum Unteroffizier und Feldwebel befördert.
Im Sommer 1943 wurde der Angeklagte zur Waffen-SS abkommandiert. Wie er angibt, hat er bei seinem Chef, weil er angeblich aus innerster Überzeugung nicht zur Waffen-SS gewollt habe, gegen die Versetzung zur SS Gegenvorstellungen erhoben. Das sei jedoch - so gibt der Angeklagte an - erfolglos gewesen. Der Chef habe ihm sogar, als er zum zweiten Mal Einwendungen gegen die Abkommandierung zur SS erhoben habe, erklärt, sein Verhalten könne als Befehlsverweigerung aufgefasst werden.
Der Angeklagte kam zunächst zur SS-Kommandantur - Zahnstation - in Berlin-Oranienburg. Dann nahm er im Herbst 1943 an einem Sanitätskursus in Graz teil. Er trug während des Lehrganges noch Wehrmachtsuniform. Alsbald wurde er zum Unterarzt befördert. In Graz will der Angeklagte Redensarten gegen das Regime geführt haben. Angeblich sei er deswegen auch verwarnt worden. Von Graz kam der Angeklagte wieder nach Oranienburg zurück. Dann wurde er am 30.1.1944 zur Kommandantur des KZ Auschwitz versetzt. Er trug noch immer Wehrmachtsuniform. Er sei auch - so behauptet er - als Wehrmachtsunterarzt nach Auschwitz gekommen. Erst später habe er Uniform und Rangabzeichen gegen Uniform und Rangabzeichen eines SS-Oberscharführers eintauschen müssen. Zum SS-Untersturmführer sei er erst im Spätsommer 1944 befördert worden.
Im KL Auschwitz war der Angeklagte vom 30.1.1944 bis zum Herbst 1944 zweiter Lagerzahnarzt. Er hatte die SS-Wachmannschaften und die deutschen Zivilisten als Zahnarzt zu behandeln. Sein Vorgesetzter war der Angeklagte Dr. Frank.
Nach der bereits mehrfach erwähnten Besprechung beim Standortarzt Dr. Wirths wurde auch der Angeklagte Dr. Sc. wiederholt zum sog. ärztlichen Rampendienst eingeteilt. Er gibt zwar an - ebenso wie der Angeklagte Dr. Frank - er sei nur als "Hilfsselekteur" d.h. als Ersatzmann für den Fall, dass der eingeteilte SS-Arzt aus irgend einem Grund nicht den Rampendienst machen könne, eingeteilt worden. Diese Einlassung ist jedoch unglaubhaft. Es kann insoweit auf die Ausführungen im 3. Abschnitt unter M.III. Bezug genommen werden. Der Angeklagte Dr. Sc. ist, wenn er zum Rampendienst eingeteilt war, nach der Ankunft von RSHA-Transporten auch zur Rampe gefahren. Das gibt er selbst zu. Auch das spricht dagegen, dass er nur als Ersatzmann neben einem SS-Arzt eingeteilt worden ist. Denn wenn er tatsächlich nur Ersatzmann gewesen wäre, so hätte er sich nur dann zur Rampe zu begeben brauchen, wenn der eingeteilte SS-Arzt aus irgendeinem Grund an der Wahrnehmung des Rampendienstes verhindert gewesen wäre. Die Zeugen Lil. und Rad., die glaubhaft bekundet haben, dass der Angeklagte Dr. Sc. ebenfalls auf dem Dienstplan der SS-Ärzte gestanden habe, haben nichts davon gewusst, dass er nur als "Ersatzmann" eingeteilt gewesen sei.
Somit steht fest, dass der Angeklagte Dr. Sc. zum Rampendienst - ebenso wie die anderen SS-Ärzte, wie der Angeklagte Dr. Frank und wie der Apotheker Dr. Capesius - eingeteilt worden ist und dass er sich auf Grund dieser Einteilung nach der Ankündigung von RSHA-Transporten zur Rampe begeben hat. Es besteht auch der erhebliche Verdacht, dass der Angeklagte Dr. Sc., wenn er auf Grund der Diensteinteilung Rampendienst zu verrichten und sich aus diesem Grunde auf die Rampe von Birkenau zu begeben hatte, sich ebenso wie die anderen SS-Ärzte an den Selektionen beteiligt hat, d.h. darüber bestimmt hat, wer von den angekommenen jüdischen Menschen in das Lager aufgenommen werden solle und wer in den Gaskammern zu töten sei.
Der Angeklagte Dr. Sc. hat mit Entschiedenheit in Abrede gestellt, jemals selektiert zu haben. Er hat sich dahin eingelassen, dass es ihm stets gelungen sei, sich von dem Selektionsdienst zu "drücken". Seine Hauptaufgabe habe er darin gesehen, ärztliches Material sicher zu stellen. Währenddessen sei die Selektion von einem SS-Arzt und einem SS-Führer durchgeführt worden. Er habe sich nur auf der Rampe herumgedrückt. Er habe stets versucht, auf dem schnellsten Wege wieder von der Rampe zu verschwinden. Er habe sich meist auch nicht lange auf der Rampe aufgehalten.
Diese Einlassung konnte dem Angeklagten Dr. Sc. nicht mit letzter Sicherheit widerlegt werden. Kein zuverlässiger Zeuge hat den Angeklagten Dr. Sc. beim Selektieren auf der Rampe in Birkenau gesehen. Der Zeuge Ros., der den Angeklagten Dr. Frank - wie oben unter M.III. im einzelnen ausgeführt - beim Selektionsdienst beobachtet hat, hat zwar auch den Angeklagten Dr. Sc. auf der Rampe gesehen, er hat aber ausdrücklich erklärt, dass er nicht gesehen habe, dass der Angeklagte Dr. Sc. selektiert habe. Der Zeuge hätte es eigentlich sehen müssen, wenn sich der Angeklagte Dr. Sc. ebenso wie der Angeklagte Dr. Frank auf der Rampe betätigt hätte. Denn er hat, da er seine Flucht vorbereiten wollte und nach Möglichkeiten für eine Flucht Ausschau hielt, die Vorgänge auf der Rampe genau beobachtet.
Nur der Zeuge Gi. will den Angeklagten Dr. Sc. oft beim Selektieren auf der Rampe gesehen haben. Der Zeuge hat damals den Angeklagten Dr. Sc., wie er zugegeben hat, nicht dem Namen nach gekannt. Er will ihn bei der Gegenüberstellung in der Hauptverhandlung wiedererkannt haben als einen, der auf der Rampe die angekommenen jüdischen Menschen eingeteilt habe. Bei seiner früheren Vernehmung durch einen tschechoslowakischen Richter hat der Zeuge, wie ihm in der Hauptverhandlung vorgehalten worden ist, erklärt: "An der Rampe waren am häufigsten die SS-Leute Mengele, Kaduk und Sc. tätig." Wie der Zeuge bereits bei dieser früheren Vernehmung, als er dem Angeklagten Dr. Sc. überhaupt noch nicht gegenübergestellt worden war, auf den Namen Dr. Sc. gekommen ist, ist unerfindlich. Nach dem Vorhalt hat dann der Zeuge behauptet, er habe den Angeklagten Dr. Sc. und den Angeklagten Kaduk bei einer Selektion im Block 9 im Stammlager gesehen. Beide habe er zwar nicht gekannt. Der Häftlingspfleger Szy. habe ihm aber nach der Selektion auf seine Frage, wer die beiden SS-Männer, die die Selektion durchgeführt hätten, gewesen seien, geantwortet: "Kaduk und Sc." Das ist unglaubhaft. Block 9 gehörte zum HKB. Der Angeklagte Dr. Sc. hatte als SS-Zahnarzt im HKB nichts zu tun. Es ist schon aus diesem Grunde unwahrscheinlich, dass er jemals im HKB Selektionen durchgeführt hat. Die Selektionen im HKB wurden von SS-Lagerärzten, die für das Stammlager zuständig waren (z.B. Dr. Entress) durchgeführt. Es hat auch keiner der Zeugen, die im HKB als Häftlingsärzte oder Häftlingspfleger eingesetzt waren, bekundet, dass der Angeklagte Dr. Sc. jemals im HKB gewesen sei. Auch der Zeuge Szy., der angeblich dem Zeugen Gi. die beiden Namen Kaduk und Sc. genannt haben soll, hat dies nicht bestätigt. Im übrigen soll nach der Aussage des Zeugen Gi. die Selektion im Block 9 im Dezember 1943 oder im Januar 1944 gewesen sein. Der Angeklagte Dr. Sc. kam jedoch erst am 30.1.1944 zum KL Auschwitz. Ferner hat der Zeuge Gi. auf die Frage, ob der SS-Mann, der im Block 9 die Selektion gemacht habe und der ihm als Dr. Sc. bezeichnet worden sei, identisch gewesen ist mit demjenigen, den er auf der Rampe habe selektieren sehen, geantwortet: "Ich glaube es." Der Zeuge war sich somit selbst nicht sicher über die Person, die er auf der Rampe beim Selektieren beobachtet haben will.
Schliesslich hat der Zeuge Gi. bezüglich des Angeklagten Dr. L. Bekundungen gemacht, die mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht den Tatsachen entsprechen. Wie bereits bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Dr. L. ausgeführt worden ist, will der Zeuge Gi. den Angeklagten Dr. L. noch im Herbst 1944 auf der Rampe in Birkenau beim Selektionsdienst gesehen haben. Zu dieser Zeit war der Angeklagte Dr. L. nach der Aussage des Zeugen Dr. Szy. jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit bereits im KL Mauthausen. Aus all diesen Gründen erschien die Aussage des Zeugen Gi. nicht zuverlässig genug, um darauf sichere Feststellungen zum Nachteil des Angeklagten Dr. Sc. stützen zu können.
Da sonst keine Zeugen bekundet haben, den Angeklagten Dr. Sc. beim Selektionsdienst beobachtet zu haben, und auch kein Mitangeklagter den Angeklagten Dr. Sc. in dieser Hinsicht belastet hat, bleibt nur die Frage, ob allein aus der Tatsache, dass sich der Angeklagte Dr. Sc. nach der Ankündigung von RSHA-Transporten, wenn er zum Rampendienst eingeteilt war, auch zur Rampe hinbegeben hat, der sichere Schluss gezogen werden kann, dass er auch die angekommenen jüdischen Menschen selektiert hat. Das Gericht konnte, obwohl dieser Schluss sehr nahe liegt, nicht die erforderliche sichere Überzeugung gewinnen, dass dieser Schluss unbedingt richtig ist.
Der Angeklagte Dr. Sc. war weder ein überzeugter Nationalsozialist noch ein soldatischer Typ. Er hat sich - unwiderlegt - nicht freiwillig zur Waffen-SS gemeldet, sondern ist zum Dienst im KL Auschwitz befohlen worden, nachdem er bis zum Jahre 1944 Dienst in der Wehrmacht verrichtet hatte. Nach dem Eindruck, den das Gericht in der Hauptverhandlung von ihm gewonnen hat, verkörperte er in der SS nicht den Typ eines befehlsgewohnten energischen Vorgesetzten, der auf seine SS-Kameraden in irgend einer Weise hätte Eindruck machen können. Seine Tätigkeit im KL Auschwitz erschöpfte sich - abgesehen davon, dass er zum Rampendienst eingeteilt worden ist - ausschliesslich in der zahnärztlichen Behandlung des SS-Personals, das zum KL Auschwitz gehörte. Es erscheint durchaus möglich, dass man ihn im Kreise der SS-Führer und SS-Ärzte nicht für "voll" nahm. Da nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte, dass er nur allein zum Rampendienst eingeteilt worden ist, sondern die Möglichkeit offen bleiben muss, dass neben ihm noch ein anderer SS-Arzt oder der Angeklagte Dr. Frank zum Rampendienst eingeteilt worden war, besteht immerhin die - wenn auch geringe - Möglichkeit, dass der andere SS-Arzt oder der Angeklagte Dr. Frank für ihn den Selektionsdienst mitübernommen hat. Der Zeuge Ros. hat bekundet, dass er einmal den Dr. Sc. auf der Rampe gesehen habe, als auch der Dr. Frank dort gewesen sei. Beide müssen daher gleichzeitig Selektionsdienst gehabt haben. Selektiert hat nach der Beobachtung des Zeugen Ros. jedoch nur der Angeklagte Dr. Frank. Auch sonst hat der Zeuge Ros. manchmal zwei Ärzte und manchmal nur einen Arzt und den Lagerführer auf der Rampe gesehen. Das beweist, dass nicht immer nur ein einziger ärztlicher "Selekteur" Rampendienst versehen hat. Möglich ist auch, dass sich ein Schutzhaftlagerführer oder der Arbeitseinsatzführer bereit gefunden hat, für den Angeklagten Dr. Sc., weil sie ihn möglicherweise nicht für "voll" nahmen, zu selektieren, wenn er sich unter dem Vorwand, zahnärztliches Material sicher stellen zu müssen, vom Selektionsdienst "gedrückt" hat. Es kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass man ihn im Hinblick auf seine Persönlichkeit stillschweigend seine Wege gehen liess.
Zu prüfen war ferner noch, ob der Angeklagte Dr. Sc. mit RSHA-Transporten zu den Gaskammern gegangen ist und dort als Arzt das Einschütten des Zyklon B bzw. den gesamten Vergasungsvorgang überwacht hat. Auch das konnte ihm nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden.
Der Angeklagte selbst bestreitet entschieden, jemals mit zu den Gaskammern gegangen oder RSHA-Transporte zu den Gaskammern begleitet zu haben. Die Gaskammern habe er - so hat er sich eingelassen - nie gesehen. In seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter hat der Angeklagte Dr. Sc. allerdings eine etwas andere Darstellung gegeben. Wie sich aus dem Protokoll vom 2.11.1961 über seine richterliche Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter, das gemäss §254 StPO verlesen worden ist, ergibt, hat der Angeklagte damals erklärt, er habe Häftlinge, die für die Gaskammer ausgesucht gewesen seien, auf dem Weg in das Krematorium über eine gewisse Strecke hin begleitet. Als ihm dies nach der Verlesung des Protokolls vorgehalten worden ist, hat der Angeklagte erklärt, er wolle nicht bestreiten, dass er das damals so gesagt habe. Er habe jedoch mit dieser Einlassung nicht das zum Ausdruck bringen wollen, wie es heute ausgelegt werde. Er habe nie einen Transport als verantwortlicher Führer zu den Gaskammern begleitet. Die Begleitung der Transporte sei Aufgabe der Wachmannschaft gewesen, die die für den Tod bestimmten Menschen zu den Gaskammern geführt hätte. Er selbst sei nur auf der Rampe hin- und hergegangen, um nicht aufzufallen und sei dabei zwangsläufig auch schon einmal ein Stück neben den Marschkolonnen hergegangen, die zu den Krematorien geführt worden seien. Eine "Begleitung" dieser Menschen sei das jedoch nicht gewesen. Ihm sei damals bei der Vernehmung durch den Untersuchungsrichter der Unterschied zwischen einer "Begleitung" eines RSHA-Transportes und dem blossen Mitlaufen in der Absicht, nicht aufzufallen, nicht klar gewesen. Sonst hätte er sich anders ausgedrückt.
Diese Erklärung des Angeklagten Dr. Sc. erscheint zwar auf den ersten Blick nicht überzeugend, sie kann aber auch nicht als völlig abwegig und unglaubhaft bezeichnet werden. Denn die Begleitung der Transporte zu den Gaskammern war nicht Aufgabe der zum Rampendienst eingeteilten Ärzte oder Zahnärzte. Hierfür waren die eingeteilten SS-Führer und SS-Unterführer bzw. SS-Mannschaften verantwortlich. Dass jemals ein Arzt die für die Gaskammern bestimmten Menschen zu den Gaskammern geführt hätte, hat die Beweisaufnahme nicht ergeben. Die Einlassung des Angeklagten Dr. Sc. vor dem Untersuchungsrichter kann daher auf einer gewissen Ungeschicklichkeit und Ungewandtheit des Angeklagten in seiner Ausdrucksweise beruhen. Es kann ihm nicht mit Sicherheit widerlegt werden, dass er tatsächlich nur zum Ausdruck bringen wollte, dass er ohne irgendeine Funktion und ohne irgendeinen Tatbeitrag zu den Vernichtungsaktionen zu leisten, nur ein Stück neben den von den SS-Unterführern und SS-Mannschaften geführten Menschen mitgelaufen ist, um nicht aufzufallen und eine gewisse Tätigkeit vorzutäuschen.
Schliesslich konnte dem Angeklagten Dr. Sc. nicht widerlegt werden, dass er bei den Gaskammern nie eine Funktion ausgeübt hat.
Der Zeuge Pa. hat allerdings bekundet, dass er den Angeklagten Dr. Sc., den er bei der Gegenüberstellung in der Hauptverhandlung wiedererkannt haben will, viel gesehen habe. Der Angeklagte Dr. Sc. habe - so hat der Zeuge ausgesagt - irgend etwas mit den Zähnen zu tun gehabt. Er habe ihn gesehen, wie er Zähne abgeholt und Gold weggebracht habe. Er habe ihn aber auch gesehen, wenn Transporte angekommen seien. Der Zeuge konnte jedoch nicht bestätigen, dass der Angeklagte Dr. Sc. bei der Vergasung von sog. RSHA-Juden irgend eine Tätigkeit entfaltet hat. Der Zeuge musste einräumen, dass er bei Vergasungen von RSHA-Transporten keine Beobachtungen bezüglich des Angeklagten Dr. Sc. habe machen können. Wenn auch auf Grund der Aussage des Zeugen Pa. ein erheblicher Verdacht besteht, dass der Angeklagte bei solchen Vergasungen mitgewirkt hat, kann doch nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden, dass der Angeklagte Sc. zufällig dann zu den mit dem Schmelzen des Zahngoldes beschäftigten jüdischen Häftlingen, die im Krematorium II ihren Schmelzraum hatten, hingegangen ist, um ihre Arbeit zu überwachen oder zu überprüfen oder um Zahngold abzuholen, wenn gerade RSHA-Transporte ankamen. Die Erinnerung des Zeugen Pa. an den Angeklagten beruhte auch in erster Linie auf der Tätigkeit des Angeklagten im Zusammenhang mit den Zähnen und dem Zahngold.
Zusammenfassend konnte jedoch nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass der Angeklagte Dr. Sc. Selektionsdienst auf der Rampe und Dienst an der Gaskammer verrichtet hat.
Die Staatsanwaltschaft hat die Auffassung vertreten, dass sich der Angeklagte Dr. Sc. schon allein dadurch, dass er überhaupt auf der Rampe gewesen sei, strafbar gemacht habe, weil er einen kausalen Tatbeitrag zu den Vernichtungsaktionen geleistet habe, indem er die anderen SS-Angehörigen psychisch gestärkt habe. Sie hat ihn als Mittäter an den Massenmorden angesehen.
Dieser Auffassung vermag sich das Schwurgericht nicht anzuschliessen. Es kann dahingestellt bleiben, ob die blosse Anwesenheit des Angeklagten Dr. Sc. auf der Rampe, die er zugibt, allein schon als Förderung der Vernichtungsaktionen angesehen werden kann. Ebenso kann es dahingestellt bleiben, ob der Angeklagte Dr. Sc. dadurch, dass er - wie er sich jetzt einlässt, um nicht aufzufallen - ein Stück neben den jüdischen Menschen, die zu den Gaskammern geführt wurden, hergelaufen ist, objektiv einen kausalen Tatbeitrag zu den Vernichtungsaktionen geleistet hat. Auch wenn man allein in diesem Verhalten des Angeklagten objektiv eine Förderung der Vernichtungsaktionen, also die Leistung eines kausalen Tatbeitrages zu den Massenmorden sieht (was nach Auffassung des Schwurgerichts zweifelhaft ist), kann dem Angeklagten Dr. Sc. nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden, dass er das Bewusstsein gehabt hat, durch seine blosse Anwesenheit auf der Rampe einen kausalen Tatbeitrag zu den Vernichtungsaktionen zu leisten. Ebenso wenig kann mit Sicherheit festgestellt werden, dass ihm klar gewesen ist, dass das blosse Mitlaufen mit den jüdischen Menschen, die von anderen verantwortlichen SS-Angehörigen zu den Gaskammern geführt worden sind, die Vernichtungsaktionen in irgendeiner Weise fördern konnte. Nach seiner unwiderlegten Einlassung wollte sich der Angeklagte Dr. Sc. von jeder Beteiligung an den Vernichtungsaktionen "drücken". Zu diesem Zweck ist er auf der Rampe hin- und hergegangen und hat sich, um nicht aufzufallen, auch ein Stück neben der Kolonne der Opfer bewegt. Er konnte annehmen, dass dies für den Ablauf der Vernichtungsaktionen völlig ohne Bedeutung sei. Denn die Menschen wurden von SS-Wachtposten und deren Führern zu den Gaskammern geführt. Auf diese hatte er keinen Einfluss. Er war als Zahnarzt nicht ihr Vorgesetzter. Der Gedanke, dass seine Anwesenheit auf der Rampe oder in der Nähe der Opfer, die zur Gaskammer geführt wurden, die SS-Angehörigen, die mit den Vernichtungsaktionen befasst waren, in irgend einer Weise psychisch stärken könnte, brauchte ihm nicht zu kommen. Das lag bei seiner Funktion, die er im KL Auschwitz als kleiner und unbedeutender Zahnarzt ausübte, nicht sehr nahe.
Eine Bestrafung des Angeklagten Dr. Sc. wäre aber nur möglich, wenn ihm mit Sicherheit nachgewiesen werden könnte, dass er sich bereits damals darüber im klaren gewesen ist, durch sein Verhalten einen kausalen Tatbeitrag zu den Vernichtungsaktionen zu leisten. Denn nur dann hätte er vorsätzlich die Vernichtungsaktionen gefördert.
Da somit dem Angeklagten Dr. Sc. trotz erheblichen Verdachts nicht nachgewiesen werden kann, Selektionsdienst oder Gaskammerdienst verrichtet zu haben, und auch nicht festgestellt werden konnte, dass er das Bewusstsein gehabt hat, durch sein - von ihm zugegebenes - Verhalten auf der Rampe kausale Tatbeiträge zu den Vernichtungsaktionen zu leisten, war er mangels Beweises freizusprechen.
5. Abschnitt:
Weitere Schuldvorwürfe gegen die Angeklagten Mulka, Höcker, Boger, St., Dylewski, Broad, Schlage, Hofmann, Kaduk, Baretzki, Dr. Capesius, Klehr und Bednarek, die nicht zu einer Verurteilung dieser Angeklagten führten
I. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Mulka
1.
Dem Angeklagten Mulka wird durch den Eröffnungsbeschluss ferner zur Last gelegt, in der Zeit vom Februar bis März 1943 nicht nur als Adjutant, sondern auch in seiner Eigenschaft als Kompanieführer einer Wacheinheit an der Vernichtung jüdischer Menschen, die zum Zwecke der "Liquidierung" aus verschiedenen Ländern Europas nach Auschwitz gebracht worden waren, mitgewirkt zu haben.
Wie bereits beim Lebenslauf des Angeklagten Mulka ausgeführt worden ist, wurde er nach seiner Versetzung zu dem KL Auschwitz zunächst als Kompanieführer der 1. Kompanie eingesetzt. Er gibt unwiderlegt an, dass dies Ende Januar 1942 gewesen sei. Als Kompanieführer fungierte er bis zum April 1942. Dann wurde er - wie bei seinem Lebenslauf schon ausgeführt worden ist - mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte des Adjutanten betraut, später durch Kommandanturbefehl Nr.8/42 vom 29.4.1942 vertretungsweise mit den Dienstgeschäften des Adjutanten beauftragt und schliesslich durch Kommandanturbefehl vom 6.6.1942 endgültig von der Wachtruppe zum Kommandanturstab versetzt. Kompanieführer war er somit nur von Januar 1942 bis April 1942.
Wie bereits im 3. Abschnitt unter A.II. ausgeführt worden ist, war es Aufgabe der zum Wachsturmbann gehörenden Wachkompanie, vor dem Aussteigen der mit RSHA-Transporten angekommenen jüdischen Menschen um die Rampe einen geschlossenen Ring bewaffneter Wachtposten zu bilden, um Fluchtversuche der angekommenen Menschen zu verhindern und Unbefugten den Zutritt zur Rampe zu verwehren. In diesen Sicherungsaufgaben lösten sich die einzelnen Wachkompanien ab.
Der Angeklagte Mulka hat sich dahin eingelassen, dass die erste Kompanie zu solchen Sicherungsaufgaben nie eingeteilt worden sei. Die Sicherungsposten für die angekommenen RSHA-Transporte seien nur von den anderen Wachkompanien gestellt worden. Die erste Kompanie sei nämlich die sog. "Ehrenkompanie" gewesen. Sie habe bei festlichen Anlässen z.B. bei "hohem" Besuch, bei Trauerfeiern usw. Soldaten für den Ehrendienst stellen müssen. Zwar habe sie auch Häftlingsbegleitkommandos und Posten für die innere Postenkette und das Schutzhaftlager stellen müssen, sie sei jedoch nie zum Rampendienst eingeteilt worden. Er selbst sei in seiner Eigenschaft als Kompanieführer nie an der Rampe gewesen.
Der Zeuge Mess., der als Volksdeutscher aus Rumänien in der ersten Wachkompanie von August 1940 bis zum Sommer 1944 zunächst als SS-Mann und ab 1.2.1942 als SS-Unterscharführer Dienst verrichtet hat, hat demgegenüber bekundet, dass auch die erste Kompanie zum Absperrdienst an der Rampe eingesetzt worden sei. Er selbst habe ein- bis zweimal - so hat der Zeuge erklärt - die Rampe nach der Ankunft von RSHA-Transporten mit absperren müssen. Der Zeuge konnte sich auch noch daran erinnern, dass der Angeklagte Mulka eine Zeitlang sein Kompaniechef gewesen sei. Er wusste jedoch nicht mehr, wann dies gewesen sei. Der Zeuge hatte auch nicht mehr in Erinnerung, ob die erste Kompanie in der Zeit, in der der Angeklagte Mulka ihr Kompaniechef war, zum Absperrdienst eingeteilt worden ist. Er hat angegeben, dass für den Absperrdienst fast die ganze Kompanie eingesetzt worden sei und dass auch der Kompanieführer mit der Kompanie den Rampendienst versehen habe. Er wusste jedoch nicht, ob in den ein bis zwei Fällen, in denen er selbst mit auf der Rampe gewesen ist, der Angeklagte Mulka noch als Kompanieführer fungiert hat.
Der Angeklagte Baretzki hat ebenfalls bestätigt, dass die erste Kompanie zum Rampendienst eingeteilt worden ist. Der Angeklagte war selbst eine Zeitlang als SS-Mann in der ersten Wachkompanie eingesetzt. Er hat ausgesagt, dass er während seiner Zugehörigkeit zur ersten Kompanie öfters zum Absperrdienst eingeteilt worden sei. Die einzelnen Kompanien des Wachsturmbannes hätten sich im Rampendienst abgewechselt. Er hat gemeint, dass auch der Kompaniechef mit zur Rampe gegangen sei, konnte sich jedoch nicht mehr konkret erinnern, ob der Angeklagte Mulka als Kompaniechef der ersten Kompanie zum Absperrdienst auf der Rampe eingesetzt war. Auch konnte er keine präzisen Angaben mehr darüber machen, wann genau die von ihm miterlebten Einsätze der ersten Kompanie im Rahmen des Absperrdienstes gewesen sind.
Aus den Aussagen der Zeugen Mess. und des Angeklagten Baretzki ergibt sich somit zwar, dass auch die erste Kompanie - entgegen der Einlassung des Angeklagten Mulka - zum Rampenabsperrdienst eingesetzt worden ist, es konnte jedoch nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob solche Einsätze auch während der Zeit, in der der Angeklagte Mulka Kompanieführer der ersten Kompanie war, stattgefunden haben. Da der Angeklagte Mulka nur von Ende Januar 1942 bis April 1942 Kompanieführer der ersten Kompanie gewesen ist, besteht immerhin die Möglichkeit, dass in dieser Zeit ein Einsatz der ersten Kompanie für einen Rampenabsperrdienst nicht erforderlich war.
Das Schwurgericht konnte nicht feststellen, wieviele RSHA-Transporte in dieser Zeit angekommen sind. Da zu dieser Zeit die Vernichtungsaktionen gegen die Juden erst anliefen, nachdem im Herbst 1941 nur kleine Gruppen von jüdischen Menschen mit LKWs aus Ostoberschlesien nach Auschwitz deportiert worden waren, die im KL Auschwitz erschossen wurden, und da über Vernichtungsaktionen im kleinen Krematorium durch Gas konkrete Feststellungen erst für die Monate April, Mai getroffen werden konnten (Aussage des Zeugen Philipp Mü.), besteht immerhin die Möglichkeit, dass in der Zeit, in der der Angeklagte Mulka Kompanieführer der ersten Kompanie gewesen ist, nur vereinzelt RSHA-Transporte auf der alten Rampe eingetroffen sind und das hierfür nur die anderen Kompanien Absperrdienst verrichten mussten.
Es war somit nicht mit Sicherheit festzustellen, dass der Angeklagte Mulka in seiner Eigenschaft als Kompanieführer der ersten Kompanie an Vernichtungsaktionen im Rahmen der sog. "Endlösung der Judenfrage" beteiligt gewesen ist. Er war daher von diesem Schuldvorwurf mangels Beweises freizusprechen.
2.
Dem Angeklagten Mulka wird ferner zur Last gelegt, nicht nur an der Massenvernichtung jüdischer Menschen, die mit sog. RSHA-Transporten nach Auschwitz deportiert worden sind, sondern auch an der Tötung einer unbestimmten Vielzahl von Häftlingen aus dem Gesamtbereich des Konzentrationslagers Auschwitz, also von Menschen, die bereits in das Lager aufgenommen worden waren, mitgewirkt zu haben. Über die im 3. Abschnitt unter A.II. getroffenen Feststellungen hinaus, war dem Angeklagten Mulka jedoch nicht nachzuweisen, dass er sich an sonstigen Tötungshandlungen im Bereich des KL Auschwitz bewusst und gewollt beteiligt hat.
a. Zunächst war nicht mit Sicherheit festzustellen, dass er an Erschiessungen von Häftlingen auf dem Hof zwischen Block 10 und 11 nach sog. Bunkerentleerungen in irgend einer Weise mitgewirkt hat.
Der Angeklagte Mulka bestreitet, jemals das Schutzhaftlager und den Block 11 betreten zu haben. Von dem Arrestbunker im Block 11 will er nichts gewusst haben. Ebensowenig will er Kenntnis von den Stehzellen gehabt haben. Auch über die sog. Bunkerentleerungen und die anschliessenden eigenmächtigen Erschiessungen durch die Angehörigen der Schutzhaftlagerführung und die Angehörigen der Politischen Abteilung sei er - so hat er sich eingelassen - nicht informiert gewesen.
Diese Einlassung erscheint wenig glaubhaft, zumal der Angeklagte Mulka auch in anderer Hinsicht die Unwahrheit gesagt hat.
Der Angeklagte Mulka hatte sein Büro im Kommandanturgebäude, das unmittelbar am Lagerzaun lag. Von seinem Dienstzimmer aus konnte er das Schutzhaftlager überblicken. Vom Kommandanturgebäude war nur ein kurzer Weg bis zum Tor, das in das Lager hineinführte. Als Adjutant musste sich der Angeklagte Mulka um alles kümmern. Er war verpflichtet, den Lagerkommandanten über alle wichtigen Vorgänge im Schutzhaftlager zu informieren. Es erscheint daher ausgeschlossen, dass der Angeklagte Mulka nie das Schutzhaftlager betreten haben soll.
Andererseits erfolgten die Erschiessungen nach sog. Bunkerentleerungen im Hof zwischen Block 10 und 11 im Schutz der vor dem Hof befindlichen hohen Mauer in aller Heimlichkeit. Durch Schalldämpfer auf den Gewehren wurde verhindert, dass der Knall der Schüsse ausserhalb des Lagers gehört werden konnte. Nach aussen wurden die Erschiessungen dadurch verschleiert, dass man die Opfer als normal verstorben vom HKB absetzte, indem man fingierte Todesursachen auf den Todesurkunden einsetzen liess. Befehle höherer SS-Dienststellen lagen für diese Erschiessungen nicht vor. Sie erfolgten gegen die ausdrückliche Weisung der SS-Führung, dass kein Häftling im KL Auschwitz ohne Befehl des "Führers", der allein über das Leben und Tod eines "Staatsfeindes" - nach der damaligen Auffassung - zu entscheiden hatte, getötet werden dürfe. Unter diesen Umständen kann nach Auffassung des Schwurgerichts allein aus der Tatsache, dass der Angeklagte Mulka Adjutant des Lagerkommandanten war, nicht schon der Schluss gezogen werden, dass er an diesen eigenmächtigen Erschiessungen irgendwie mitgewirkt haben müsse und dafür strafrechtlich verantwortlich sei. Hierfür mag zwar ein erheblicher Verdacht bestehen. Dieser reicht jedoch zur Grundlage für unanfechtbare Feststellungen und eine Verurteilung nicht aus.
Sichere Beweise für eine Beteiligung des Angeklagten Mulka an diesen Erschiessungen hat die Beweisaufnahme nicht erbracht.
Der Zeuge Ol. hat zwar ausgesagt, er habe den Angeklagten Mulka oft in den Bunker gehen sehen. Das sei im Winter - Ende 1942 / Anfang 1943 - gewesen. Gegen die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit des Zeugen bestehen jedoch erhebliche Bedenken. Der Zeuge hat nicht genau unterschieden zwischen dem, was er selbst erlebt und gesehen und was er von anderen gehört und gelesen hat. Viele Dinge hat er als eigenes Erleben geschildert, die er nur von anderen erfahren haben kann. Ferner hat er aus bestimmten Umständen Schlussfolgerungen gezogen, die nicht überzeugend sind. Der Zeuge neigt zu Übertreibungen und zu der Tendenz, die in diesem Verfahren angeklagten ehemaligen SS-Angehörigen aus dem KL Auschwitz unter allen Umständen zu belasten. Im einzelnen ergeben sich die Bedenken gegen die Glaubwürdigkeit des Zeugen aus folgendem: Der Zeuge hat unter anderem die Erhängung von 12 Vermessungsingenieuren, die öffentlich vor dem gesamten angetretenen Lager erfolgt ist, geschildert. Er hat behauptet, dass dies die "Aktion des Angeklagten Boger" gewesen sei. Die 12 Häftlinge seien zum Tode verurteilt worden, weil ein Häftling geflohen sei. Woher der Zeuge Kenntnis davon gehabt haben will, dass die Erhängung eine Aktion des Angeklagten Boger gewesen ist, ist nicht ersichtlich. Die Tatsache, dass die 12 Häftlinge öffentlich erhängt worden sind, spricht dafür, dass eine Exekutionsanordnung des RSHA vorgelegen hat. Der Zeuge hat dann mit aller Bestimmtheit behauptet, dass die Erhängung auf Befehl der Politischen Abteilung erfolgt sei. Die Aktion habe unmittelbar nach der Flucht stattgefunden. Daher sei die Zeit zu gering gewesen, um die Sache nach Berlin zu melden und die Entscheidung aus Berlin einzuholen. Diese Schlussfolgerung des Zeugen vermag nicht zu überzeugen. Durch Fernschreiben konnten in kürzester Zeit Meldungen nach Berlin durchgegeben und Entscheidungen des RSHA eingeholt werden.
Der Zeuge hat dann weiter erklärt, es sei möglich, ja es stehe sogar fest, dass das RSHA in Kenntnis von der Erhängung gesetzt worden sei. Das sei aber erst hinterher geschehen, nachdem die Häftlinge tot gewesen seien. Die "Todesurteile" seien erst hinterher gekommen. Es sei öfters vorgekommen, dass Urteile vollstreckt worden seien, bevor sie eingetroffen gewesen seien.
Auch diese Behauptung des Zeugen erscheint wenig stichhaltig. Im KL Auschwitz wurden zwar viele Häftlinge ohne Wissen und Genehmigung des RSHA getötet. Dies geschah jedoch in aller Heimlichkeit. Solche Tötungshandlungen wurden nach aussen verschleiert, indem man auf die Todesurkunden der betreffenden Häftlinge fingierte Todesursachen setzte. Es ist jedoch kaum anzunehmen, dass SS-Angehörige vom KL Auschwitz gewagt haben, ohne Genehmigung oder Befehl des RSHA Häftlinge öffentlich zu exekutieren. Denn dies konnte dem RSHA nicht verborgen bleiben, zumal nach öffentlichen Exekutionen keine fingierten Todesursachen in den Todespapieren eingetragen worden sind. Nach der glaubhaften Aussage des Zeugen Dr. P. wurde nach der Erhängung von Häftlingen auf deren Karteikarte vermerkt: "Tod durch Exekution."
Durch die eigenmächtige Anordnung einer Exekution ohne Genehmigung oder Befehl des RSHA hätte sich jeder SS-Angehörige im Lager, auch der Lagerkommandant, nach der damaligen Auffassung der SS-Führung strafbar gemacht und wäre zur Verantwortung gezogen worden, da kein SS-Angehöriger im Lager befugt war, über Leben und Tod eines Häftlings zu entscheiden. Auf die Frage, woher der Zeuge wisse, dass in diesem Fall die Erhängung der 12 Häftlinge eigenmächtig erfolgt sei und woher er die Kenntnis habe, dass das "Urteil" des RSHA erst hinterher eingetroffen sei, hat der Zeuge erklärt: "Ich weiss es und bin mir dessen voll bewusst, dass diese Strafe (Erhängung) vollzogen wurde, bevor das Urteil kam und zwar deswegen, weil die Vollstreckung des Urteils sehr kurze Zeit nach der Flucht, nämlich 2-3 Tage danach erfolgte." Der Zeuge hat somit seine Behauptung, die Exekution sei eigenmächtig erfolgt, es sei eine Aktion des Angeklagten Boger gewesen, nur auf eine Schlussfolgerung gestützt. Diese Schlussfolgerung ist jedoch nicht überzeugend. Denn - wie schon gesagt - konnte eine Entscheidung des RSHA innerhalb von 2-3 Tagen ohne weiteres durch Fernschreiben eingeholt werden. Der Zeuge musste schliesslich auch einräumen, dass vor der Erhängung der 12 Häftlinge auf Befehl des Lagerkommandanten Höss irgend ein Dokument verlesen worden sei. Das spricht dafür, dass tatsächlich eine Exekutionsanordnung des RSHA vorgelegen hat. Allerdings hat der Zeuge weiter behauptet, dieses Dokument sei nur ein Provisorium gewesen, das "Todesurteil" sei erst später eingetroffen. Eine stichhaltige Begründung für diese Behauptung konnte der Zeuge nicht geben. Auf Befragen musste er einräumen, dass er das angeblich später eingetroffene Todesurteil selbst nicht gesehen habe.
Der Zeuge hat die Durchführung der Exekution wie folgt beschrieben: er habe gesehen, wie sich die Angeklagten Boger und Kaduk bei der Erhängung der Häftlinge "freie Luft gemacht hätten". Sie hätten "ihren Gelüsten freien Lauf gelassen". Für die Erhängung sei ein Gestell provisorisch zusammengebaut worden. Die Angeklagten Boger und Kaduk hätten den Häftlingen die Schlinge über den Kopf gezogen. Dann seien die Hocker, auf denen die Häftlinge gestanden hätten, beiseite geschoben worden. Boger und Kaduk hätten die Häftlinge noch im Sterben misshandelt.
Demgegenüber hat der zuverlässige Zeuge Dr. P., der bei der Erhängung der 12 Landmesser dabei gewesen ist, bekundet, dass ein Kapo den Häftlingen die Schlinge um den Hals gelegt habe. Davon, dass die Angeklagten Boger und Kaduk die sterbenden Häftlinge noch misshandelt hätten, hat er nichts berichtet. Die Schilderung des Ol. zeigt somit, dass der Zeuge zu Übertreibungen neigt und bestrebt war, die Angeklagten unter allen Umständen zu belasten.
Der Zeuge hat dann weiter die Erschiessung von Angehörigen eines Kommandos "Union" geschildert. Dieses Kommando habe - so hat er ausgeführt - in der Werkhalle "Union" der Firma Krupp gearbeitet. Die Häftlinge hätten in zwei Schichten je 12 Stunden gearbeitet. Sie seien so erschöpft gewesen, dass sie oft zusammengebrochen seien. Dies sei von der Lagerleitung als Sabotage aufgefasst worden. Die Häftlinge seien dann im Oktober oder November 1944 verhaftet und in den Block 11 gebracht worden. Bei der Untersuchung sei es dann zur Aufdeckung eines Zusammenhanges zwischen diesem Kommando "Union" und dem Aufstand des Sonderkommandos im Krematorium gekommen. Das Kommando "Union" habe nämlich dem Sonderkommando Granatteile und Granaten zukommen lassen, womit diese dann den Aufstand gemacht hätten.
Der Zeuge hat dann weiter behauptet, er habe mit eigenen Augen gesehen, wie der Angeklagte Boger die Häftlinge auf dem Hof zwischen Block 10 und 11 an der Schwarzen Wand erschossen habe. Er habe zwar nicht alles selbst gesehen. Er habe aber mit dem Schreiber auf Block 11 genau die Einzelheiten "durchdiskutiert". Mit diesem zusammen habe er durch das vergitterte Fenster in dem Gerichtssaal in Block 11 (Erdgeschoss) gesehen, wie die Häftlinge aus dem Waschraum zur Exekution geführt und durch Genickschüsse getötet worden seien. Boger habe das allein gemacht. Er habe mit einem Kleinkalibergewehr geschossen. Wegen der Entfernung von seinem Beobachtungsstand bis zur Schwarzen Wand habe er nicht hören können, was Boger den Delinquenten gesagt habe. Er habe aber gewusst, dass Boger die Häftlinge bei solchen Exekutionen beleidigt habe.
Nach dieser Schilderung des Zeugen musste man annehmen, dass der Zeuge die Erschiessungen von mehreren, wenn nicht aller, Häftlinge aus dem Kommando "Union" durch den Angeklagten Boger mit angesehen habe. Auf ausdrückliches Befragen, wieviele Häftlinge denn der Angeklagte Boger von dem Kommando "Union" nach seiner - des Zeugen - eigenen Beobachtung erschossen habe, erklärte jedoch der Zeuge: Mit eigenen Augen habe er gesehen, dass der Angeklagte Boger einen jüdischen Häftling erschossen habe. Sein Beobachtungsstand sei das Fenster im Gerichtssaal im Erdgeschoss gewesen.
Die ganze Schilderung des Zeugen über die Erschiessung der Angehörigen des Kommandos "Union" ist unglaubhaft. Es mag zwar sein, dass damals eine Aktion gegen die Angehörigen des Kommandos "Union" stattgefunden hat und dass die Häftlinge aus dem Kommando auch erschossen worden sind. Der Zeuge hat dies jedoch nach der Überzeugung des Gerichts nicht mit eigenen Augen beobachtet. Er hat hiervon wahrscheinlich durch Erzählungen anderer Häftlinge erfahren. Hierfür spricht, dass er selbst erklärt hat, er habe die Einzelheiten mit dem Blockschreiber des Blockes 11 "durchdiskutiert". Hätte er alles mit eigenen Augen gesehen, was er geschildert hat, hätte es eines Hinweises auf die Diskussion mit anderen Häftlingen nicht bedurft. Wahrscheinlich hat der Zeuge auf Grund der Erzählungen anderer Häftlinge seine angeblichen eigenen Beobachtungen erfunden. Denn gegen seine Darstellung spricht folgendes: Der Zeuge war damals - wie er angegeben hat - Rapportschreiber im Stammlager. Er war somit nicht im Block 11 beschäftigt. Gleichwohl will er jederzeit freien Zutritt zu Block 11 gehabt haben. Auch zu der Erschiessung der Angehörigen des Kommandos "Union" will er ungehindert in den Block 11 gekommen sein. Das ist unglaubhaft. Denn für Erschiessungen an der Schwarzen Wand wurde jeweils strenge Blocksperre angeordnet. Kein Häftling aus dem Lager durfte während dieser Zeit den Block 11 betreten. Es erscheint daher wenig wahrscheinlich, dass der Zeuge ungehindert in den Block 11 hat gehen können, wenn der Angeklagte Boger tatsächlich die Angehörigen des Kommandos "Union" auf dem Hof zwischen Block 10 und 11 erschossen hat. Unwahrscheinlich erscheint auch, dass der Zeuge vom Fenster des sog. "Gerichtssaales" aus die Erschiessungen hat mitansehen können. Nach den Aussagen der Zeugen Wl. und Schei. wurden die Zimmer, deren Fenster auf den Hof gingen, vor Erschiessungen von Häftlingen geräumt. Die Zimmer wurden anschliessend - wie der Zeuge Stein. glaubhaft bekundet hat - verschlossen. Stein., der einige Zeit in der Quarantänestation in Block 11 untergebracht war, hat daher nie mit eigenen Augen Erschiessungen an der Schwarzen Wand beobachten können. Der Zeuge hat erklärt, dass er und die anderen Häftlinge es nie gewagt hätten, zu ihren Stuben zurückzuschleichen, die vielleicht nicht immer verschlossen worden seien; sie hätten nie den Versuch gewagt, die Erschiessungen zu beobachten. Nach der Aussage des Zeugen Wl., der einige Zeit als Schreiber auf Block 11 tätig gewesen ist, war es streng verboten, den Erschiessungen aus dem Block 11 heraus zuzusehen. Es war gefährlich, Exekutionen an der Schwarzen Wand aus den Fenstern des Blockes 11 zu beobachten. Es erscheint daher wenig glaubhaft, dass der Zeuge Ol. es gewagt haben sollte, sich am Fenster während einer Exekution zu zeigen.
Unwahrscheinlich ist auch, dass der Angeklagte Boger die Exekution allein durchgeführt haben soll. Nach der Aussage des Zeugen Ol. sollen 30-50 Häftlinge im Kommando "Union" gewesen sein. Bei einer solchen Anzahl hätte man die Exekution schon aus Sicherheitsgründen nicht durch einen einzigen SS-Mann durchführen lassen.
Vor allem aber spricht gegen die Schilderung des Zeugen, dass im Oktober oder November 1944 nach den auf Grund der Beweisaufnahme getroffenen Feststellungen überhaupt keine Exekutionen mehr im Hof zwischen Block 10 und 11 durchgeführt worden sind. Wie bereits bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Dylewski ausgeführt worden ist (3. Abschnitt E.III.3.) wurde die Schwarze Wand nach der glaubhaften Bekundung des Zeugen Pi. nach dem Kommandantenwechsel im November 1943 abgerissen, die Erschiessungen auf Block 11 hörten auf. Der Zeuge Sm. hat dies bestätigt. Er hat ausgesagt, dass ab Februar 1944 keine Erschiessungen mehr auf dem Hof zwischen Block 10 und 11 stattgefunden hätten. Von diesem Zeitpunkt an seien Erschiessungen nur noch an der Sauna in Birkenau durchgeführt worden.
Schliesslich weicht die Schilderung des Zeugen Ol., die er in der Hauptverhandlung über die Exekution der Angehörigen des Kommandos "Union" gegeben hat, erheblich ab von der Schilderung des Zeugen über die gleiche Exekution, die er im Ermittlungsverfahren in einem Bericht an das internationale Auschwitzkomitee gegeben hat. In diesem Bericht schildert der Zeuge die Exekution wie folgt:
"Noch schlimmer wütete er (Boger) etwa Mitte 1944 im Kommando "Union". Als dort Häftlinge infolge körperlicher Erschöpfung nicht mehr arbeiten konnten, hat es Boger übernommen, diese als Saboteure zu liquidieren. 46 völlig heruntergekommene Häftlinge wurden auf Befehl Bogers auf Block 11 (Bunker) gebracht. Dort sagte er: "So ihr Hunde, nun wisst Ihr, was es heisst, sich aufzulehnen", griff zu seiner Dienstpistole und mordete sie durch Genickschüsse, nachdem er sie vorher mit dem Gesicht zur Wand gestellt hatte .....".
Früher will der Zeuge also gehört haben, was der Angeklagte Boger zu den Opfern gesprochen hat. In der Hauptverhandlung hat er ausgesagt, er habe nicht hören können, was Boger zu den Delinquenten gesagt habe. Nach dem früheren Bericht des Zeugen soll der Angeklagte Boger die Häftlinge mit der Dienstpistole erschossen haben. In der Hauptverhandlung hat der Zeuge behauptet, dass Boger die Häftlinge mit dem Kleinkalibergewehr erschossen habe. In der Hauptverhandlung hat der Zeuge zunächst die Exekution so geschildert, als ob er die Erschiessung mehrerer Opfer gesehen habe. Später hat er auf Befragen erklärt, dass er mit eigenen Augen nur die Erschiessung eines jüdischen Häftlings gesehen habe. Diese Widersprüche und die aufgezeigten Unwahrscheinlichkeiten müssen schwere Bedenken gegen die Glaubwürdigkeit des Zeugen aufkommen lassen und führen zu der Überzeugung, dass der Zeuge die Exekution der Angehörigen des Kommandos "Union" überhaupt nicht mitangesehen sondern seine angeblichen Beobachtungen erfunden hat.
Seiner Aussage konnte daher insgesamt kein Beweiswert zuerkannt werden.
Das Schwurgericht konnte daher auf seine Behauptung, er habe den Angeklagten Mulka öfters auf den Block 11 gehen sehen, keine Feststellungen stützen.
Der Zeuge Gl. will den Angeklagten Mulka bei Exekutionen an der Schwarzen Wand gesehen haben. Er hat erklärt, dass auch der Adjutant des Lagerkommandanten namens "Molko" oder "Moltke" den Erschiessungen beigewohnt habe. Der Adjutant sei eine bekannte Persönlichkeit gewesen. Man habe ihn im Lager gekannt. Diese Behauptung des Zeugen ist durch die Beweisaufnahme nicht bestätigt worden. Ausser dem Zeugen Krx., auf den noch zurückzukommen sein wird, und dem Zeugen Ol. hat kein Zeuge behauptet, den Angeklagten Mulka jemals im Schutzhaftlager gesehen zu haben. Nur wenige Zeugen haben den Angeklagten Mulka überhaupt gekannt. Auch der Zeuge Gl. hat offenbar den Namen des damaligen Adjutanten nicht genau gekannt. Denn er konnte auch jetzt den Namen noch nicht richtig aussprechen. Ausser dem Zeugen Gl. hat kein zuverlässiger Zeuge bekundet, dass der Angeklagte Mulka an Erschiessungen an der Schwarzen Wand beteiligt gewesen sei. Der Zeuge Wl., der vom Februar 1942 bis Dezember 1942 Blockschreiber im Block 11 gewesen ist, hätte es wissen müssen, wenn der Adjutant Mulka zu Erschiessungen in den Block 11 gekommen wäre. Dieser Zeuge hat den Angeklagten Mulka jedoch nicht gekannt. Er hat nichts davon berichtet, dass Mulka jemals bei Erschiessungen anwesend gewesen sei. Bei der auffälligen Erscheinung des Angeklagten Mulka und seinem - aus der Sicht der Häftlinge gesehen - relativ hohen Rang wäre es dem Zeugen sicher aufgefallen, wenn Mulka an Erschiessungen teilgenommen hätte. Auch der Zeuge Pi., der den Zeugen Wl. als Schreiber im Block 11 im Dezember 1942 abgelöst hat, hat nichts davon gewusst, dass der Angeklagte Mulka während der Erschiessungen auf dem Hof zwischen Block 10 und 11 anwesend gewesen ist. Als Schreiber hätte er es eigentlich wissen müssen, wenn Mulka in der Zeit zwischen Dezember 1942 und dem 9.März 1943 (dem Tag des Wegganges des Angeklagten aus dem KL Auschwitz) jemals in Block 11 gewesen wäre.
Auch andere Zeugen, die Erschiessungen an der Schwarzen Wand miterlebt haben, haben nichts von einer Beteiligung des Angeklagten Mulka berichtet.
Der Zeuge Gl. ist - wie bereits bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Dylewski (3. Abschnitt E.III.3.) und bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Scherpe (3. Abschnitt P.III.2.) sowie bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Hantl (3. Abschnitt Q.III.2.) im einzelnen ausgeführt worden ist - kein zuverlässiger Zeuge. Insbesondere bestehen Bedenken, ob seine Erinnerung an Personen zuverlässig ist. Auf Grund seiner Aussage konnte daher nicht festgestellt werden, dass der Angeklagte Mulka an Erschiessungen auf dem Hof zwischen Block 10 und 11 in irgend einer Weise teilgenommen hat.
Schliesslich hat noch der Zeuge Bor. bekundet, der Angeklagte Mulka habe zwei- bis dreimal an sog. Bunkerentleerungen teilgenommen. Der Zeuge will den Angeklagten im Arrestbunker gesehen haben.
Der Zeuge Bor. war - wie oben bereits ausgeführt (3. Abschnitt C.IV.4.) - vom 17.12.1942 bis 9.3.1943 im Arrestbunker des Blockes 11. Der Zeuge hat einen glaubwürdigen Eindruck gemacht. Das Gericht hat ihm geglaubt, soweit er den Angeklagten Boger belastet hat (vgl. 3. Abschnitt C.IV.4.). Die Erinnerung des Zeugen an den Angeklagten Boger war jedoch mit tiefgreifenden persönlichen Erlebnissen verbunden, die sich erfahrungsgemäss tief in das Gedächtnis einprägen. Der Zeuge sollte nach der Bunkerentleerung am 3.3.1943 selbst erschossen werden. Boger stand an diesem Tag unmittelbar an der Zelle, in der der Zeuge einsass. Er rief den Häftling Gestwinski, mit dem der Zeuge Bor. zusammen in einer Zelle war, aus der Zelle heraus. Bezüglich des Angeklagten Boger konnte der Zeuge konkrete Einzelheiten schildern, die er nach der Überzeugung des Gerichts nicht erfunden hat. Bezüglich des Angeklagten Mulka konnte der Zeuge keine konkreten Angaben machen. Der Zeuge hat erklärt, dass er nicht beobachtet habe, dass Mulka aktiv gewesen sei. Irgend ein Erlebnis, das mit der Person des Angeklagten Mulka in Beziehung gestanden hätte, hat der Zeuge nicht gehabt. Das Gericht konnte daher nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass die Erinnerung des Zeugen insoweit zuverlässig ist. Bedenken bestehen vor allem deswegen, weil kein Zeuge die Aussage des Zeugen Bor. bestätigt hat. Während der Angeklagte Boger eingeräumt hat, an Bunkerentleerungen teilgenommen zu haben, was von vielen Zeugen bestätigt worden ist, hat kein Zeuge ausgesagt, dass der Angeklagte Mulka jemals im Arrestbunker an Bunkerentleerungen teilgenommen habe.
Der Zeuge Se., der den Angeklagten Mulka gekannt hat, war vom 21.1.1943 bis 17.2.1943, also in der Zeit, in der auch der Zeuge Bor. im Bunker einsass, im Arrestbunker. Er hat nichts davon gewusst, dass der Angeklagte Mulka an Bunkerentleerungen teilgenommen hat.
Der Zeuge Pi., der während der Inhaftierung des Zeugen Bor. Blockschreiber auf Block 11 gewesen ist, hat ebenfalls keine Erinnerung daran, dass der Angeklagte Mulka an Bunkerentleerungen teilgenommen hat. Wenn der Angeklagte Mulka tatsächlich an Bunkerentleerungen teilgenommen hätte, hätte der Zeuge Pi. das eigentlich wissen müssen. Denn als Schreiber musste er zu den Bunkerentleerungen in den Arrestbunker mitgehen und hatte Gelegenheit, jeweils während eines längeren Zeitraumes alle SS-Angehörigen, die an den Bunkerentleerungen teilnahmen, zu beobachten. Seine Beobachtungsmöglichkeit war erheblich besser als die des Zeugen Bor., der in einer Zelle einsass. Wenn aber der Zeuge Pi. nach seiner heutigen Erinnerung den Angeklagten Mulka nie bei solchen Bunkerentleerungen gesehen hat, kann die Möglichkeit, dass der Zeuge Bor. bezüglich des Angeklagten Mulka einem Irrtum zum Opfer gefallen ist, nicht ausgeschlossen werden, zumal auch andere Zeugen, die während der Zeit, in der der Angeklagte Mulka Adjutant des Lagers gewesen ist, im Bunker eingesperrt waren, den Angeklagten Mulka bei Bunkerentleerungen nicht gesehen haben.
Das Gericht konnte daher auf Grund der alleinigen Aussage des Zeugen Bor. keine sicheren Feststellungen zum Nachteil des Angeklagten Mulka treffen.
b. Der Zeuge Krx. hat behauptet, er habe im Sommer oder Herbst 1942 einmal den Angeklagten Mulka bei einer Selektion vor der Küche im Stammlager gesehen. Bei dieser Selektion seien kranke Häftlinge ausgesondert worden. Mulka sei passiv gewesen. Er habe dagestanden und habe "dirigiert", die anderen SS-Angehörigen hätten die Kranken ausgesucht. Nähere Angaben hat der Zeuge nicht gemacht.
Gegen die Zuverlässigkeit des Zeugen Krx. bestehen Bedenken. Es kann hierzu auf die Ausführungen im 3. Abschnitt unter E.IV.2. über die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit des Zeugen Krx. Bezug genommen werden.
Bedenken, dass der Zeuge Krx. den Angeklagten Mulka tatsächlich bei einer Selektion gesehen hat, bestehen auch deswegen, weil ausser dem Zeugen Krx. kein anderer Zeuge von dieser Selektion berichtet hat. Wie schon ausgeführt, hat überhaupt kein Zeuge ausser Krx. und dem nicht zuverlässigen Zeugen Ol. bekundet, den Angeklagten Mulka im Schutzhaftlager oder bei Lagerselektionen gesehen zu haben. Im übrigen wurden die Selektionen kranker und schwacher Häftlinge in der Regel durch SS-Lagerärzte durchgeführt. Diese unterstanden nicht der Lagerkommandantur, sondern waren sachlich unmittelbar dem Amt D III im WVHA unterstellt. Die Lagerärzte erhielten von diesem Amt über den Standortarzt unmittelbar ihre Weisungen. Auch aus diesem Grund erscheint es nicht sehr wahrscheinlich, dass der Angeklagte Mulka an Lagerselektionen teilgenommen hat. Das Gericht konnte daher auf Grund der Aussage des Zeugen Krx. keine sicheren Feststellungen zum Nachteil des Angeklagten Mulka treffen.
c. Schliesslich war noch zu prüfen, ob der Angeklagte Mulka an der "Liquidierung" der 700 Typhuskranken am 29.8.1942 in irgend einer Weise mitgewirkt hat (vgl. oben 3. Abschnitt O.II.5.). Sichere Feststellungen konnten insoweit nicht getroffen werden. Zwar ist anzunehmen, dass dem Angeklagten Mulka die Tötung der Typhuskranken nicht verborgen geblieben ist. Der Befehl für die Tötung der Kranken kam jedoch von Berlin und zwar vom WVHA. Der Befehl ging an den Standortarzt. Die Vernichtung der Typhuskranken war somit eine Angelegenheit des ärztlichen Dienstes, nicht der Lagerkommandantur. Ob der Angeklagte Mulka den Befehl gesehen oder sogar weiterbefördert hat oder ob der Befehl nur mündlich gegeben worden ist, konnte nicht geklärt werden. Möglich ist immerhin, dass der Befehl vom WVHA unmittelbar dem Standortarzt übermittelt worden ist und dass die Lagerkommandantur hiervon nur Kenntnis erhielt. Verantwortlich für die "Liquidierung" der Typhuskranken war das WVHA. Die blosse Kenntnis von diesem Befehl und das blosse Wissen um die "Liquidierung" der 700 Typhuskranken kann allein noch nicht als kausaler Tatbeitrag zur Vernichtung der Typhuskranken angesehen werden.
Allerdings sind die 700 Typhuskranken mit LKWs zu den Gaskammern transportiert worden. Die LKWs gehörten zur Fahrbereitschaft. Diese wiederum unterstand dem Angeklagten Mulka.
Wer den Befehl für den Einsatz der LKWs gegeben hat, konnte nicht geklärt werden. Wahrscheinlich musste die Genehmigung des Angeklagten Mulka zum Einsatz dieser LKWs eingeholt werden. Es ist zu vermuten, dass der Angeklagte Mulka den Befehl für den Einsatz der LKWs gegeben hat. Mit Sicherheit konnte dies jedoch nicht festgestellt werden, zumal es sich um Fahrten innerhalb des Lagerbereiches gehandelt hat, für die Fahrbefehle nicht erforderlich waren. Möglich ist immerhin, dass der Angeklagte während der Vernichtungsaktion dienstlich gerade vom KL Auschwitz abwesend war und somit mit der gesamten Aktion überhaupt nicht befasst worden ist. Er selbst gibt an, dass er mit der Aktion nichts zu tun gehabt habe. Da kein Zeuge über irgend eine Beteiligung des Angeklagten Mulka Bekundungen hat machen können, auch keine Urkunden vorhanden sind, die den Nachweis für irgend eine Mitwirkung des Angeklagten Mulka an dieser Aktion erbringen, war eine Verurteilung des Angeklagten Mulka wegen der Tötung der 700 Typhuskranken nicht möglich.
Ein Nachweis für eine Mitwirkung des Angeklagten Mulka an weiteren Tötungshandlungen, die zu einer Verurteilung hätte führen können, ist nicht erbracht worden. Die befohlene Tötung eines Häftlings auf der Rampe, die der Zeuge Vr. geschildert hat, ist vom Eröffnungsbeschluss - wie bereits ausgeführt - nicht erfasst. Dieser Fall war bei der Erhebung der Anklage und Erlass des Eröffnungsbeschlusses noch nicht bekannt. Der Zeuge Vr. hat hiervon erstmalig in der Hauptverhandlung berichtet.
3.
Dem Angeklagten Mulka wird schliesslich durch die Nachtragsanklage vom 23.7.1964, die mit seiner Zustimmung in das Verfahren durch Gerichtsbeschluss einbezogen worden ist, zur Last gelegt, aus Mordlust und sonst aus niedrigen Beweggründen heimtückisch an einem nicht mehr feststellbaren Tag in der Nähe der SS-Küche vor dem KL-Stammlager in kurzem Zeitabstand hintereinander drei jüdische Häftlinge, die einem Arbeitskommando angehört hätten, das Strohsäcke aus dem Lager herausgetragen habe, durch Schüsse aus seiner Pistole getötet zu haben.
Der Angeklagte Mulka stellt entschieden in Abrede, jemals Häftlinge, erschossen zu haben.
Der Zeuge Ry. hat den Angeklagten Mulka in dieser Hinsicht schwer belastet. Der Zeuge, der jetzt 47 Jahre alt ist, kam am 17.4.1942 in das KL Auschwitz. Dort wurde er, nachdem er in verschiedenen Kommandos gearbeitet hatte, am 10.6.1942 im Kommando Harmense - dem Kommando Teichwirtschaft - eingesetzt. Die Häftlinge dieses Kommandos waren nicht im Stammlager untergebracht. Sie hatten ihre Unterkunft bei ihrer Arbeitsstelle.
Der Zeuge blieb bis Mitte August 1942 in diesem Kommando. Dann erkrankte er an Typhus. Er kam in den HKB des Stammlagers und zwar in die Baracke für Typhuskranke. Einen Tag vor der Ermordung der Typhuskranken (29.8.1942) wurde er von Kameraden, die von der bevorstehenden "Liquidierung" wussten, aus der Typhusbaracke herausgeholt und in den Block 19 gebracht. Dort blieb er noch ca. 3 Tage. Dann wurde er mit einem Pferdegespann aus Harmense aus dem KHB abgeholt und nach Harmense gebracht. Der Zeuge will auf dieser Fahrt gesehen haben, wie der Angeklagte Mulka 3 Häftlinge erschossen habe. Im einzelnen hat der Zeuge in der Hauptverhandlung die Fahrt wie folgt geschildert:
Kutscher des Pferdewagens sei der Häftling Kornacki gewesen. Er - der Zeuge - habe vorne rechts neben Kornacki gesessen. Ausserdem seien auf dem Pferdewagen die SS-Männer Thram und Pome., der an der Küche zugestiegen sei, mitgefahren. Als sie 600 bis 800 m von dem Stammlager entfernt gewesen seien, seien sie an einem Häftlingskommando vorbeigefahren, das Strohsäcke von dem Lager auf das Feld getragen habe. Sie hätten das Kommando, das aus ca. 40 Häftlingen bestanden hätte, überholt. Danach sei ihnen ein offener PKW entgegen gekommen. Da der Weg schmal gewesen sei, habe Thram dem Kutscher Kornacki befohlen, von dem Weg herunterzufahren und stehen zu bleiben. Das habe Kornacki gemacht. Der PKW sei ebenfalls stehen geblieben und zwar vor ihnen. Aus dem Auto sei der Hauptsturmführer Mulka ausgestiegen. Er - der Zeuge - habe Mulka erkannt. Mulka habe die SS-Männer, die das Häftlingskommando begleitet hätten, angeschrien. Er - der Zeuge - habe soviel verstanden, dass Mulka beanstandet habe, dass aus den Strohsäcken Holzwolle und Fäkalien herausfielen, weil die Strohsäcke mit der Öffnung nach unten getragen würden. Wahrscheinlich habe Mulka Angst vor Ansteckung gehabt. Er sei aufgeregt gewesen. Dann habe er die Pistole gezogen. Drei Häftlinge seien nebeneinander an ihm vorbeigegangen. Er habe auf einen dieser drei Häftlinge zwei Schüsse abgegeben. Der Häftling sei sofort hingefallen. Daraufhin sei Unruhe unter den Häftlingen ausgebrochen. Die Häftlinge, die die Strohsäcke getragen hätten, hätten aus der Nähe des Angeklagten Mulka weglaufen wollen. Sie hätten sich umgedreht. Daraufhin habe Mulka auf den zweiten Häftling auch zwei Schüsse abgegeben. Er - der Zeuge - habe genau gesehen, dass sich der Häftling hinter dem Strohsack versteckt habe und dass aus seinem Ärmel Blut geflossen sei. Mulka habe den Strohsack umsprungen und habe noch zwei weitere Schüsse auf den Häftling abgegeben. Dann habe er den dritten Häftling mit zwei Schüssen von rückwärts erschossen. Als Thram dies gesehen habe, habe er dem Kutscher zugerufen: "Vorwärts! Um das Auto herum und weg!" Daraufhin seien sie weiter gefahren. Thram habe zu dem anderen SS-Mann (Pome.) sinngemäss gesägt: "Der alte Mulka ist wild geworden, er hat vermutlich Angst vor Typhus." Sie seien dann nach Harmense weitergefahren und er - der Zeuge - habe sofort seinen Kameraden erzählt, was vorgefallen sei. Die Kameraden hätten das mit Ruhe aufgenommen, weil sie schon längere Zeit im Lager gewesen seien. Bei Mulka sei noch ein zweiter SS-Mann in Uniform gewesen, dessen Rangabzeichen ihnen nicht bekannt gewesen sei. Die Strohsäcke seien verbrannt worden. Er - der Zeuge - wisse nicht, warum Mulka geschossen habe. Er nehme an, dass einer der Häftlinge ihn berührt habe.
Das Gericht hat dem Zeugen Ry. geglaubt, dass er auf der Fahrt vom Schutzhaftlager nach Harmense beobachtet hat, wie ein SS-Führer drei Häftlinge, die Strohsäcke trugen, erschossen hat, obwohl dies der Zeuge Pome., der sich an diese Fahrt noch erinnern konnte, nicht bestätigt hat. Pome. wusste von einem solchen Vorfall nichts. Es ist möglich, dass die Erinnerung des Zeugen Pome. insoweit verblasst ist. Aber der Zeuge hat angegeben, dass er im Jahre 1944 verschüttet gewesen sei und sich daher an vieles nicht mehr erinnern könne. Es ist daher möglich, dass ihm der Vorfall entfallen ist.
Das Gericht konnte jedoch aus der Aussage des Zeugen Ry. nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass der Täter tatsächlich der Angeklagte Mulka gewesen ist. Der Zeuge Ry. hat zwar - wie schon ausgeführt - in der Hauptverhandlung erklärt, er habe den Angeklagten Mulka damals bereits gekannt. Insoweit bestehen jedoch Bedenken gegen die Zuverlässigkeit seiner Angaben. Der Zeuge Nale. war ebenfalls im Kommando Harmense. Er gehörte zu den Kameraden des Zeugen Ry., denen der Zeuge von seinem Erlebnis sofort berichtet hat. Nach der Aussage des Zeugen Nale. hat der Zeuge Ry. bei der Schilderung seines Erlebnisses den Namen des Angeklagten Mulka nicht erwähnt. Er hat - so hat der Zeuge Nale. bekundet - vielmehr erzählt, dass ein SS-Offizier im Range eines Obersturmführers drei Häftlinge erschossen habe. Er hat seinen Kameraden ferner erklärt, dass er den SS-Offizier an diesem Tage zum ersten Mal gesehen habe. Der Zeuge Nale. hat somit zwar bestätigt, dass Ry. damals einen Vorfall geschildert hat, bei dem ein SS-Führer drei Häftlinge erschossen hat, der Zeuge Nale. hat aber auf ausdrückliches Befragen erklärt, dass Ry. und Kornacki den Namen des Täters nicht genannt hätten. Sie hätten nur von einem SS-Offizier im Range eines SS-Obersturmführers gesprochen. Ry. habe erzählt, dass er den SS-Obersturmführer zum ersten Mal gesehen habe. Wenn das aber stimmt, woran zu zweifeln kein Anlass besteht, erscheint es wenig wahrscheinlich, dass der Zeuge Ry. den Angeklagten Mulka bereits damals gekannt hat. Andernfalls hätte er seinen Kameraden, was für die Häftlinge immerhin von Interesse war, den Namen genannt.
Weitere Bedenken, ob der Zeuge Ry. den Angeklagten Mulka überhaupt gekannt und den Täter, der die drei Häftlinge erschossen hat, richtig identifiziert hat, ergeben sich aus folgendem: Der Zeuge Ry. hat bei seiner Vernehmung in der Hauptverhandlung auf die Frage, woher er den Angeklagten Mulka im Zeitpunkt der Erschiessung der drei Häftlinge bereits gekannt habe, keine befriedigende Antwort geben können. Er hat erklärt, er habe ihn schon vorher drei- bis viermal in Harmense gesehen gehabt, wenn er dorthin zu Besuch gekommen sei. Auf die weitere Frage, wer ihm gesagt habe, dass der SS-Führer, der nach Harmense gekommen sei, Mulka heisst, hat der Zeuge geantwortet, die Kameraden, die auf der Hühnerfarm gearbeitet hätten, hätten jeweils telefonisch angerufen, wenn jemand auf Besuch nach Harmense gekommen sei und hätten ihnen - den Häftlingen - Bescheid gesagt. So sei ihnen auch ein paarmal der Adjutant avisiert worden. Die Kameraden hätten gesagt, dass der Adjutant komme. Auf weiteres Befragen musste der Zeuge jedoch einräumen, dass der Name Mulka von den Kameraden nicht genannt worden sei, wenn sie den Adjutanten angekündigt hätten. Die Kameraden hätten nur gesagt: "Es kommt der Adjutant." Er - der Zeuge - habe nicht gewusst, dass der Adjutant Mulka heisse. Im KL Auschwitz gab es nicht nur den Adjutanten des Lagerkommandanten Höss sondern im Wachsturmbann war ebenfalls ein Adjutant. Zur damaligen Zeit war Adjutant im Wachsturmbann ein SS-Obersturmführer namens Müller. Es wäre somit denkbar, dass der Adjutant, der dem Zeugen von Kameraden angekündigt worden ist, der SS-Führer Müller gewesen ist. Jedenfalls lässt sich das nicht ausschliessen.
Der Zeuge Ry. hat dann eine etwas weitschweifende Erklärung dafür gegeben, wie er schliesslich den Namen des Angeklagten Mulka erfahren haben will. Er habe - so hat er weiter ausgesagt - zwei- bis dreimal mit anderen Häftlingen und einem SS-Rottenführer Fische in das Kommandanturgebäude bringen müssen. Dort seien sie in die erste Etage gegangen. Normalerweise hätten sie - die Häftlinge - an der Mauer stehen bleiben müssen und hätten sich nicht rühren dürfen. Der Rottenführer sei mit den Fischen in die Kanzlei hineingegangen. Bei einem dieser Besuche, nämlich beim dritten Mal, sei er - der Zeuge - aber an eine Tür herangegangen und habe die Besuchskarte an der Tür gelesen. Darauf habe der Name des Adjutanten gestanden. Auf der Karte habe gestanden: "Hauptsturmführer Mulka Adjutant" oder: Adjutant Mulka, Hauptsturmführer". Den Mann, der hinter der Tür gesessen habe, habe er allerdings nicht gesehen. Er nehme an, dass Mulka der Adjutant sei, den er in Harmense gesehen habe und der ihm von anderen Häftlingen als Adjutant bezeichnet worden sei.
Nach dieser Aussage des Zeugen Ry. steht keineswegs fest, dass der Adjutant, den der Zeuge Ry. in Harmense gesehen hat, der Angeklagte Mulka gewesen sein muss. Denn Ry. hatte nur das Namensschild gelesen und dadurch erfahren, dass der Adjutant des Lagerkommandanten Höss Mulka heisse. Er hat sich aber nicht davon überzeugen können, dass der SS-Führer, der hinter der Tür sass, identisch sei mit dem SS-Führer und Adjutanten, den er in Harmense gesehen hat. Aus der Aussage des Zeugen Ry. ergibt sich somit zwar - wenn man die Richtigkeit seiner Angaben unterstellt -, dass der Täter, der die drei Häftlinge erschossen hat, mit dem Adjutanten, der nach Harmense zu Besuch gekommen ist, identisch gewesen ist, es steht jedoch nicht fest, dass dieser Adjutant der Angeklagte Mulka gewesen ist. Es kann auch der Adjutant Müller gewesen sein. Diese Möglichkeit liegt auch deswegen nicht so fern, weil Müller Obersturmführer war und der Zeuge Ry. bei seinem Bericht gegenüber dem Zeugen Nale. von einem SS-Obersturmführer gesprochen hat.
Ferner hat der Zeuge Ry., als ihm in der Hauptverhandlung zunächst drei Fotografien des früheren SS-Obersturmführers Müller vorgelegt wurden, auf die Frage, ob er diesen SS-Führer kenne, erklärt, es sei möglich, dass dies Mulka sei. Er erkenne ihn an den Abzeichen an der linken Brust wieder. Allerdings hat er später, als ihm die Fotografie des Angeklagten Mulka aus der damaligen Zeit vorgelegt worden ist, erklärt, das sei Mulka. Die anderen Fotografien seien ihm vorhin nicht ganz "geheuer" erschienen. Den anderen (Müller) kenne er aber auch. Es scheine ihm jedoch, dass es nicht der Mulka sei.
Das zeigt, dass der Zeuge - was nicht verwunderlich ist - keine sichere Erinnerung mehr an das Aussehen der Person, die die drei Häftlinge erschossen hat, haben kann. Wenn er schliesslich den Angeklagten Mulka auf der Fotografie erkannt haben will, so besagt das nicht viel. Denn die Fotografien der Angeklagten sind in vielen Zeitungen veröffentlicht worden, so dass dem Zeugen das Gesicht des Angeklagten aus der Zeitung oder sonstigen Veröffentlichungen bekannt gewesen sein kann.
Hinzu kommt schliesslich noch, dass auch sonst Zweifel an der Zuverlässigkeit des Erinnerungsvermögens und der Glaubwürdigkeit des Zeugen Ry. bestehen. Der Zeuge hat bei seinen verschiedenen Vernehmungen (vor dem Untersuchungsrichter und in der Hauptverhandlung) jeweils Einzelheiten geschildert, die sich widersprechen. So hat er bei seiner früheren Vernehmung erklärt - was ihm in der Hauptverhandlung vorgehalten worden ist -, der Angeklagte Mulka habe eine Brille getragen, an deren oberem Rand eine goldene Farbe gewesen sei. In der Hauptverhandlung hat er im Gegensatz dazu angegeben, dass der Angeklagte Mulka keine Brille getragen habe. Auch die Darstellung über den Besuch in dem Kommandanturgebäude, wo er das Türschild an der Tür des Adjutanten Mulka gesehen haben will, weicht erheblich und zwar in einem entscheidenden Punkt von seiner früheren Darstellung ab. In der Hauptverhandlung hat der Zeuge eindeutig erklärt, dass er nur das Türschild jedoch nicht den Mann, der hinter der Tür im Zimmer gewesen sei, gesehen habe. Bei seiner früheren Vernehmung hat der Zeuge ausgesagt, er habe den SS-Mann bis zur Tür begleitet und habe den Adjutanten Mulka gesehen, als der SS-Mann die Tür zu seinem Zimmer geöffnet habe.
Das zeigt, dass der Zeuge offensichtlich dazu neigt, Einzelheiten zu schildern, um seine Aussage glaubhaft erscheinen zu lassen, die aber einer Nachprüfung nicht standhalten.
Der Zeuge Nale. hat weiter bekundet, Ry. habe ihnen - den Häftlingen - erst nach zwei bis drei Wochen nach dem oben geschilderten Vorfall erzählt, dass er den SS-Offizier wiedergesehen habe, der die drei Häftlinge erschossen habe. Er habe erklärt, dass er den Täter wiedererkannt habe. Später - nachdem also wiederum eine gewisse Zeit verstrichen war - habe Ry. gesagt, dass der SS-Offizier, den er in Harmense als den Täter wiedererkannt habe, der Adjutant von Höss sei. Ry. habe ihm - dem Zeugen - einmal diesen SS-Führer gezeigt und ihm gesagt, dass es der Adjutant von Höss sei. Woher Ry. das gewusst habe, wisse er - der Zeuge - nicht.
Auch das spricht ebenfalls dagegen, dass der Zeuge Ry. den Angeklagten Mulka bereits im Zeitpunkt der Erschiessung der drei Häftlinge gekannt habe. Andererseits steht damit keineswegs fest, dass Mulka tatsächlich der Täter gewesen ist. Denn es kann nicht überprüft werden, ob der SS-Führer, den der Zeuge Ry. dem Zeugen Nale. als den Adjutanten Mulka bezeichnet hat, auch tatsächlich der Angeklagte Mulka gewesen ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Ry. irrtümlich einen SS-Führer (möglicherweise den Adjutanten Müller) als Mulka bezeichnet hat. Denn der Zeuge Nale. wusste nicht, woher der Zeuge Ry. den Namen des betreffenden SS-Führers erfahren hatte. Möglicherweise hat der Zeuge Ry. den betreffenden SS-Führer für Mulka gehalten, weil er ihm als Adjutant bezeichnet worden war, ohne zu bedenken, dass noch ein zweiter Adjutant, nämlich Müller, im KL Auschwitz war. Eine Personenbeschreibung des SS-Führers, den der Zeuge Ry. dem Zeugen Nale. als Mulka bezeigt hat, konnte der Zeuge Nale. nicht geben. Eine Nachprüfung, ob Ry. dem Zeugen Nale. den richtigen Namen des SS-Führers genannt hat, war daher nicht möglich. Somit kann nicht festgestellt werden, ob der Zeuge Ry. den Täter, der die drei Häftlinge erschossen hat, richtig identifiziert hat. Es kann somit auch nicht festgestellt werden, dass der Angeklagte Mulka die drei Häftlinge erschossen hat.
Der Angeklagte Mulka war daher von diesem Schuldvorwurf mangels Beweises freizusprechen.
II. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Höcker
Dem Angeklagten Höcker wird ebenso wie dem Angeklagten Mulka nicht nur eine Mitwirkung an der Massenvernichtung jüdischer Menschen, die mit sog. RSHA-Transporten nach Auschwitz deportiert worden sind, zur Last gelegt. Er soll darüber hinaus im Jahre 1944 in seiner Eigenschaft als Adjutant des Lagerkommandanten Baer auch an der Tötung einer unbestimmten Vielzahl von Häftlingen aus dem Gesamtbereich des KL Auschwitz, also von Menschen, die bereits in das Lager aufgenommen worden waren, mitgewirkt haben. Dem Angeklagten Höcker konnte jedoch über die im dritten Abschnitt unter B.II. getroffenen Feststellungen hinaus nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden, dass er weitere Tötungshandlungen in irgend einer Weise bewusst und gewollt gefördert hat.
Allerdings fiel in die Zeit seiner Adjutantentätigkeit die zweite "Liquidierung" des sog. Theresienstädter Lagers (Lagerabschnitt B II b in Birkenau). Die jüdischen Menschen, die am 20.12.1943 aus dem KL Theresienstadt nach Auschwitz deportiert und dort in dem Lagerabschnitt B II b untergebracht worden waren (vgl. 3. Abschnitt K.II.4.), wurden auf Befehl der SS-Führung ein halbes Jahr nach ihrer Ankunft in Auschwitz ebenso wie die Transporte, die bereits am 6. oder 7.9.1943 nach Auschwitz transportiert und am 8./9.3.1944 in einer der Gaskammern umgebracht worden waren, getötet. Wie der Zeuge Erich K. glaubhaft bekundet hat, wurden vor dieser zweiten "Liquidierung" der jüdischen Menschen aus Theresienstadt die arbeitsfähigen Männer und Frauen herausgesucht und auf Transport geschickt. Sie kamen irgendwo zum Arbeitseinsatz. Danach wurden die zurückgebliebenen Menschen, die im Dezember 1943 aus Theresienstadt in Auschwitz angekommen waren, mit LKWs in eine der Gaskammern gebracht und dort mit Zyklon B getötet. Dies war nach der Aussage des Zeugen Berg., der kurz vor der Räumung des Theresienstädter Lagers mit anderen Jugendlichen in den Lagerabschnitt B II d verlegt worden war, Ende Juni 1944.
In der Nacht vom 31.7. zum 1.8.1944, also auch in der Zeit, in der der Angeklagte Höcker Adjutant war, wurden ferner auf Befehl des RSHA die im sog. Zigeunerlager (Lagerabschnitt B II e) untergebrachten Zigeuner auf LKWs verladen und in die Gaskammer in Birkenau gebracht, wo sie durch Zyklon B getötet wurden. Vorher hatte man noch kräftige Zigeuner ausgesucht und in das Stammlager gebracht. Sie sollten irgendwo zum Arbeitseinsatz kommen. Über diese "Liquidierung" des Zigeunerlagers haben unter anderem die Zeugen Lei., Bej., Am. und Berg. berichtet. Auf sie wird noch bei der Erörterung weiterer Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Boger zurückzukommen sein.
Es besteht der erhebliche Verdacht, dass auch der Angeklagte Höcker an diesen Aktionen in irgend einer Weise beteiligt gewesen ist. Als Adjutant des Lagerkommandanten können ihm diese Aktionen nicht verborgen geblieben sein. Vor allem ist anzunehmen, dass er vor den Aktionen über den erforderlichen Einsatz der LKWs informiert worden ist. Da ihm die Fahrbereitschaft unterstand, besteht auch der erhebliche Verdacht, dass er entweder den Befehl für den Einsatz der LKWs gegeben oder zumindest die Genehmigung für die Verwendung der LKWs bei diesen Aktionen erteilt hat. Sichere Feststellungen konnten insoweit jedoch nicht getroffen werden. Kein Zeuge hat den Angeklagten Höcker bei den Aktionen beobachtet. Es ist auch kein Zeuge vorhanden, der Bekundungen darüber hätte machen können, dass der Angeklagte Höcker "vom Schreibtisch aus" die Aktionen gelenkt oder irgendwie beeinflusst hätte. Auch hat niemand darüber Auskunft geben können, dass der Angeklagte Höcker den Einsatz der LKWs für diese Aktion befohlen oder den Einsatz der LKWs genehmigt hat. Beweisurkunden, aus denen Rückschlüsse auf eine Beteiligung des Angeklagten Höcker an diesen Aktionen hätten gezogen werden können, sind nicht vorhanden. Das Schwurgericht war daher nicht in der Lage, konkrete Feststellungen über eine kausale Mitwirkung des Angeklagten Höcker zu treffen. Die Aktion gegen die jüdischen Menschen aus Theresienstadt und gegen die Zigeuner war Sache des RSHA, das seine Befehle und Weisungen unmittelbar an die Politische Abteilung des KL Auschwitz gab. Diese war vermutlich in erster Linie für die Durchführung der Aktionen verantwortlich. Dass man auch den Angeklagten Höcker als Adjutanten in die "Abwicklung" dieser Aktionen eingeschaltet hat, ist zwar zu vermuten, steht jedoch nicht mit Sicherheit fest. Die LKWs waren zu der Zeit, in der der Angeklagte Höcker Adjutant war, für die "Abwicklung" der RSHA-Transporte bereits generell nach Birkenau abgestellt. Mit ihnen wurden die kranken und schwachen jüdischen Menschen, die mit RSHA-Transporten ankamen, ohne dass es noch eines besonderen Einsatzbefehles durch den Adjutanten bedurft hätte, in die Gaskammern transportiert. Es ist daher möglich, dass diese LKWs auch ohne besondere Einsatzbefehle oder eine besondere Genehmigung des Adjutanten für die genannten Aktionen verwendet worden sind. Fahrbefehle waren, da es sich um Fahrten innerhalb des Konzentrationslagerbereiches handelte, nicht erforderlich. Mit Sicherheit konnte daher nicht festgestellt werden, dass der Angeklagte Höcker bewusst und gewollt kausale Tatbeiträge zu den Aktionen geleistet hat. Ebenso wenig konnte, da es an sicheren Beweisen fehlt, eine Beteiligung des Angeklagten Höcker an sonstigen Tötungshandlungen im Gesamtbereich des Konzentrationslagers Auschwitz festgestellt werden.
Der Angeklagte Höcker musste daher von dem weiteren Schuldvorwurf mangels Beweises freigesprochen werden.
III. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Boger
1.
Dem Angeklagten Boger war unter Ziffer 1 des Eröffnungsbeschlusses die Mitwirkung an Selektionen auf der Rampe, d.h. an der Vernichtung sog. RSHA-Transporte und die Mitwirkung an Selektionen im Lager zur Last gelegt. Insoweit hat das Schwurgericht im 3. Abschnitt unter C.II.1. und 2. und V. Feststellungen getroffen und den Angeklagten Boger auf Grund dieser Feststellungen verurteilt. In dem Eröffnungsbeschluss wird unter Ziffer 1 auf eine Selektion im Zigeunerlager hingewiesen, an der der Angeklagte Boger beteiligt gewesen sein soll. Hierbei kann es sich nicht um die sog. "Liquidierung" des Zigeunerlagers am 31.7./1.8.1944 handeln, da dem Angeklagten Boger eine Beteiligung an dieser Aktion unter Ziff.24 des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegt wird. Die Beweisaufnahme hat nicht ergeben, dass der Angeklagte Boger an einer bestimmten Selektion im Zigeunerlager, durch die Häftlinge zum Tode ausgewählt worden sind, beteiligt gewesen ist. Es konnte überhaupt nicht festgestellt werden, dass in dem Zigeunerlager vor der "Liquidierung" aller in dem Lager befindlichen Zigeuner eine Selektion zum Tode stattgefunden hat. Soweit vor dem 31.7.1944 Zigeuner im Zigeunerlager ausgewählt und nach dem Stammlager gebracht worden sind, hat es sich nicht um eine Selektion im Sinne des Eröffnungsbeschlusses gehandelt. Die ausgewählten Zigeuner sollten vielmehr zum Arbeitseinsatz kommen. Sie sind, soweit es festgestellt werden konnte, auch nicht getötet worden.
An der Auswahl hat der Angeklagte Boger nach der Bekundung des Zeugen van V. teilgenommen. Da die ausgewählten Zigeuner jedoch nicht getötet werden sollten und auch nach den getroffenen Feststellungen nicht getötet worden sind, hat sich der Angeklagte Boger insoweit nicht eines Mordes oder einer Beihilfe zum Mord schuldig gemacht.
Der Angeklagte Boger musste daher von dem Vorwurf, an einer Selektion d.h. der Aussonderung von Menschen zur Tötung im Zigeunerlager teilgenommen zu haben, mangels Beweises freigesprochen werden.
2.
Dem Angeklagten Boger wird unter Ziffer 3 des Eröffnungsbeschlusses über die im 3. Abschnitt unter C.II.3. und V. getroffenen Feststellungen hinaus ferner zur Last gelegt:
a. Im April 1943 bei der Erschiessung von etwa 40 sowjetischen Kommissaren, unter denen sich auch 3 Kommissarinnen befunden haben sollen, mitgewirkt zu haben, wobei er eigenhändig 5 Menschen erschossen haben soll (Ziffer 3d des Eröffnungsbeschlusses)
b. Im Block 11 zwei sowjetische Offiziere durch Genickschuss getötet zu haben (Ziffer 3f des Eröffnungsbeschlusses). (Bezügl. der unter Ziffer 3 a, b, c, e, g aufgeführten Schuldvorwürfe ist das Verfahren mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft eingestellt worden)
Auf Grund der Beweisaufnahme konnten jedoch bezüglich der unter a. und b. angeführten Schuldvorwürfe keine sicheren Feststellungen getroffen werden.
Zu a.:
In diesem Punkt hat nur der Zeuge Schei. den Angeklagten Boger belastet. Der Zeuge Schei. ist jedoch nicht glaubwürdig. Seine Aussage war widerspruchsvoll. Der Zeuge kam - wie er bei seiner Vernehmung angegeben hat - im April 1943 in die Quarantänestation im Block 11 (Erdgeschoss), weil er aus dem Lager entlassen werden sollte.
Von der Quarantänestation aus will der Zeuge einer Reihe von Erschiessungen auf dem Hof zwischen Block 10 und 11 zugesehen haben. Nach der Aktion gegen russische Kommissare befragt, gab der Zeuge Schei. zunächst folgendes an:
Mitte Mai 1943 seien russische Kommissare, unter denen 4 Frauen gewesen seien, auf Block 11 gebracht worden. Sie hätten ihre Kleider ablegen müssen und seien dann in den Keller gebracht worden. Später seien sie erschossen worden. Er selbst hat die Exekution jedoch nicht gesehen. Kameraden hätten ihm nur davon erzählt.
Diese Aussage steht im Widerspruch zu der Bekundung, die der Zeuge Schei. bei seiner polizeilichen Vernehmung vom 1.12.1959 im Ermittlungsverfahren gemacht hat. Damals hat der Zeuge angegeben, dass er die Erschiessungen der russischen Kommissare mit eigenen Augen gesehen habe. Im einzelnen hat der Zeuge damals die Erschiessungen wie folgt geschildert: "Es wurden ca. 40 russische Kriegsgefangene gebracht. Ich hörte, dass es sich um russische Kommissare handele. Unter ihnen waren auch drei weibliche Gefangene. Dass es sich um Russen gehandelt hat, weiss ich daher, weil sie am Abend zuvor in Uniform mit Lastwagen gebracht wurden. Diese Russen mussten dann ihre Uniform ausziehen und wurden nackt erschossen. Auch bei dieser Erschiessung habe ich gesehen, dass Boger mindestens fünf Russen durch Genickschuss getötet hat. Die Erschiessung der Frauen habe ich nicht gesehen. Die Gefangenen wurden durch Ja. an die "Schwarze Wand" geführt ...."
Dem Zeugen Schei. wurde dieser Absatz aus dem Protokoll über seine frühere Vernehmung in der Hauptverhandlung vorgehalten. Der Zeuge Schei. hat eingeräumt, dass er diese Angaben bei seiner früheren Vernehmung gemacht hat. Auf den Vorhalt, wie es komme, dass die frühere Schilderung erheblich von seiner Darstellung in der Hauptverhandlung abweiche, hat der Zeuge erklärt, es müsse ein Missverständnis sein. Er habe Boger nur in den Block 11 gehen sehen. Er blieb also zunächst noch dabei, dass er die Erschiessung der Kriegsgefangenen nicht mitangesehen habe. Erst später - nach einer Pause - hat dann der Zeuge unerwartet erklärt, er habe den Erschiessungen der russ. Kommissare doch zugesehen. Er habe durch das Fenster der Quarantänestation gesehen, wie insgesamt 26 Personen, 22 Männer und 4 Frauen, erschossen worden seien. Der Angeklagte Boger habe 5 Personen eigenhändig erschossen. Es seien auch andere SS-Männer dabeigewesen. Unter anderem will der Zeuge auch den Angeklagten Kaduk gesehen haben.
Auf diese widerspruchsvollen Angaben konnten keine sicheren Feststellungen gestützt werden. Es besteht der Verdacht, dass der Zeuge Schei. bei seiner früheren Vernehmung seine angeblich eigene Beobachtung erfunden hat. Wahrscheinlich hat er von der Erschiessung russischer Kommissare gehört. Sonst wäre seine ursprüngliche Aussage in der Hauptverhandlung, er habe die Exekutionen nicht selbst gesehen, nur Kameraden hätten ihm davon berichtet, nicht zu erklären. Denn wenn der Zeuge tatsächlich die Erschiessungen mit eigenen Augen gesehen hätte, hätte er das auch noch bei seiner Vernehmung in der Hauptverhandlung wissen müssen. Hierfür spricht ferner, dass der Zeuge nach dem Vorhalt aus dem Vernehmungsprotokoll vom 1.12.1959 zunächst noch bei seiner Bekundung geblieben ist, dass er die Exekution nicht selbst mitangesehen habe, sondern nur den Angeklagten Boger auf den Block 11 habe gehen sehen. Wenn der Zeuge dann später behauptet hat, er habe die Erschiessungen doch mit eigenen Augen mitangesehen, so kann dieser Aussage kein Beweiswert mehr zuerkannt werden. Irgendeine überzeugende Erklärung für die widersprüchlichen Angaben konnte der Zeuge nicht geben. Widersprüchlich sind auch die Angaben des Zeugen über die Anzahl der erschossenen Personen. Bei seiner früheren Vernehmung hat der Zeuge angegeben, es seien ca. 40 russische Kommissare gewesen, unter denen sich 3 Kommissarinnen befunden hätten. Nach seiner Aussage in der Hauptverhandlung sollen es genau 26 Personen, 22 Männer und 4 Frauen, gewesen sein. Bei seiner früheren Vernehmung hat der Zeuge angegeben, dass er die Erschiessungen der Frauen nicht gesehen habe. In der Hauptverhandlung hat er demgegenüber erklärt, dass er auch die Erschiessung von 4 Frauen gesehen habe.
Hiervon abgesehen, erscheint es auch unwahrscheinlich, dass der Zeuge vom Fenster der Quarantänestation aus ungehindert den Erschiessungen auf dem Hof zwischen Block 10 und 11 hat zusehen können. Der Zeuge hat selbst erklärt, dass es verboten gewesen sei, die Erschiessungen durch die Fenster zu beobachten. Die Häftlinge hätten die Stuben, deren Fenster auf den Hof begangen seien, räumen und auf die andere Seite des Blockes 11 hinübergehen müssen. Das hat der frühere Schreiber des Blockes 11, der Zeuge Wl. - wie oben bereits erwähnt - bestätigt. Der Zeuge Stein. hat - wie ebenfalls bereits ausgeführt - bekundet, dass die Stuben, wenn sie vor Erschiessungen von den Insassen geräumt worden seien, anschliessend abgeschlossen worden seien. Der Zeuge Stein. hat selbst auch nie gewagt, sich nach der Räumung der Stuben wieder zurückzuschleichen, um Erschiessungen zu beobachten. Der Zeuge Schei. will sich aus Neugier wieder in die Stube, von der aus Beobachtungsmöglichkeiten auf den Hof bestanden, zurückgeschlichen und trotz des strengen Verbotes Exekutionen beobachtet haben. Das erscheint unglaubhaft. Der Zeuge Schei. war für die Entlassung vorgesehen. Er musste damit rechnen, dass die verfügte Entlassung rückgängig gemacht und er schwer bestraft werden würde, wenn er am Fenster erwischt würde. Es ist kaum anzunehmen, dass er sich nur aus Neugierde dieser Gefahr ausgesetzt hat.
Weitere Bedenken gegen die Glaubwürdigkeit des Zeugen ergeben sich aus folgendem: Der Zeuge will am 9. oder 14.5.1943 Erschiessungen aus einer Stube beobachtet haben. Hierzu hat er folgende Darstellung gegeben: Vor den Erschiessungen hätten sie - die Häftlinge - zunächst die Stube räumen müssen. Er - der Zeuge - sei jedoch später wieder in seine Stube zurückgekehrt. Dort habe er gehört, wie auf dem Hof geschossen worden sei. Er habe die Schüsse gezählt. Durch das Fenster habe er dann gesehen, wie der Angeklagte Boger den Gustel Berger erschossen habe. Berger habe auf Bayrisch gerufen: "Saubande, Mordbande!" Ein anderer Häftling habe vor Boger auf den Knien gelegen und um sein Leben gefleht. Boger habe aber den Häftling, der Ludwig geheissen habe, ebenfalls durch Genickschuss getötet. Anschliessend sei er - der Zeuge - von Block 11 zum HKB gegangen, um sich dort behandeln zu lassen. Als er zurückgekommen sei, sei er nicht mehr in den Block 11 hineingekommen. Er habe sich an dem Holztor aufgestellt und habe gesehen, wie auf dem Hof zwischen Block 10 und 11 noch weitere Häftlinge erschossen worden seien.
Auch diese Schilderung des Zeugen ist nicht glaubhaft. Bedenken bestehen in diesem Fall schon deswegen, weil es unwahrscheinlich erscheint, dass sich der Zeuge vor seiner Entlassung der Gefahr einer Entdeckung ausgesetzt haben will. Noch unwahrscheinlicher erscheint es, dass der Zeuge während der Exekution den Block 11 verlassen haben will. Vor den Erschiessungen wurde jeweils Blocksperre im Block 11 angeordnet. Die im Block 11 befindlichen Häftlinge durften sich nicht frei bewegen. Häftlingen aus dem Lager wurde der Zutritt zu Block 11 nicht gestattet. Es wäre daher ungewöhnlich, wenn die SS-Angehörigen dem
Zeugen Schei. das Verlassen des Blockes gestattet haben sollten. Wenig glaubhaft erscheint auch, dass der Zeuge später am Hoftor stehend die Erschiessungen mit angesehen hat. Hier war die Gefahr der Entdeckung noch grösser. Der Zeuge hätte damit seine bevorstehende Entlassung gefährdet. Es ist nicht anzunehmen, dass er sich dieser Gefahr ohne zwingende Notwendigkeit ausgesetzt hat.
Aus den Eintragungen im Bunkerbuch ist nicht zu ersehen, dass am 9.5. oder 14.5.1943 ein Häftling namens Gustel Berger erschossen worden ist. Im Bunkerbuch ist an zwei Stellen ein Häftling namens Georg Berger, bei dem es sich wahrscheinlich um den vom Zeugen Schei. erwähnten "Gustel" Berger handelt, eingetragen. Nach diesen Eintragungen war Georg Berger das erste Mal am 3.3.1943 bis 13.3.1943 (Band I/134) im Arrestbunker inhaftiert. Dann wurde er in den HKB verlegt. Am 21.4.1943 kam er erneut in den Arrestbunker (Band II/3). Er blieb bis zum 1.9.1943. Neben diesem Datum ist ein Kreuz eingetragen. Das bedeutet nach der glaubhaften Aussage des Zeugen Pi., dass der Häftling an diesem Tag erschossen worden ist.
Nach einer weiteren Eintragung im Bunkerbuch (Band II S.1) war ferner ein Häftling namens Siegfried Berger vom 1.4. - 3.4.1943 im Arrestbunker eingesperrt. Neben dem Datum vom 3.4.1943 ist ebenfalls ein Kreuz eingetragen. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass der Häftling Siegfried Berger an diesem Tag erschossen worden ist. Keiner der beiden Häftlinge mit dem Namen Berger ist also am 9.5. oder 14.5. - wie es der Zeuge Schei. behauptet - erschossen worden. Das Schwurgericht konnte daher auf Grund der Aussage des Zeugen Schei. wegen der aufgezeigten Widersprüche und verschiedener Unwahrscheinlichkeiten in seinen Angaben keine sicheren Feststellungen zum Nachteil des Angeklagten Boger treffen, so dass der Angeklagte Boger von dem Schuldvorwurf unter Ziffer 3 d des Eröffnungsbeschlusses mangels Beweises freigesprochen werden musste.
Zu b.:
Zu diesem Anklagepunkt hat der zuverlässige Zeuge Dr. P. folgende Bekundung gemacht: Er habe einmal im Jahre 1943 beobachtet, wie der Angeklagte Boger zwei sowjetische Offiziere in den Block 11 gebracht habe. Boger habe beide von der Lagerstrasse durch die Tür in den Block 11 hineingeführt. Kurz danach seien zwei Leichenträger mit einer Trage durch das Haupttor auf den Hof zwischen Block 10 und 11 gelaufen. Nach etwa 4 bis 5 Minuten habe er - der Zeuge - zwei Schüsse gehört. Boger habe kurze Zeit später den Block 11 wiederum verlassen. Die Leichenträger seien dann mit der Trage schnell aus dem Tor heraus zu dem Block 28 gelaufen. Er - der Zeuge - sei dann aus Neugierde zu dem Leichenkeller im Block gegangen. Dort habe er oft zu tun gehabt, daher habe er sich, ohne aufzufallen, dorthin begeben können. Im Leichenkeller habe er die beiden russischen Offiziere tot in einem Sarg liegen sehen. Sie seien nackt und noch warm gewesen. Er habe sie selbst berührt, um das festzustellen.
Nach diesen vom Zeugen P. glaubhaft geschilderten Umständen kann es nicht zweifelhaft sein, dass der Angeklagte Boger die beiden sowjetischen Offiziere erschossen hat oder durch einen im Block 11 beschäftigten SS-Mann hat erschiessen lassen. Wahrscheinlich hat er die beiden Offiziere eigenhändig getötet. Denn der Zeuge P. hat ausdrücklich betont, dass kein anderer SS-Mann vor der Erschiessung der beiden Offiziere in den Block 11 hineingegangen sei und dass, nachdem die beiden Schüsse gefallen seien, kein anderer als der Angeklagte Boger den Block wieder verlassen habe. Möglich ist jedoch, dass der Angeklagte Boger die Exekution durch einen im Block 11 befindlichen SS-Mann, etwa den Arrestaufseher, hat vollziehen lassen. Das kann aber dahingestellt bleiben; denn der Angeklagte Boger hat, da er die beiden Offiziere auf Block 11 gebracht hat, auf jeden Fall kausale Tatbeiträge zu dem Tod der beiden Offiziere geleistet, auch wenn er sie nicht eigenhändig erschossen hat.
Gleichwohl konnte der Angeklagte Boger in diesem Fall nicht wegen Mordes oder Totschlags verurteilt werden. Denn es war nicht zu klären, welches die Hintergründe dieser Erschiessung gewesen sind. Bei den beiden russ. Offizieren kann es sich nicht um russische Kriegsgefangene gehandelt haben, die bereits in das Lager aufgenommen worden waren. Denn sonst hätten sie Häftlingskleidung getragen. Nach der Bekundung des Zeugen P. waren sie noch in Offiziersuniform. Wahrscheinlich sind sie von irgend einer Gestapoleitstelle oder einem Einsatzkommando zum Zwecke der "Liquidierung" in das KL Auschwitz eingeliefert worden.
Es ist zu vermuten, dass sie auf Grund des OKW-Befehls vom 6.6.1941 getötet worden sind, weil sie in der Roten Armee die Funktion eines politischen Kommissars ausgeübt haben (vgl. 2. Abschnitt VII.3.). Mit Sicherheit steht dies jedoch nicht fest. Denn der Zeuge P. hat nicht behauptet, dass die beiden russ. Offiziere Politkommissare gewesen seien. Er hat nur von "russischen Offizieren" gesprochen. Es bestehen zwar keine Anhaltspunkte dafür, dass gegen die beiden Offiziere durch irgendein Gericht Todesurteile verhängt worden waren. Es erscheint auch unwahrscheinlich. Die Möglichkeit, dass man gegen die Offiziere wegen irgendwelcher "Vergehen" ein gerichtliches Verfahren durchgeführt und sie zum Tode durch Erschiessen verurteilt hat, war jedoch nicht mit Sicherheit auszuschliessen. Die Erschiessung der beiden Offiziere kann die Vollstreckung eines solchen Todesurteils gewesen sein, wobei nicht zu klären ist, ob dieses Todesurteil rechtmässig ergangen ist oder wegen Verstosses gegen anerkannte Rechtsgrundsätze als rechtswidrig angesehen werden muss. Schon aus diesem Grund war eine Verurteilung des Angeklagten Boger nicht möglich.
Der Angeklagte hat - davon muss man zu seinen Gunsten ausgehen - die beiden russischen Offiziere auf Befehl getötet bzw. töten lassen. Denn wenn sie, wofür alles spricht, von ausserhalb nur deswegen in das Lager eingeliefert worden sind, damit sie getötet würden, kann nicht angenommen werden, dass der Angeklagte Boger eigenmächtig gehandelt hat. Von wem er den Erschiessungsbefehl erhalten hat, war nicht zu klären. Der Angeklagte Boger hat zur Aufklärung dieses Falles nicht beigetragen. Er bestreitet überhaupt, die beiden russischen Offiziere erschossen zu haben. Es konnte daher auch nicht geklärt werden, ob man ihm den Grund für die Tötung der Offiziere gesagt hat. Möglich ist immerhin, dass man ihn über die Hintergründe des Tötungsbefehls im Unklaren gelassen hat und er - wenn auch irrig - angenommen hat, die Tötung sei rechtmässig. Jedenfalls konnte ihm nicht nachgewiesen werden, dass er klar erkannt hat, dass der Befehl, die beiden Offiziere zu töten, ein allgemeines Verbrechen bezweckte. Das wäre aber Voraussetzung für seine strafrechtliche Verantwortlichkeit und seine Verurteilung (§47 MStGB), wenn man einmal unterstellt, dass die Tötung der beiden russischen Offiziere rechtswidrig war. Es genügt nicht, dass er hätte erkennen müssen, dass die Tötung der beiden russischen Offiziere ein allgemeines Verbrechen darstellte.
Eine Verurteilung des Angeklagten Boger in diesem Fall scheitert daher daran, dass weder in objektiver noch subjektiver Hinsicht sichere Feststellungen getroffen werden konnten.
Der Angeklagte Boger war daher auch in diesem Fall mangels Beweises freizusprechen.
3.
Dem Angeklagten Boger wird unter Ziff.4 des Eröffnungsbeschlusses über die im 3. Abschnitt unter C.II.4. getroffenen Feststellungen hinaus noch zur Last gelegt,
a. im Februar 1943 während einer Vernehmung den Häftling Janicki auf der sog. "Bogerschaukel" so schwer misshandelt zu haben, dass er am nächsten Tag gestorben sei (Ziffer 4b des Eröffnungsbeschlusses),
b. den Häftling Wroblewski nach einer Misshandlung auf der sog. "Bogerschaukel" im Bunker des Blockes 11 erschossen zu haben, weil er bei ihm einen verrosteten Revolver gefunden habe (Ziffer 4c des Eröffnungsbeschlusses),
c. im Sommer 1943 nach einem Brand in den DAW einen jungen polnischen Häftling in einem Raum der DAW bei einer Vernehmung so schwer misshandelt zu haben, dass der Häftling unmittelbar danach gestorben sei (Ziffer 4e des Eröffnungsbeschlusses),
d. im Jahre 1943 einen polnischen Häftling, der im Verdacht gestanden habe, Fleisch gestohlen zu haben, derart misshandelt zu haben, dass der Häftling noch am gleichen Tag im Revier gestorben sei (Ziffer 4f),
e. im Jahre 1943 den polnischen Häftling Jan Lupa während des Verhörs durch Misshandlungen getötet zu haben (Ziffer 4g des Eröffnungsbeschlusses) (In den Punkten 4h und 4i ist das Verfahren mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft eingestellt worden).
In all diesen Punkten konnte der Angeklagte Boger trotz erheblichen Verdachtes nicht mit Sicherheit überführt werden.
Zu a:
Zu diesem Anklagepunkt haben die Zeugen Bro., Se. und Krx. Aussagen gemacht. Über den Zeugen Bor. sind bereits im 3. Abschnitt C.IV.4. Ausführungen gemacht worden. Der Zeuge Bor. ist - wie das Schwurgericht an Hand des Bunkerbuches festgestellt hat - am 17.12.1942 in den Arrestbunker eingeliefert worden und war bis zum 9.3.1943 inhaftiert. Der Zeuge hat glaubhaft bekundet, dass er am 17.12.1942 auf Anordnung der Politischen Abteilung durch den Rapportführer Palitzsch wegen des Verdachtes Mitglied einer Untergrundorganisation zu sein, verhaftet worden sei. Er sei zunächst - so hat der Zeuge weiter ausgesagt - in den Block 11 gebracht worden. Dann sei er in der Politischen Abteilung vernommen worden. Als er zur Vernehmung in das Zimmer des SS-Untersturmführers Wosnitza, der Stellvertreter des Leiters der Politischen Abteilung, Grabner, gewesen ist, geführt worden sei, sei gerade sein Freund, der Häftling Janicki aus dem Zimmer herausgetragen worden. Dann habe man Janicki an die Wand "geschmissen". Nähere Angaben konnte der Zeuge Bor. nicht machen.
Aus dieser Aussage des Zeugen Bor. ergibt sich zwar, dass Janicki zuvor vernommen und schwer misshandelt worden sein muss. Es konnte jedoch nicht festgestellt werden, dass Janicki an diesen Misshandlungen gestorben ist. Denn die Vernehmung des Janicki muss noch im Dezember 1942 gewesen sein, da Bor. kurz nach seiner Einlieferung in den Block 11 vernommen worden ist. Ausweislich des Bunkerbuches war der Häftling Janicki vom 17.12.1942 bis zum 16.2.1943 inhaftiert. Neben dem Datum vom 16.2.1943 befindet sich der Vermerk: "verstorben". Es kann daher nicht zweifelhaft sein, dass Janicki an diesem Tag gestorben ist. Von der Misshandlung im Dezember 1942 bis zum Tode des Häftlings Janicki sind somit einige Wochen vergangen. Eine Kausalität zwischen der Misshandlung im Dezember 1942 und dem Tode des Häftlings Janicki im Februar 1943 kann daher nicht festgestellt werden. Janicki ist auch noch einmal im Januar 1943 vernommen worden. Das zeigt, dass er sich in der Zwischenzeit von der Misshandlung im Dezember 1942 wieder erholt haben muss.
Dass Janicki noch einmal im Januar vernommen worden ist, ergibt sich aus der Aussage des Zeugen Se. Se. hat glaubhaft bekundet, dass er zwischen dem 12.1. und 20.1.1943 verhaftet und zur Vernehmungsbaracke der Politischen Abteilung gebracht worden sei. Ausser ihm seien - so hat der Zeuge Se. weiter ausgesagt - noch zwei weitere Häftlinge zur Vernehmungsbaracke der Politischen Abteilung geführt worden. Einer dieser beiden sei der Georg Janicki gewesen. Er - Se. - habe zunächst auf dem Gang der Vernehmungsbaracke mit dem Gesicht zur Wand mit den beiden anderen Häftlingen warten müssen. Dann sei Georg Janicki in das Vernehmungszimmer des Angeklagten Boger hineingeführt worden. Er - Se. - habe Schläge und Schreie gehört. Nach einer Stunde sei Janicki blutüberströmt aus dem Zimmer "herausgeschmissen" worden. Hinter ihm sei Boger aus dem Zimmer herausgekommen. Später habe er - Se. - den Janicki nicht mehr gesehen. Von der Schreibstube habe er gehört, dass er gestorben sei. Dass diese Misshandlung des Janicki, die nach den vom Zeugen Se. geschilderten Umständen durch Boger erfolgt sein muss, zum Tode des Janicki geführt hat, konnte ebenfalls nicht festgestellt werden. Denn sie muss nach der Aussage des Zeugen Se. in der Zeit zwischen dem 12.1. und 20.1.1943 erfolgt sein. Janicki hat aber ausweislich des Bunkerbuches noch bis zum 16.2.1943 gelebt, so dass eine Kausalität zwischen der Misshandlung und dem Tode des Janicki nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann.
Schliesslich hat noch der Zeuge Krx. von einer Vernehmung berichtet, bei der der Zeuge Janicki auf der Schaukel schwer misshandelt worden sei. Der Zeuge Krx. hat ausgesagt, dass er im Dezember 1942 verhaftet worden sei. Unmittelbar danach sei er von der Politischen Abteilung vernommen und bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen worden. Anschliessend sei er in den Arrestbunker eingeliefert worden. Insoweit kann der Aussage des Zeugen gefolgt werden. Denn aus der den Zeugen Krx. betreffenden Eintragung im Bunkerbuch Band I/98 ergibt sich, dass der Zeuge vom 18.12.1942 bis zum 15.2.1943 im Block 11 inhaftiert war. Am 15.2.1943 ist er in das Lager entlassen worden. Der Zeuge Krx. hat dann weiter bekundet, dass er in der folgenden Zeit täglich oder einen über den anderen Tag - 60 Tage lang - verhört worden sei. Bei einer dieser Vernehmungen sei auch der Häftling Janicki dabeigewesen. Der Zeuge Krx. hat diese Vernehmung wie folgt geschildert: Mehrere Häftlinge hätten in der Vernehmungsbaracke auf dem Korridor in einer Reihe gestanden. Der erste in der Reihe sei Janicki, der zweite in der Reihe ein Häftling namens Wroblewski gewesen. Hinter Wroblewski habe er - der Zeuge - gestanden. Hinter ihm - dem Zeugen - hätten noch weitere Häftlinge auf ihre Vernehmung gewartet. Boger und andere SS-Männer hätten zunächst den Häftling Janicki verhört. Janicki sei auf die sog. Bogerschaukel gebracht und dann von zwei SS-Männer abwechselnd geschlagen worden. Aus Janicki sei "Hackfleisch" gemacht worden. Man habe ihn mit 70 cm langen Stöcken aus "Südbäume" (wahrscheinlich Bambus) geschlagen. Boger habe Janicki nach dem Schlagen von der Schaukel abgenommen und auf den Korridor "geschmissen". Später hätten sie - die Häftlinge - den Janicki in seinem Mantel in den Bunker zurückgebracht. Alle seien sie in die Zelle Nr.20 gekommen. In der Nacht sei Janicki gestorben.
Gegen die Zuverlässigkeit der Angaben des Zeugen Krx. bestehen Bedenken. Hierzu kann auf die Ausführungen über die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit des Zeugen Krx. im 3. Abschnitt unter E.IV.2. verwiesen werden. Auch im Falle Janicki erscheint es nicht sicher, dass Krx. alles, was er geschildert hat, selbst erlebt hat. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er vieles, was er von anderen damals im Lager gehört hat, als eigenes Erleben wiedergibt, ohne dass nachgeprüft werden kann, dass seine Angaben stimmen. Wann die Vernehmung, nach welcher der Janicki in der Nacht gestorben sein soll, stattgefunden hat, konnte der Zeuge Krx. nicht angeben. Er hat gemeint, es sei eine Woche vor seiner Entlassung gewesen. Da der Zeuge Krx. am 15.2.1943 aus dem Bunker entlassen worden ist, hätte sie am 8.2.1943 sein müssen. Janicki ist aber ausweislich des Bunkerbuches am 16.2.1943 gestorben. Demnach könnte der Janicki nicht unmittelbar nach der Vernehmung gestorben sein. Ferner könnte der Zeuge Krx. den Tod des Häftlings Janicki gar nicht als Augenzeuge erlebt haben, wenn die Eintragungen im Bunkerbuch richtig sind, woran zu zweifeln kein Anlass besteht. Auf Grund der Eintragung im Bunkerbuch steht zwar fest, dass Janicki am 16.2.1943 verstorben ist. Wegen der aufgezeigten Bedenken gegen die Zuverlässigkeit und die Glaubwürdigkeit des Zeugen Krx. konnte jedoch nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass der Tod des Häftlings Janicki durch eine Misshandlung des Angeklagten Boger herbeigeführt worden ist, wenn hierfür auch ein erheblicher Verdacht besteht.
Eine Verurteilung des Angeklagten Boger war daher nicht möglich. Er musste auch von diesem Anklagepunkt mangels Beweises freigesprochen werden.
Zu b:
Nach der Aussage des Zeugen Krx. soll der Angeklagte Boger den Häftling Wroblewski im Arrestbunker mit der Pistole erschossen haben. Der Zeuge will die Erschiessungen mit eigenen Augen gesehen haben. Wroblewski sei - so hat der Zeuge Krx. in der Hauptverhandlung bekundet - am Tage zuvor nach der Vernehmung des Häftlings Janicki (siehe oben) ebenfalls auf der Schaukel von zwei SS-Männern im Beisein des Angeklagten Boger schwer misshandelt worden. Die Darstellung, die der Zeuge Krx. in der Hauptverhandlung über die Erschiessung des Wroblewski durch den Angeklagten Boger gegeben hat, ist bereits oben im 3. Abschnitt unter E.IV.2. wiedergegeben worden. Dort ist bereits darauf hingewiesen worden, dass der Zeuge Krx. früher gegenüber dem Zeugen Sm. eine andere Darstellung über die Erschiessung des Wroblewski gegeben hat. Beide Darstellungen weichen erheblich voneinander ab. Aus diesem Grunde bestehen Bedenken, ob die Aussage des Zeugen Krx. der Wahrheit entspricht, abgesehen von weiteren im 3. Abschnitt E.IV.2 angeführten Gründen, die an der Zuverlässigkeit der Angaben des Zeugen Krx. Zweifel aufkommen lassen. Sichere Feststellungen konnten daher auf Grund der Aussage des Zeugen Krx. nicht getroffen werden.
Der Angeklagte Boger musste daher auch von diesem Anklagepunkt mangels Beweises freigesprochen werden.
Zu c:
Zu diesem Anklagepunkt hat nur der Zeuge Krona. Angaben gemacht. Der Zeuge hat nach seiner Aussage vor dem zweiten Weltkrieg in Ostrolenka/Polen als selbständiger Schreinermeister gelebt. Er hatte die deutsche Staatsangehörigkeit. Nach Ausbruch des zweiten Weltkrieges und der Besetzung der polnischen Gebiete durch deutsche Truppen war der Zeuge einige Zeit als Bürgermeister in Ostrolenka eingesetzt. Eines Tages wurde er wegen des Verdachts der Spionage verhaftet. Im Herbst 1941 wurde er in das KL Auschwitz eingeliefert. Im KL Auschwitz hat er vornehmlich als Schreiber gearbeitet. Meist war er in den deutschen Ausrüstungswerken (DAW) beschäftigt.
Der Zeuge hat in der Hauptverhandlung behauptet, dass der Angeklagte Boger einen in den DAW beschäftigten Häftling so geschlagen habe, dass der Häftling unmittelbar danach gestorben sei. Im einzelnen hat er hierzu folgendes ausgesagt: Im Jahre 1943 sei auf dem Dachboden der DAW ein Brand entstanden. Man habe 6 Häftlinge, die in den DAW einen Fahrstuhl bedient hätten, verdächtigt, diesen Brand gelegt zu haben. Man habe das als Sabotage ausgelegt. Die 6 Häftlinge seien von der Politischen Abteilung aus den DAW herausgeholt worden. Einen der 6 Häftlinge habe der Angeklagte Boger in einem Zimmer der DAW vernommen. Nach der Vernehmung habe er - der Zeuge Krona. - den Häftling auf dem Hof gesehen. Der Häftling habe sich an einem auf dem Hof stehenden Flammenwerfer festgehalten. Er sei völlig zerschlagen gewesen und habe im Gesicht und am Körper geblutet. Er sei dann gestorben. Seine letzten Worte seien gewesen: "Boger, Boger!"
Wenn auch dem Angeklagten Boger nach seinem sonstigen Verhalten im KL Auschwitz und insbesondere nach seinen Vernehmungsmethoden, die er nach den getroffenen Feststellungen anzuwenden pflegte, ohne weiteres zuzutrauen ist, in diesem vom Zeugen Krona. geschilderten Fall einen Häftling so geschlagen zu haben, dass er unmittelbar nach der Vernehmung verstarb, konnte das Schwurgericht nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass der Angeklagte Boger in diesem Fall der Täter gewesen ist. Die Möglichkeit, dass ein anderer SS-Angehöriger die Vernehmung durchgeführt und den Häftling misshandelt hat und dass der Zeuge Krona. heute - nach Ablauf eines Zeitraumes von über 20 Jahren seit dem damaligen Geschehen - das Erlebnis guten Glaubens irrtümlich mit dem Angeklagten Boger in Verbindung bringt, konnte nicht ausgeschlossen werden.
Diese Möglichkeit muss deswegen in Betracht gezogen werden, weil sich der Zeuge Krona. auch in anderer Hinsicht geirrt und eigene Erlebnisse nachweislich zu Unrecht mit dem Angeklagten Boger in Verbindung gebracht hat. Der Zeuge war ausweislich des Bunkerbuches (Band I Seite 62) vom 22.5. bis 8.6.1942 im Arrestbunker inhaftiert. Er hat in der Hauptverhandlung angegeben, dass er wegen der verbotenen Beförderung eines Briefes für einen Bekannten von der Politischen Abteilung in den Arrestbunker für ca. 4 Wochen eingeliefert worden sei. Eines Tages sei er entlassen worden. Der Angeklagte Boger habe zu ihm bei der Entlassung gesagt: "Jakob Du hast Glück gehabt, dass in dem Brief nur familiäre Sachen gestanden haben." Hier muss sich der Zeuge irren. Der Angeklagte Boger kann bei der Entlassung des Zeugen nicht anwesend gewesen sein. Denn der Angeklagte Boger ist erst im Dezember 1942 nach Auschwitz gekommen. Im August 1942 war er noch in Dresden. Der Zeuge Josef Kil. hat glaubhaft bekundet, dass er den Angeklagten Boger, den er aus seinem Einsatz im Frühjahr 1942 am Wolchow (Russland) gekannt habe, im August 1942 bei dem SS-Pionierers.Btl. 1 in Dresden wiedergetroffen habe. Er sei mit ihm im August 1942 auch ein- oder zweimal ausgegangen. Damit hat der Zeuge die Einlassung des Angeklagten Boger bestätigt, der behauptet hat, er sei im Juli 1942 aus dem Reservelazarett entlassen und zu dem SS-Pionierers.Batl. 1 nach Dresden versetzt worden, wo er auch später noch mit dem Zeugen Kil. zusammen gewesen sei.
Im Juni 1942 kann daher der Angeklagte Boger noch nicht im KL Auschwitz gewesen sein. Der Zeuge Krona. muss einem Irrtum zum Opfer gefallen sein. Wahrscheinlich hat ein anderer Angehöriger der Politischen Abteilung zu dem Zeugen die zitierte Bemerkung gemacht, und der Zeuge bringt sie heute aus nicht näher zu erforschenden Gründen irrtümlich mit dem Angeklagten Boger in Verbindung.
Der Zeuge Krona. hat weiter bekundet, dass er nach der Entlassung aus dem Arrestbunker für 3 Monate in die SK eingeliefert worden sei. Er hat gemeint, dass ihm diese Strafe für den verbotenen "Briefschmuggel" von Grabner zudiktiert worden sei. Da der Zeuge am 8.6.1942 aus dem Arrest entlassen worden ist, muss er vom 8.6. bis 8.9.1942 in der SK gewesen sein. Der Zeuge hat geschildert, dass in der SK, die am Königsgraben hätte arbeiten müssen, eines Tages ein "Aufstand" gemacht worden sei. 11 bis 12 Häftlinge seien entflohen. Am nächsten Tag seien einige "Herren" aus der Politischen Abteilung nach Birkenau in den Block I (Lagerabschnitt B I a), in dem die SK untergebracht gewesen sei, gekommen und hätten wegen des Aufstandes Vernehmungen durchgeführt. Da keiner der Häftlinge aus der SK etwas habe sagen wollen, hätten sie sich - die Häftlinge aus der SK - auf dem Hof mit dem Gesicht zur Wand aufstellen müssen. Aumeier, Boger und Grabner hätten dann wahllos einfach die Leute von hinten erschossen. Er - der Zeuge - hätte geglaubt, dass er auch jeden Moment erschossen werde. Er habe allerdings nicht gesehen, ob Boger auch geschossen habe.
Der Zeuge hat also auch in diesem Fall behauptet, dass der Angeklagte Boger an der Erschiessung der Häftlinge beteiligt gewesen sei. Auch insoweit muss sich der Zeuge irren. Denn der Angeklagte Boger war zu dieser Zeit (zwischen 8.Juni und 8.September 1942) noch nicht im KL Auschwitz.
Wenn aber der Zeuge zwei eigene persönliche Erlebnisse zu Unrecht mit dem Angeklagten Boger in Verbindung bringt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er auch im Falle der Misshandlung des Häftlings aus den DAW den Angeklagten Boger - wenn auch guten Glaubens - zu Unrecht belastet hat. Auf Grund seiner Aussagen konnte daher das Schwurgericht keine sicheren Feststellungen zum Nachteil des Angeklagten Boger treffen.
Der Angeklagte Boger war daher auch von dem Vorwurf, einen jungen polnischen Häftling in einem Raum der DAW so schwer misshandelt zu haben, dass der Häftling daran gestorben sei, mangels Beweises freizusprechen.
Zu d:
Zu diesem Anklagepunkt hat nur der Zeuge Wey. Angaben gemacht. Dieser Zeuge kam nach seiner Aussage bereits im Jahre 1940 in das KL Auschwitz, als das Lager noch im Aufbau war. Er erhielt die Häftlingsnummer 3215. Er wurde der Glaserei als Kapo zugeteilt. Später kam er als Vorarbeiter in die Malerei. Der Zeuge hat bei seiner Vernehmung in der Hauptverhandlung ausgesagt, dass einmal im Jahre 1942 oder 1943 von dem Schlachthaus, das schräg gegenüber ihrer Werkstatt gelegen habe, Fleisch gestohlen worden sei. Boger sei daraufhin mit zwei anderen SS-Männern in die Malerei gekommen, um den Dieb zu ermitteln. Alle drei hätten die ganze Werkstatt und das Magazin durchsucht. In dem Magazin hätten sie den Häftling, der im Verdacht des Diebstahls gestanden habe, gefunden. Boger habe den Häftling zwei bis dreimal mit dem Ellenbogen in den Körper gestossen. Es sei die Taktik des Angeklagten Boger gewesen, Häftlinge mit dem "Ellenbogen zu schlagen". Der Häftling habe dann Blut gebrochen. Er sei in den HKB eingeliefert worden. Am Abend habe ihm - dem Zeugen - der Häftlingsarzt, dessen Name der Zeuge nicht mehr wusste, mitgeteilt, dass der Häftling gestorben sei. Bei dem Opfer habe es sich um einen älteren Häftling gehandelt, der aber in einem guten körperlichen Zustand gewesen sei. Denn die in den Werkstätten beschäftigten Häftlinge hätten reichlich Verpflegung bekommen. Der Angeklagte Boger hat zu dieser Aussage des Zeugen erklärt, er erinnere sich genau, dass er die Baracke durchsucht habe. Das sei jedoch nicht wegen eines Fleischdiebstahls geschehen. Mit solchen "Lappalien" habe er sich nicht abgegeben. Es habe sich vielmehr um eine Widerstandsangelegenheit gehandelt. Er - Boger - nehme an, dass es später auch zu einer Exekution gekommen sei. Er habe jedoch bei dieser Gelegenheit keinen Häftling totgeschlagen. Er habe auch niemanden zusammengeschlagen. Es sei allerdings möglich, dass einer der beiden anderen SS-Männer den Häftling zusammengeschlagen habe.
Das Schwurgericht konnte aus der Aussage des Zeugen Wey. nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass der Angeklagte Boger einen Häftling im Magazin in der vom Zeugen Wey. geschilderten Weise geschlagen hat. Der Zeuge hat behauptet, es sei die "Taktik" des Angeklagten Boger gewesen, Häftlinge mit dem Ellenbogen zu schlagen. Das ist von keinem anderen Zeugen bestätigt worden. Wie sich aus der Beweisaufnahme ergeben hat, hat der Angeklagte Boger Häftlingen bei Vernehmungen Ohrfeigen gegeben, er hat sie, um Aussagen zu erpressen, mit den Fäusten geschlagen und mit den Stiefeln getreten und hat sie im übrigen, um sie zu einer Aussage zu zwingen, mit Stöcken oder einem Ochsenziemer geschlagen oder schlagen lassen. Von "Ellenbogenschlägen" des Angeklagten Boger hat jedoch kein Zeuge berichtet. Woher der Zeuge Wey. die Kenntnis von der "Taktik" des Angeklagten Boger gehabt haben will, hat er nicht näher erläutert. Er hat nicht behauptet, dass er den Angeklagten Boger in sonstigen Fällen bei ähnlichen Misshandlungen gesehen habe. Seine Aussage muss daher nach Auffassung des Schwurgerichts mit besonderer Vorsicht beurteilt werden. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass der Zeuge insoweit übertreibt. Möglich erscheint auch, dass einer der beiden anderen SS-Männer den Häftling mit dem Ellenbogen gestossen hat und dass der Zeuge nachträglich - vielleicht guten Glaubens infolge der seitdem verflossenen langen Zeit von über 20 Jahren - die Misshandlung des Häftlings zu Unrecht auf den Angeklagten Boger projiziert.
Im übrigen könnte, auch wenn die Aussage des Zeugen Wey. der Wahrheit entsprechen sollte, nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass der Angeklagte Boger in diesem Fall den Häftling mit den zwei bis drei Ellenbogenstössen töten wollte. Ebensowenig könnte mit jedem Zweifel ausschliessender Sicherheit festgestellt werden, dass der Angeklagte Boger damit gerechnet und es billigend in Kauf genommen hat, dass der Häftling infolge der zwei bis drei Ellenbogenstösse sterben könnte. Denn dieser Fall liegt anders als die oben im dritten Abschnitt unter C.II.4. festgestellten Fälle. Dort hat der Angeklagte Boger die Häftlinge in erheblich stärkerem Umfang misshandelt. Die Misshandlungen erfolgten bei sog. verschärften Vernehmungen, deren Ziel es war, Geständnisse und Aussagen zu erpressen. Die Misshandlungen verfolgten also zunächst einen bestimmten Zweck. Wenn der Angeklagte Boger nicht zu dem erhofften Ergebnis kommen konnte, schlug er immer weiter auf die Häftlinge ein bzw. liess auf sie einschlagen, bis sie bewusstlos oder bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet waren. In dem vom Zeugen Wey. geschilderten Fall hat der Angeklagte Boger den Häftling überhaupt nicht vernommen. Dass zwei bis drei Ellenbogenstösse zum Tode eines Menschen, der sich in guter körperlicher Verfassung befindet, führen können, ist nicht ohne weiteres anzunehmen, es sei denn, es handele sich um ganz gezielte wuchtige Stösse gegen besonders empfindliche Körperstellen. Dass der Angeklagte Boger dem Häftling solche gezielte Ellenbogenstösse versetzt hätte, hat der Zeuge nicht bekundet.
Wenn der Häftling nach den zwei bis drei Ellenbogenstössen Blut gespuckt hat, so ist das noch kein sicherer Beweis dafür, dass der Angeklagte Boger bewusst den Häftling lebensgefährlich verletzten wollte. Er kann den Häftling auch unbeabsichtigt so unglücklich getroffen haben, dass innere Verletzungen eingetreten sind.
Dem Angeklagten Boger könnte daher, auch wenn man dem Zeugen Wey. folgen würde, der Tötungsvorsatz (direkter oder bedingter Vorsatz) nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden, so dass eine Verurteilung wegen Mordes oder Totschlags nicht erfolgen könnte. Der Angeklagte Boger war daher auch in diesem Fall mangels Beweises freizusprechen.
Die Frage, ob sich der Angeklagte Boger einer Körperverletzung mit Todesfolge (§225 StGB) schuldig gemacht hat und ob diese Straftat verjährt wäre, braucht nicht näher untersucht zu werden, da das Schwurgericht nicht die sichere Überzeugung gewinnen konnte, dass der Angeklagte Boger dem Häftling die Ellenbogenstösse gegeben hat.
Zu e:
Zu diesem Anklagepunkt konnte das Schwurgericht auf Grund der Beweisaufnahme keine Klarheit gewinnen. Aus dem Bunkerbuch (I Seite 95) ergibt sich, was in der Hauptverhandlung an Hand der den Häftling Jan Lupa betreffenden Eintragung festgestellt worden ist, dass der Häftling Jan Lupa am 3.3.1943 in den Arrestbunker eingeliefert und am 9.3.1943 aus dem Bunker wieder entlassen worden ist.
Der Zeuge Bor., der ebenfalls am 9.3.1943 aus dem Bunker entlassen worden ist, hat bekundet, dass er am Entlassungstag den ihm bekannten Jan Lupa auf dem Korridor des Blockes 11 habe liegen sehen. Jan Lupa habe Blut gespuckt. Er - der Zeuge - nehme an, dass Jan Lupa zuvor von dem Angeklagten Boger in der Blockführerstube misshandelt worden sei. Denn der Angeklagte Boger sei aus der Blockführerstube des Blockes 11 herausgekommen und habe zu dem auf dem Boden liegenden Jan Lupa gesagt: "Er hat für heute genug." Dabei habe Boger noch nach dem Häftling getreten.
Der Zeuge konnte keine sicheren Angaben darüber machen, ob Jan Lupa auf dem Korridor des Blockes 11 gestorben ist. Er habe zwar - so hat er ausgesagt - nach dem Eindruck, den der am Boden liegende Jan Lupa auf ihn gemacht habe, angenommen, dass dieser bereits tot sei. Der Zeuge Bor. hat aber hinzugefügt, dass er kein Arzt sei und den Tod eines Menschen nicht mit Sicherheit feststellen könne.
Die Annahme des Zeugen Bor., Jan Lupa sei bereits auf dem Korridor des Blockes 11 gestorben, kann jedoch nicht richtig sein. Dagegen spricht zunächst der Entlassungsvermerk im Bunkerbuch. Wäre Jan Lupa bereits im Block 11 gestorben, hätte der Blockschreiber - wie in anderen Fällen - sicherlich vermerkt: "verst." Bei der den Häftling Jan Lupa betreffenden Eintragung ist jedoch neben dem Datum vom 9.3.1943 vermerkt: "entl." Ferner will der Zeuge So. den Häftling Jan Lupa noch im Mai 1943 gesehen haben. Der Zeuge, der als Häftlingspfleger im Block 21 des HKB beschäftigt war, hat ausgesagt, dass Jan Lupa von einem Arzt wegen einer Phlegmone in den HKB eingeliefert worden sei. Eines Tages seien die SS-Unterführer Lachmann und Dylewski erschienen und hätten Jan Lupa abgeholt. Nach einigen Stunden sei Jan Lupa völlig zerschlagen zurückgebracht worden. Er - der Zeuge - habe noch mit Jan Lupa gesprochen. Er habe ihn gefragt, wer ihn so zugerichtet habe. Jan Lupa habe geantwortet: "Lachmann und Dylewski." Kurze Zeit später sei Jan Lupa gestorben.
Der Zeuge Sew. hat dagegen eine ganz andere Darstellung gegeben. Der Zeuge hat behauptet, Jan Lupa sei von dem Angeklagten Boger im März 1943 verhaftet und auf der Politischen Abteilung misshandelt worden. Dann sei er in den Bunker gebracht worden. Da Jan Lupa jedoch nicht vernehmungsfähig gewesen sei, sei er aus dem Bunker in die chirurgische Abteilung des Blockes 21 gebracht worden. Dort sei er zwischen dem zweiten und dritten Bett unter den Armen und Beinen aufgehängt worden, weil er nicht habe liegen können. Er - der Zeuge Sew. - habe Jan Lupa noch auf Block 21 besucht. Bei dieser Gelegenheit habe ihm Jan Lupa erzählt, dass Boger ihn verhaftet
und vernommen und dann in den Block 11 geschickt habe. Der Pfleger im HKB habe ihm - dem Zeugen - und seinen Kameraden gesagt, Jan Lupa könne nur gerettet werden, wenn er eine Blutübertragung erhalte. Er - der Zeuge - und weitere Häftlinge seien zu einer Blutspende bereit gewesen und seien daher am nächsten Tag erneut in den Block 21 gegangen. Plötzlich sei jedoch Boger gekommen. Sie seien daher aus Angst geflüchtet. Später seien sie zurückgekehrt. Jan Lupa sei jedoch bereits tot gewesen. Allerdings habe er - so hat der Zeuge auf Befragen eingeräumt - die Leiche nicht gesehen. Man habe die Leiche bereits weggebracht gehabt.
Ob diese Angaben des Zeugen Sew. der Wahrheit entsprechen, erscheint zweifelhaft. Denn bei seiner früheren Vernehmung im Ermittlungsverfahren hat der Zeuge behauptet, was ihm in der Hauptverhandlung vorgehalten und von ihm bestätigt worden ist, dass Boger in die Krankenstube hereingekommen sei, als er - der Zeuge - mit seinen Kameraden bei Jan Lupa gewesen sei und ihnen befohlen habe, die Krankenstube zu verlassen. Sie seien daraufhin hinausgegangen. Nach einer Weile sei Boger aus dem Block 21 herausgekommen. Nun seien sie - die Häftlinge - wieder zu Jan Lupa hineingegangen. Jan Lupa habe jedoch schon tot auf dem Bett gelegen. Die Pfleger hätten ihm - dem Zeugen Sew. - erzählt, dass Boger veranlasst habe, Lupa eine Phenolinjektion zu geben. Bei seiner früheren Vernehmung will der Zeuge also noch die Leiche des Jan Lupa selbst gesehen haben. Auf Vorhalt aus dieser früheren Aussage erklärte nun der Zeuge in der Hauptverhandlung: Die Pfleger hätten ihm nur gesagt, Jan Lupa sei von Boger zum "Himmelskommando" geschickt worden. Daher habe er - der Zeuge - angenommen, dass Jan Lupa mit Phenol getötet worden sei.
Bei diesen voneinander abweichenden Angaben der Zeugen So. und Sew. muss offen bleiben, wer den Häftling so misshandelt hat, dass er anschliessend gestorben ist. Es kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass der Angeklagte Boger für den Tod Jan Lupas verantwortlich ist. Zwar erscheint es durchaus möglich, dass - wie der Zeuge Bor. meint - der Angeklagte Boger den Jan Lupa am Entlassungstag (9.3.1943) im Block 11 misshandelt hat. Sicher ist dies jedoch nicht. Denn der Zeuge Bor. war nicht Augenzeuge der Misshandlung. Er hat nur aus der Tatsache, dass der Angeklagte Boger aus der Blockführerstube herausgekommen ist und die zitierte Bemerkung gemacht hat, den Schluss gezogen, dass der Angeklagte Boger den Häftling Jan Lupa zuvor misshandelt haben müsse. Diese Schlussfolgerung ist nicht zwingend. Möglich ist, dass der Häftling Jan Lupa zuvor auf der Politischen Abteilung in der Vernehmungsbaracke von anderen SS-Angehörigen der Politischen Abteilung misshandelt und dann zur Entlassung in den Block 11 gebracht und dort auf dem Korridor niedergelegt worden ist, wo ihn der Zeuge Bor. gesehen hat. Wenn Jan Lupa aus dem Block entlassen werden sollte, musste er zunächst wieder dorthin gebracht werden, damit ihn der Häftlingsschreiber von der Stärke des Blockes 11 absetzen konnte.
Unterstellt man aber, dass der Angeklagte Boger den Jan Lupa am 9.3.1943 - wie der Zeuge Bor. annimmt - misshandelt hat, steht nicht fest, dass er infolge dieser Misshandlung gestorben ist. Denn der Zeuge So. will Jan Lupa noch im Mai 1943 im Block 21 gesehen haben. Jan Lupa soll von einem Häftlingsarzt wegen einer Phlegmone in den HKB eingeliefert worden sein. Denkbar wäre demnach, dass sich Jan Lupa von der Misshandlung am 9.3.1943 wieder erholt hat und später wegen einer Phlegmone, die nicht unbedingt durch die Misshandlung am 9.3.1943 hervorgerufen sein muss, in den HKB eingeliefert worden ist. Wenn die Aussage des Zeugen So. richtig ist und Jan Lupa dem Zeugen So. richtig berichtet hat, müssten Lachmann und Dylewski für den Tod Jan Lupas verantwortlich sein. Mit Sicherheit kann dies jedoch auch nicht festgestellt werden, weil nach der Aussage des Zeugen Sew. Jan Lupa behauptet haben soll, dass Boger ihn so zugerichtet habe, dass er nicht mehr liegen konnte. Nach der Aussage des Zeugen Sew. müsste Jan Lupa bereits im März 1943 gestorben sein.
Es war für das Schwurgericht unmöglich festzustellen, welcher der beiden Zeugen, So. oder Sew., mehr Glauben verdient. Bei beiden muss als möglich in Betracht gezogen werden, dass ihr Gedächtnis die damaligen Vorgänge um Jan Lupa nicht mehr zuverlässig wiedergibt und dass beide keine zuverlässige Erinnerung mehr daran haben, was ihnen Jan Lupa damals berichtet hat. Möglich ist auch, dass sich bei beiden Zeugen im Falle des Jan Lupa eigene Erlebnisse mit Gehörtem und Gelesenem in der Erinnerung vermengt haben, so dass die Zeugen heute selbst nicht mehr unterscheiden können zwischen dem, was sie selbst gesehen und von Jan Lupa erfahren haben und dem, was ihnen von anderen Häftlingen im Lager berichtet worden ist.
Sichere Feststellungen konnten daher weder zum Nachteil des Angeklagten Boger noch zum Nachteil des Angeklagten Dylewski getroffen werden.
Der Angeklagte Boger war daher von dem Schuldvorwurf, den Häftling Jan Lupa mit Tötungsvorsatz misshandelt zu haben, mangels Beweises freizusprechen.
4.
Dem Angeklagten Boger wird in Punkt 7 des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegt die 22jährige Slowakin und Häftlingssekretärin Lilli Tofler im Waschraum im Parterre des Arrestblockes 11 mit zwei Pistolenschüssen getötet zu haben.
Wie bereits im 3. Abschnitt unter C.II.3. ausgeführt worden ist, wurde die Häftlingsfrau Lilli Tofler, die in den Gärten von Reisko beschäftigt war, wegen eines Briefes, den sie an den Zeugen G. geschrieben hatte und durch zwei Häftlinge in einem Totenkranz dem Zeugen G. überbringen lassen wollte, im September 1943 in den Arrestbunker eingeliefert. Lilli Tofler ist damals auch getötet worden. Die Häftlingsschreiberinnen Ro., Kag. und Stei. haben damals gehört, dass Lilli Tofler erschossen worden sei. Der Angeklagte Boger hat eingeräumt, dass die Lilli Tofler im Waschraum des Blockes 11 erschossen worden sei. Der Zeuge G. hat ausgesagt, dass er die Leiche der Lilli Tofler nach einer Exekution an der Schwarzen Wand auf einem Berg Leichen habe liegen sehen. Es kann somit nicht zweifelhaft sein, dass Lilli Tofler damals getötet worden ist.
Der Zeuge Wö. hat nun behauptet, dass der Angeklagte Boger die Lilli Tofler eigenhändig erschossen habe. Er hat die Erschiessung wie folgt geschildert: Als er - der Zeuge - im Arrestbunker inhaftiert gewesen sei, habe ihn eines Morgens der Bunkerkalfaktor Ja. allein in den Waschraum hinaufgehen lassen. Als er kurze Zeit im Waschraum gewesen sei, habe er polnische Rufe gehört. Ja. habe zu ihm gesagt, er solle verschwinden. Daraufhin sei er - der Zeuge - aus dem Waschraum hinausgegangen und habe sich in einem anderen Raum versteckt. Die Tür dieses Raumes habe er nicht ganz zumachen können. Durch den Türspalt habe er den Gang im Block 11 überblicken können. Er habe dann gesehen und gehört, wie Boger gekommen sei und Ja. gesagt habe: "Holen Sie sie herauf!" Boger habe dann die Lilli Tofler selbst in den Waschraum geführt und mit zwei Schüssen getötet. Anschliessend habe er auch die Leiche der Lilli Tofler gesehen. Im Waschraum habe er auch zwei Einschüsse bzw. Ausschüsse am Fenster gesehen. Boger sei der einzige SS-Mann gewesen, der in den Waschraum hineingegangen sei. Er müsse daher die Lilli Tofler auch erschossen haben. Der Angeklagte Boger hat demgegenüber behauptet, er habe die Lilli Tofler nicht erschossen. Der Vorgang habe sich ganz anders abgespielt. Der Oberscharführer Kirschner sei eines Tages mit einer Exekutionsanordnung für die Lilli Tofler gekommen.
Der Hauptscharführer Gehring habe dann die Lilli Tofler auf Grund dieser Exekutionsanordnung im Beisein des Ja. erschossen. Die Erschiessung sei an einem Abend im Waschraum durch ein Kleinkalibergewehr erfolgt. Gehring habe die Lilli Tofler durch Genickschuss getötet. Gehring sei der Arrestverwalter auf Block 11 gewesen.
Das Schwurgericht konnte nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass die Darstellung des Zeugen Wö. richtig ist. Gegen die Glaubwürdigkeit des Zeugen bestehen Bedenken. Diese Bedenken sind bereits bei der Erörterung der Straftaten des Angeklagten Hantl (vgl. 3. Abschnitt Q.III.2.) geäussert und begründet worden. Auf diese Ausführungen kann daher Bezug genommen werden.
Auch in diesem Fall bestehen daher Bedenken, ob die Darstellung des Zeugen Wö. der Wahrheit entspricht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Zeuge, der davon überzeugt sein mag, dass der Angeklagte Boger die Lilli Tofler erschossen hat, seine angebliche Beobachtung im Block 11 - genau wie im Falle Hantl die Beobachtung aus Block 19 - erfunden hat, um das Gericht für seine Überzeugung zu gewinnen. Die Einlassung des Angeklagten Boger im Falle Tofler erscheint nicht völlig unglaubhaft. Hierfür spricht immerhin folgendes: Die Zeugin Ro., die als Schreiberin und Dolmetscherin für den Angeklagten Boger gearbeitet hat, hat ausgesagt, dass der Angeklagte Boger bei ihr nach der Festnahme der Lilli Tofler geäussert habe: "Die Lilli Tofler ist leider verloren, weil Grabner den Brief bei ihr gefunden hat. Wäre es anders, könnte ich sie vielleicht noch retten." Diese Äusserung des Angeklagten Boger spricht dagegen, dass er die Tötung der Lilli Tofler betrieben hat. Sie offenbart vielmehr, dass der Angeklagte Boger geneigt war, diese Häftlingsfrau, vielleicht weil sie einmal in der Politischen Abteilung für ihn gearbeitet hat, zu retten. Es erscheint daher durchaus möglich, dass der Angeklagte Boger nur auf Befehl Grabners die Lilli Tofler in den Arrestbunker eingeliefert hat und dass die Anordnung ihrer Exekution von Grabner oder sogar - auf eine Meldung Grabners hin - vom RSHA ausgegangen ist. Wenn aber nicht ausgeschlossen werden kann, dass Grabner oder das RSHA die Tötung der Lilli Tofler befohlen hat, ist die Einlassung des Angeklagten Boger, dass Gehring die Exekution vollzogen hat, nicht mit Sicherheit auszuschliessen. Denn Gehring konnte als Arrestverwalter, da er sich in dieser Eigenschaft in Block 11 aufhielt, die Erschiessung der Lilli Tofler, die unter den Häftlingen Aufsehen erregen musste, am unauffälligsten vollziehen. Es erscheint im Hinblick auf die Äusserung, die der Angeklagte Boger gegenüber der Zeugin Ro. gemacht hat, nicht sehr wahrscheinlich, dass sich Boger dazu gedrängt hat, die Lilli Tofler eigenhändig zu erschiessen.
Bei dieser Sachlage konnte das Gericht nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass der Angeklagte Boger die Lilli Tofler erschossen hat. Es konnte aber auch nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass er zu dem Tode der Lilli Tofler bewusst und gewollt irgend einen kausalen Tatbeitrag geleistet hat.
Der Angeklagte Boger musste daher von dem Schuldvorwurf, die Lilli Tofler ermordet zu haben, mangels Beweises freigesprochen werden.
5.
Dem Angeklagten Boger wird ferner unter Ziffer 8 des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegt, bei dem Abtransport der Insassen des Theresienstädter Lagers (B II b) die Journalistin Novotny erschossen zu haben, weil sie sich dagegen gewehrt haben soll, auf einen LKW verladen zu werden, der die Häftlinge in die Gaskammer bringen sollte. Über die erste "Liquidierung" des sog. Theresienstädter Lagers (B II b) im März 1944 sind bereits im 3. Abschnitt unter K.II.4. Feststellungen getroffen worden. Auf sie kann daher Bezug genommen werden. Wie dort ausgeführt worden ist, sind mindestens 3000 jüdische Menschen aus dem Theresienstädter Lager, die im September 1943 nach Auschwitz deportiert worden waren, im März 1944, nachdem man sie zunächst aus dem Lagerabschnitt B II b in den Lagerabschnitt B II a gebracht hatte, durch Gas getötet worden.
Auf Grund der Beweisaufnahme steht zunächst fest, dass der Angeklagte Boger bei den Vorbereitungen zur Tötung der jüdischen Menschen aus den Septembertransporten mitgeholfen hat. Der Zeuge Erich K. hat glaubhaft bekundet, dass er selbst den Angeklagten Boger hierbei gesehen habe. Boger habe - so hat der Zeuge ausgesagt - im Theresienstädter Lager (B II b) an Hand einer Liste kontrolliert, dass alle jüdischen Häftlinge, die mit den Septembertransporten aus Theresienstadt nach Auschwitz gebracht worden waren, auch aus dem Lager kämen. Er habe dafür gesorgt, dass keiner habe zurückbleiben können. Boger war auch später beim Abtransport dieser Häftlinge aus dem Quarantänelager (B II a), wohin sie zunächst aus dem Lagerabschnitt B II b gebracht worden waren, dabei. Der Zeuge Erich K. hat zwar nicht behauptet, ihn auch im Quarantänelager gesehen zu haben. Der Angeklagte Boger hat aber nicht in Abrede gestellt, dass er auch beim Abtransport der Opfer aus dem Quarantänelager anwesend gewesen sei. Er hat dies sogar indirekt zugegeben. Er hat nämlich erklärt, dass beim Abtransport der jüdischen Häftlinge aus dem Quarantänelager niemand erschossen worden sei. Damit hat er indirekt eingeräumt, den Abtransport miterlebt zu haben. Andernfalls hätte er erklärt, er sei überhaupt nicht im Quarantänelager gewesen, als die Opfer auf die LKWs verladen wurden.
Das Schwurgericht konnte jedoch nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass der Angeklagte Boger bei dieser Gelegenheit eine Frau erschossen hat, was ihm unter Ziffer 8 des Eröffnungsbeschlusses allein zur Last gelegt wird.
Allerdings hat der Zeuge Dia. bei seiner Vernehmung in der Hauptverhandlung behauptet, dass der Angeklagte Boger beim Antransport der jüdischen Häftlinge aus dem Quarantänelager eine Frau namens Novotny erschossen habe.
Dieser Zeuge ist nach seiner Aussage im Jahre 1940, nachdem er als deutscher Staatsangehöriger auf der Seite der "Roten" im spanischen Bürgerkrieg gekämpft hatte, in Barcelona verhaftet und der Gestapo übergeben worden. Von dort kam er zunächst nach Berlin in das Gefängnis in der Prinz-Albrecht-Strasse und dann in die KL Sachsenhausen und Ravensbrück. Dort rettete er einer SS-Aufseherin das Leben. Im Jahre 1941 oder 1942 kam er - und zwar wegen der Rettung der SS-Aufseherin als sog. "Vorzugshäftling" - in das KL Auschwitz. Im KL Auschwitz übte er nacheinander die verschiedensten Funktionen als Blockältester, Lagerkapo und Lagerältester des Zigeunerlagers aus. Zur ersten "Liquidierung" des Theresienstädter Lagers wurde er mit anderen Funktionshäftlingen in das Quarantänelager befohlen. Die Funktionshäftlinge sollten widerstrebende Häftlinge mit Stöcken auf die LKWs treiben. Der Zeuge will bei dieser Gelegenheit im Quarantänelager folgendes beobachtet haben: Der Angeklagte Boger habe - so hat der Zeuge bekundet - auf der Lagerstrasse im Quarantänelager gestanden. Auf einmal sei Frau Novotny, die er aus früheren Besuchen im Theresienstädter Lager gekannt habe, die Lagerstrasse heruntergekommen. Sie sei auf den Angeklagten Boger zugegangen und habe ihm etwas in das Gesicht gerufen. Er - der Zeuge - habe aus einer Entfernung von 5-6 Metern nur gesehen, dass Frau Novotny mit hasserfüllten Augen an den Angeklagten Boger herangekommen sei und ihm in das Gesicht geschrien habe. Sie habe ihm ihre Verachtung kundgetan. Boger habe daraufhin seine Pistole gezogen und Frau Novotny erschossen.
Diese Darstellung des Zeugen erscheint auf den ersten Blick nicht unglaubhaft. Die Tat ist auch dem Angeklagten Boger ohne weiteres zuzutrauen. Das Leben der jüdischen Menschen galt damals nichts. Sie sollten sowieso kurz danach in einer der Gaskammern umgebracht werden. Es erscheint daher naheliegend, dass die SS-Männer kaum Hemmungen hatten, schon vorher einige der Opfer zu töten.
Das Schwurgericht hat gleichwohl Zweifel, ob der Zeuge Dia. zutreffend berichtet hat und, falls Frau Novotny bei dem Abtransport der jüdischen Menschen aus dem Quarantänelager tatsächlich erschossen worden sein sollte, ob der Zeuge den Angeklagten Boger irrtumsfrei als Täter indentifiziert hat. Diese Bedenken bestehen deswegen, weil der Zeuge bei seiner ersten polizeilichen Vernehmung im Ermittlungsverfahren am 9.12.1958 behauptet hat, der Angeklagte Boger habe bei der Räumung des Theresienstädter Lagers zwei Frauen erschossen. Er hat damals, was ihm in der Hauptverhandlung vorgehalten und bestätigt worden ist, unter anderem wörtlich erklärt:
"So ist mir bekannt und ich habe gesehen, dass Boger zwei Frauen eigenhändig erschossen hat. Diese Frauen waren im sog. Lager B untergebracht, das als das Theresienstädter Lager bekannt war. Ich sah, dass Boger die eben erwähnten zwei Frauen erschoss .... Die zweite Frau hiess Novotny. Sie war aus Prag und Journalistin."
Zwischen beiden Aussagen besteht also ein erheblicher Unterschied. Nach der ersten Aussage am 9.12.1958 soll Boger zwei Frauen und zwar im Theresienstädter Lager erschossen haben, während nach der Aussage des Zeugen in der Hauptverhandlung Boger nur eine Frau und zwar im Quarantänelager erschossen haben soll. Ein Irrtum über die Örtlichkeit des Geschehens erscheint allerdings nicht so schwerwiegend. Er kann auch einem sonst zuverlässigen Zeugen unterlaufen. Kaum erklärlich erscheint es jedoch, dass ein Zeuge, der tatsächlich die Erschiessung einer einzigen Person mit angesehen hat und über ein zuverlässiges Gedächtnis verfügt, später zu der Überzeugung kommen kann, er habe die Erschiessung von zwei Personen miterlebt. Das Schwurgericht hat daher Bedenken, ob der Zeuge ein zuverlässiges Erinnerungsvermögen hat, dass er nach 14-20 Jahren noch genau unterscheiden kann zwischen dem, was er selbst erlebt hat und dem, was ihm von anderen Personen früher einmal erzählt worden ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Zeuge damals im Lager aus Erzählungen anderer Häftlinge oder aus Lagergerüchten von der Erschiessung der Frau Novotny gehört hat und dies nun als eigenes Erleben wiedergibt, wobei unklar bleibt, ob ihm bereits damals der Angeklagte Boger als der Täter genannt worden ist oder ob er selbst nachträglich guten Glaubens die Erschiessung der Frau Novotny auf den Angeklagten Boger projiziert.
Der Zeuge hat allerdings seine ursprüngliche Aussage bereits bei einer zweiten Vernehmung im Ermittlungsverfahren am 21.4.1959 dahin geändert, dass er nur eine Tötung durch den Angeklagten Boger gesehen habe. Wörtlich hat er, was ihm inder Hauptverhandlung vorgehalten und von ihm bestätigt worden ist, bei dieser zweiten Vernehmung unter anderem erklärt: "Tötungen durch Boger habe ich nur eine gesehen. Ich verweise hierbei auf meine Angaben, die ich in dieser Sache vor der Kriminalpolizei Frankfurt (am 9.12.1958) gemacht habe. Berichtigend zu diesen Angaben möchte ich sagen, dass es nicht zwei Frauen waren, die Boger erschossen hat, sondern nur diese eine mir gut bekannte Frau Novotny aus Prag ....". Warum sich die Erinnerung des Zeugen wenige Monate nach der ersten Vernehmung in einem entscheidenden Punkt geändert hat, war nicht zu erforschen. Der Zeuge hat dafür keine Erklärung gegeben. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass der Zeuge in Gesprächen mit früheren Kameraden aus der Lagerzeit darauf hingewiesen worden ist, dass damals im Lager nur von der Erschiessung der Frau Novotny, jedoch nicht von der Erschiessung von zwei Frauen durch Boger die Rede gewesen sei.
Die Darstellung, die der Zeuge bei seiner zweiten Vernehmung über die Erschiessung der Frau Novotny gegeben hat, weicht ausserdem von der Darstellung in der Hauptverhandlung ab. Bei der zweiten Vernehmung hat der Zeuge behauptet, dass Frau Novotny sich geweigert habe, einen LKW zu besteigen und dass der Angeklagte Boger sie wegen dieser Weigerung erschossen habe. Nach der Darstellung in der Hauptverhandlung soll Frau Novotny auf der Lagerstrasse auf Boger zugegangen und ihm etwas in das Gesicht geschrien haben. Auch diese Unterschiede zwischen den beiden Aussagen lassen Zweifel aufkommen, ob der Zeuge den Vorfall tatsächlich erlebt hat.
Schliesslich ergeben sich Zweifel an der Zuverlässigkeit des Erinnerungsvermögens des Zeugen auch noch aus folgendem: Bei einer seiner früheren Vernehmungen hat der Zeuge behauptet, er habe die Angeklagten Boger und Broad bei der "Liquidierung" des Zigeunerlagers gesehen. In der Hauptverhandlung hat er demgegenüber erklärt, er könne nicht mehr genau sagen, ob die Angeklagten Broad und Boger bei der Verladung der Zigeuner dabeigewesen seien. Er habe damals nach der Räumung des Zigeunerlagers einen Nervenzusammenbruch erlitten. Er glaube zwar, dass Boger dabeigewesen sei, wisse es aber nicht mehr genau.
Ausser dem Zeugen Dia. hat kein Zeuge bekundet, die Erschiessung der Frau Novotny durch den Angeklagten Boger gesehen zu haben. Nur der Zeuge van V. hat bereits damals im Lager davon gehört. dieser Zeuge hat bekundet, dass ihm ein Häftling namens Horst Jonas erzählt habe, der Angeklagte Boger habe beim Abtransport der jüdischen Häftlinge aus dem Theresienstädter Lager Frau Novotny erschossen. Horst Jonas habe dies jedoch nicht selbst gesehen. Er habe es vielmehr auch von einem Kapo erzählt bekommen.
Ob diese Berichte damals zutreffend waren, konnte nicht geklärt werden. Es kann sich hierbei auch um unkontrollierbare Lagergerüchte, wie sie in gleichen oder ähnlichen Lagern häufig sind, gehandelt haben. Aus der Aussage des Zeugen van V. ergibt sich nur, dass damals tatsächlich von der Erschiessung einer Frau Novotny durch den Angeklagten Boger gesprochen worden ist. Diese damaligen Gespräche können im Verlauf der Zeit in dem Zeugen Dia. irrige Vorstellungen hervorgerufen haben, dass er die Erschiessung der Frau Novotny selbst miterlebt habe. Die Gespräche können jedoch noch keinen sicheren Beweis dafür liefern, dass der Angeklagte Boger, wenn Frau Novotny tatsächlich erschossen worden ist, der Täter gewesen ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass irgend ein Häftling, der die Erschiessung der Frau Novotny mit angesehen hat und Urheber der damaligen Lagergespräche über den "Fall Novotny" gewesen ist, einen anderen SS-Mann irrtümlich für den Angeklagten Boger gehalten hat.
Zusammenfassend lässt sich daher nicht mit jeden Zweifel ausschliessender Sicherheit feststellen, dass der Angeklagte Boger damals Frau Novotny erschossen hat. Er war daher auch in diesem Anklagepunkt mangels Beweises freizusprechen.
Die Beteiligung des Angeklagten Boger an der "Liquidierung" der jüdischen Häftlinge aus dem Theresienstädter Lager ist zwar strafrechtlich relevant. Der Angeklagte Boger konnte deswegen jedoch nicht bestraft werden, weil ihm diese Beteiligung durch den Eröffnungsbeschluss nicht zur Last gelegt wird. Sie kann nicht durch Ziffer 1 des Eröffnungsbeschlusses erfasst sein; denn Ziffer 1 des Eröffnungsbeschlusses legt dem Angeklagten Boger nur die Beteiligung an Selektionen (auf der Rampe oder im Lager) zur Last, d.h. die Mitwirkung bei der Auswahl von Häftlingen zur Tötung, bei der die Entscheidung über Leben und Tod der Häftlinge bei demjenigen lag, der die Selektionen durchführte. Bei der Vernichtung des Theresienstädter Lagers im März 1944 handelte es sich jedoch nicht um eine solche Auswahl von Häftlingen, vielmehr wurden sämtliche jüdischen Menschen aus den Septembertransporten auf Befehl der SS-Führung ohne Auswahl getötet. Dass der Eröffnungsbeschluss zwischen einer Beteiligung an Selektionen und einer Beteiligung an der Vernichtung einer ganzen Gruppe von Häftlingen auf Befehl der SS-Führung unterscheidet, ergibt sich daraus, dass dem Angeklagten Boger unter Ziffer 24 des Eröffnungsbeschlusses, also durch einen besonderen Anklagepunkt, die Mitwirkung an der "Liquidierung" des Zigeunerlagers und dem Angeklagten Baretzki in Ziffer 9 des ihn betreffenden Eröffnungsbeschlusses, also ebenfalls durch einen besonderen Anklagepunkt, die Mitwirkung an der "Liquidierung" des Theresienstädter Lagers zur Last gelegt wird, obwohl dem Angeklagten Baretzki bereits in Ziffer 1 des Eröffnungsbeschlusses die Beteiligung an Selektionen auf der Rampe und im Lager zum Vorwurf gemacht wird.
Der Angeklagte Boger konnte daher nicht wegen seiner Mitwirkung an der ersten "Liquidierung" des Theresienstädter Lagers und auch nicht wegen seiner Mitwirkung an der zweiten "Liquidierung" des Theresienstädter Lagers, die im Juni 1944 erfolgte und durch die die jüdischen Menschen, die mit den Dezembertransporten 1943 angekommen waren, getötet worden sind, bestraft werden. Dass der Angeklagte Boger auch an der zweiten "Liquidierung" des Theresienstädter Lagers teilgenommen hat, hat der Zeuge Erich K. ebenfalls bekundet.
6.
Dem Angeklagten wird unter Ziffer 16 des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegt, Ende des Jahres 1943 oder Anfang 1944 einen jungen polnischen Häftling, dem ein SS-Angehöriger befohlen hatte, in einem Kochgeschirr Wasser zu holen, an der Wasserstelle erschossen zu haben.
Hierzu hat nur der Zeuge Krona. folgende Aussage gemacht: Im Jahre 1944 hätten die Häftlinge eines Morgens wegen Nebels lange stehen müssen. Denn bei Nebel seien die Arbeitskommandos wegen Fluchtgefahr nicht ausgerückt. Als sich der Nebel gelichtet habe, sei schliesslich der Befehl zum Ausrücken gekommen. Die Arbeitskommandos seien dann aus dem Lager abmarschiert. Kurz danach sei jedoch erneut Nebel aufgekommen. Sie - die Häftlinge - hätten dann erneut mit ca. 1000 Mann stehen bleiben müssen. Ein SS-Mann habe während des Wartens einen Judenjungen im Alter von 14-15 Jahren, den er zu seiner Bedienung bei sich gehabt habe, mit einem Kochgeschirr zu einer 50 m entfernten Wasserstelle geschickt. Als der Judenjunge mit dem Kochgeschirr zu der Wasserstelle gegangen sei, habe es plötzlich "geknallt". Der Junge habe dann tot mit einer Schusswunde im Rücken an der Wasserstelle gelegen. Boger habe mit rauchender Pistole in einer Entfernung von ca. 10 m von dem Jungen entfernt gestanden. Er - der Zeuge Krona. - habe das selbst gesehen. Wer geschossen habe, das habe er nicht gesehen. Die SS-Posten hätten mit ihren Gewehren auf dem Rücken herumgestanden. Boger sei der einzige gewesen, der mit der Pistole in der Hand dagestanden habe. Er müsse daher den Judenjungen erschossen haben. Er - der Zeuge - sei ca. 50 m von der Wasserstelle entfernt gewesen.
Der Angeklagte Boger hat in Abrede gestellt, an einem solchen Vorfall beteiligt gewesen zu sein.
Auch bei dieser Aussage des Zeugen Krona. konnte nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass sich der Zeuge in der Person des SS-Angehörigen, der mit rauchender Pistole in der Nähe der Wasserstelle gestanden hat, geirrt hat. Der Zeuge Krona. ist nicht zuverlässig. Unter 3c. ist bereits ausgeführt worden, dass der Zeuge Ereignisse mit dem Angeklagten Boger in Verbindung gebracht hat, die geschehen sind, als der Angeklagte Boger noch gar nicht im KL Auschwitz war. Es ist daher möglich, dass er auch die Erschiessung des Judenjungen zu Unrecht auf den Angeklagten Boger projiziert hat. Bedenken bestehen auch deswegen, weil der Angeklagte Boger als Angehöriger der Politischen Abteilung mit dem Ausrücken der Häftlingsarbeitskommandos an sich nichts zu tun hatte. Das Ausrücken der Arbeitskommandos wurde von den Angehörigen der Schutzhaftlagerführung (Schutzhaftlagerführer, Rapportführer, Blockführer), den Arbeitsdienstführern und Kommandoführern überwacht. Der Zeuge will Boger aus einer Entfernung von ca. 40 m gesehen haben. Denn nach seiner Aussage war er selbst ca. 50 m von der Wasserstelle entfernt, während Boger ca. 10 m von dem an der Wasserstelle liegenden Häftling entfernt gestanden haben soll. Zieht man in Betracht, dass so starker Nebel geherrscht hat, dass die Häftlinge nicht weitergehen durften, so erscheint es kaum möglich, dass der Zeuge den SS-Mann mit der rauchenden Pistole einwandfrei hat erkennen können. Unmöglich erscheint es auch, dass der Zeuge die Schusswunde im Rücken des Häftlings hat sehen können. Auf Grund der Aussage des Zeugen Krona., die von keinem anderen Zeugen bestätigt worden ist, konnte daher nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass der Angeklagte Boger tatsächlich im Jahre 1944 einen Judenjungen an einer Wasserstelle erschossen hat.
Der Angeklagte Boger war daher von dem Schuldvorwurf unter Ziff.16 des Eröffnungsbeschlusses mangels Beweises freizusprechen.
7.
Dem Angeklagten Boger wird unter Ziffer 20 des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegt, etwa Mitte des Jahres 1944 46 Häftlinge aus dem Kommando "Union", die infolge körperlicher Erschöpfung nicht mehr arbeitsfähig gewesen seien, im Block 11 mit der Pistole erschossen zu haben. Auch in diesem Anklagepunkt konnte der Angeklagte Boger nicht überführt werden. Ausser dem Zeugen Ol. hat kein Zeuge zu diesem Anklagepunkt Bekundungen gemacht. Wie der Zeuge Ol. in der Hauptverhandlung die Erschiessung der Angehörigen des Kommandos "Union" geschildert hat, ist oben unter I.2a. bereits dargestellt worden. Dort ist ausgeführt worden, dass der Zeuge Ol. kein zuverlässiger Zeuge ist. Seine Aussage ist unglaubhaft. Hierzu kann auf die oben unter I.2a. (in diesem Abschnitt) gemachten Ausführungen Bezug genommen werden. Auf Grund der Aussage des Zeugen Ol. konnten daher keine sicheren Feststellungen zum Nachteil des Angeklagten Boger getroffen werden.
Der Angeklagte Boger war daher von dem Schuldvorwurf unter Ziff.20 des Eröffnungsbeschlusses mangels Beweises freizusprechen.
8.
Dem Angeklagten Boger wird unter Ziffer 23 des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegt, am 30.12.1944 bei der Erhängung der Häftlinge Bernhard Swierczy, Ludwig Wesely, Ernst Bürger, Rudi Friemel und Peter Puta mitgewirkt zu haben.
Hierzu hat das Schwurgericht auf Grund der Aussagen der Zeugen Sm., Law. und der Zeugin Maj. folgendes festgestellt: Im Jahre 1944 flüchteten 6-8 Häftlinge aus dem Lager. 5 der Geflüchteten wurden einige Zeit später wieder ergriffen. Es waren die 3 Österreicher Bürger, Friemel und Wesely und die 2 Polen Swierczy und Pionte. Sie wurden zunächst in dem Arrestbunker inhaftiert. Dann wurden wegen ihrer Flucht Ermittlungen durch die Politische Abteilung durchgeführt. Die geflüchteten und wieder ergriffenen Häftlinge wurden vernommen. Die Ermittlungen dauerten einige Zeit. Wie lange sie gedauert haben, konnte nicht geklärt werden. Am 30.12.1944 wurden die 3 Österreicher und die 2 Polen öffentlich im Lager A I vor der Küche in Anwesenheit von SS-Führern, SS-Unterführern und SS-Männern sowie vor den angetretenen Häftlingen des Lagers erhängt. Vor ihrer Erhängung wurde durch einen SS-Angehörigen ein Schriftstück verlesen. Ob es sich hierbei um ein Urteil oder einen Exekutionsbefehl gehandelt hat, konnte nicht geklärt werden. Der Angeklagte Boger war während der Erhängung der 5 Häftlinge anwesend. Es konnte nicht festgestellt werden, dass er eine bestimmte Funktion ausgeübt hat. Der Zeuge Ol. hat zwar behauptet, die Angeklagten Boger und Kaduk hätten sich wie wahnsinnig gebärdet, weil die Häftlinge vor ihrer Erhängung noch Ausrufe wie "weg mit der braunen Mordbande", "es lebe die Rote Armee", "es lebe der Kommunismus!" gemacht hätten. Beide (Boger und Kaduk) hätten sich auf die hängenden Häftlinge geworfen, hätten ihnen Ohrfeigen gegeben und sie unmittelbar nach der Erhängung an den Füssen nach unten gezogen. Der Zeuge Law., der die Erhängung ebenfalls mitansehen musste, hat demgegenüber ausgesagt, dass er nicht behaupten könne, dass Boger bei dieser Erhängung in irgend einer Weise aktiv gewesen sei.
Der Zeuge Ol. ist unglaubwürdig. Er neigt zu Übertreibungen und der Tendenz, die in diesem Verfahren angeklagten SS-Angehörigen unter allen Umständen zu belasten. Das zeigt seine Schilderung über die Erhängung der 12 Landmesser, bei der die Angeklagten Boger und Kaduk den Häftlingen nach der Aussage des Zeugen Ol. die Schlinge über den Hals gezogen haben sollen, während der zuverlässige Zeuge P. bekundet hat, ein Kapo hätte den Delinquenten die Schlinge um den Hals gelegt. Im übrigen kann wegen der Glaubwürdigkeit des Zeugen Ol. auf die Ausführungen unter I.2a. (in diesem Abschnitt) verwiesen werden.
Die Zeugin Maj., die als Häftlingsschreiberin in der Politischen Abteilung beschäftigt war, hat in der Hauptverhandlung behauptet, der Angeklagte Boger sei für die Erhängung der geflüchteten Häftlinge verantwortlich. Er habe sie "zum Erhängen verurteilt". Die Zeugin konnte für die Behauptung jedoch keine überzeugende Begründung geben. Sie musste auf Vorhalt aus ihrer früheren Vernehmung im Ermittlungsverfahren einräumen, dass sie früher angegeben habe, sie wisse nicht, ob Boger die Entscheidung gefällt habe.
Es erscheint auch unwahrscheinlich, dass der Angeklagte Boger eine öffentliche Erhängung hätte anordnen können. Dagegen spricht, dass nach der Aussage des Zeugen Law. "ein kurzes Urteil" verlesen worden ist. Der Zeuge konnte den Inhalt des Schriftstückes, das verlesen worden ist, zwar nicht gut verstehen, aber die Tatsache, dass vor der Erhängung überhaupt etwas verlesen worden ist, spricht dafür, dass der Erhängung eine Exekutionsanordnung einer höheren Dienststelle (etwa des RSHA) oder sogar ein Urteil irgend eines Gerichts zugrunde gelegen hat. Dagegen, dass der Angeklagte Boger die Erhängung eigenmächtig angeordnet haben
sollte, spricht auch, dass die Erhängung öffentlich erfolgt ist. Dem Angeklagten Boger, der nicht einmal Leiter der Politischen Abteilung war, stand offiziell keine Entscheidung über Leben und Tod von Häftlingen zu. Er war wie alle anderen SS-Angehörigen im KL Auschwitz an die Vorschrift gebunden, dass kein SS-Angehöriger im KL Auschwitz einen Häftling misshandeln oder töten dürfe. Er konnte es daher nicht wagen, eine öffentliche Exekution ohne oder gegen den Willen des RSHA anzuordnen.
Mit Sicherheit kann daher nur festgestellt werden, dass der Angeklagte Boger bei der Erhängung der 5 Häftlinge anwesend war, ohne dass ihm eine bestimmte Funktion nachgewiesen werden konnte.
Eine Verurteilung des Angeklagten Boger kann in diesen Falle nicht erfolgen, auch wenn Boger, was die Zeugin Maj. behauptet, die 5 Häftlinge während der Ermittlungen vernommen haben sollte. Denn es kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass die Tötung der 5 Häftlinge rechtswidrig war. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass gegen die Häftlinge ein Gerichtsverfahren durchgeführt worden ist und dass die Häftlinge durch irgend ein Gericht zum Tode verurteilt worden sind. Der Angeklagte Boger hat behauptet, dass gegen die 5 Häftlinge ein Gerichtsverfahren durchgeführt worden sei. Das kann nicht widerlegt werden. Denn unter den geflüchteten Häftlingen befanden sich 3 Österreicher, die damals als Reichsdeutsche galten.
Reichsdeutsche erfuhren eine bessere Behandlung als z.B. Juden, Polen und Angehörige sonstiger ostischer Völker. Reichsdeutsche wurden wegen einer Flucht aus dem KL nicht ohne weiteres erschossen oder auf andere Weise getötet. Auch das RSHA ordnete wegen der gelungenen Flucht eines Reichsdeutschen aus dem KL nicht ohne weiteres dessen Exekution an. Der Angeklagte Dylewski, der längere Zeit Fluchtsachbearbeiter im KL Auschwitz gewesen ist, hat erklärt, dass für Reichsdeutsche, die geflohen waren, nach ihrer Wiederergreifung nie die Gefahr bestanden hätte, dass sie exekutiert würden. Das hat der Zeuge Küs. bestätigt. Dieser Zeuge war - wie er glaubhaft bekundet hat - aus dem KL Auschwitz geflohen und hatte sich längere Zeit in Polen verborgen gehalten. Nach seiner Wiederergreifung wurde er in das KL Auschwitz zurückgebracht und für 3 Monate in den Arrestblock eingesperrt. Dann wurde er in das Lager entlassen.
Es erscheint daher möglich, dass gegen die 5 Häftlinge ein Gerichtsverfahren durchgeführt worden ist und dass die Häftlinge durch ein Gerichtsurteil zum Tode verurteilt worden sind. Diese Möglichkeit muss auch deswegen in Betracht gezogen werden, weil die geflüchteten Häftlinge - wie damals im Lager erzählt wurde - in SS-Uniform geflohen sein sollen. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass sie während oder nach ihrer Flucht Taten begangen haben, die nach damaliger Rechtsauffassung als Straftaten (zum Beispiel Spionage, Sabotage, Landesverrat) ausgelegt werden konnten, die mit der Todesstrafe geahndet wurden. Da weder Protokolle über ein solches Gerichtsverfahren bekannt sind, noch das Urteil, das möglicherweise ergangen ist, dem Gericht vorgelegen hat, auch keine Zeugen vorhanden sind, die über ein solches Gerichtsverfahren oder ein eventuell ergangenes Urteil Bekundungen machen könnten, war nicht zu klären, ob ein zu Gunsten des Angeklagten zu unterstellendes Urteil rechtmässig ergangen ist oder ob es gegen anerkannte rechtsstaatliche Grundsätze verstossen hat. Die Rechtswidrigkeit der Tötung der 5 Häftlinge kann daher nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Hiervon abgesehen, kann dem Angeklagten Boger nicht nachgewiesen werden, dass er zu der Erhängung der 5 Häftlinge bewusst und gewollt einen kausalen Tatbeitrag geleistet hat und dass ihm, falls die Erhängung rechtswidrig gewesen sein sollte, klar gewesen ist, dass die Erhängung der 5 Häftlinge ein allgemeines Verbrechen war.
Eine Verurteilung des Angeklagten Boger war daher in diesem Anklagepunkt aus tatsächlichen Gründen nicht möglich. Er musste daher auch in diesem Punkt mangels Beweises freigesprochen werden.
9.
Dem Angeklagten Boger wird unter Ziffer 24 des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegt, im Sommer 1944 bei der Vernichtung des Zigeunerlagers mitgewirkt zu haben. Die sog. "Liquidierung" des Zigeunerlagers im Jahre 1944 ist oben bereits erwähnt worden. Im einzelnen hat das Schwurgericht auf Grund der Aussage des Zeugen Lei., Bej., Berg., Am., Barc. und Pol. folgendes festgestellt: Im Juli 1944 wurde die Tötung der im sog. Zigeunerlager in Birkenau (Lagerabschnitt B II e) befindlichen Zigeuner, die dort familienweise untergebracht waren und keine Häftlingskleidung trugen, angeordnet. Zuvor sollten noch kräftige arbeitsfähige Zigeuner und solche, die in der Wehrmacht gedient hatten, ausgesondert werden. Das geschah auch. Die Ausgewählten kamen einige Tage vor dem 31.7.1944 in das Stammlager, von wo sie später in andere Konzentrationslager verlegt wurden.
Am Abend des 31.7.1944 kamen zwischen 20 und 21.00 Uhr LKWs in das Zigeunerlager gefahren. Die Sonne war längst untergegangen. Es war dämmerig bis fast dunkel. Die Lagerstrasse im Zigeunerlager war zunächst beleuchtet. Mit den LKWs kamen SS-Führer, SS-Unterführer und SS-Männer in das Zigeunerlager herein. Die LKWs fuhren zunächst zu dem sog. Kinderblock, der auch Waisenblock genannt wurde, weil in ihm elternlose Kinder untergebracht waren. Die Waisen wurden als erste von den SS-Männern, die angeheitert und angetrunken waren, auf die LKWs gebracht. Nachdem der Kinderblock leer war, musste der Zeuge Bej., der als Häftlingsarzt im Zigeunerlager tätig war, auf Befehl eines SS-Mannes das Licht, das die Lagerstrasse beleuchtete, ausmachen. Die Lagerstrasse lag nun im Dunkeln. Danach wurden alle Blocks nacheinander von den SS-Angehörigen "geräumt". Die Zigeuner wurden auf die Lastwagen getrieben. Dabei spielten sich furchtbare Szenen ab. Die Zigeuner, die ahnten, dass sie getötet werden sollten, wehrten sich, schrien und flehten um ihr Leben. Ihre Verladung auf die LKWs dauerte mehrere Stunden, da die LKWs nicht alle Menschen auf einmal fassen konnten, sondern zwischen dem Lager zu den Gaskammern hin- und herpendelten, um die Zigeuner nach und nach zu den Gaskammern zu bringen. Gegen Morgen war das Zigeunerlager geräumt. Alle Zigeuner, die noch in dem Zigeunerlager gewesen waren, wurden in den Gaskammern in Birkenau durch Zyklon B getötet.
Der Angeklagte Boger, der nach dem Eröffnungsbeschluss bei dieser Aktion dabeigewesen sein soll, bestreitet, an der Aktion teilgenommen zu haben. Es besteht zwar ein erheblicher Verdacht, dass er als Angehöriger der Politischen Abteilung massgeblich an der "Liquidierung" des Zigeunerlagers mitgewirkt hat. Sichere Feststellungen konnten jedoch insoweit nicht getroffen werden.
Der Zeuge Bej. hat die Aktion von Anfang bis Ende miterlebt. Er kannte die Verhältnisse im Zigeunerlager genau. Auch waren ihm aus seiner ärztlichen Tätigkeit eine Reihe von SS-Angehörigen bekannt. Der zuverlässige Zeuge hat erklärt, dass er bei der Vernichtungsaktion nur den SS-Arzt Dr. Mengele deutlich gesehen habe, andere SS-Männer habe er dagegen nicht erkannt. Der Zeuge konnte daher keinen Aufschluss darüber geben, ob der Angeklagte Boger an der Aktion teilgenommen hat. Der Zeuge Berg., der ebenfalls einen glaubwürdigen und zuverlässigen Eindruck gemacht hat, war damals 14 Jahre alt. Er befand sich während der Räumung des Zigeunerlagers in dem Lagerabschnitt B II d, also in dem Abschnitt, der unmittelbar an das Zigeunerlager angrenzte. Der Zeuge hat erklärt, dass es Nacht gewesen sei und dass sie - die Häftlinge im Lagerabschnitt B II d - aus diesem Lagerabschnitt die Vorgänge im Zigeunerlager nicht hätten sehen können. Über die "Liquidierung" des Zigeunerlagers sei viel gesprochen worden und er habe viel davon gehört. Aber er wolle darüber nicht sprechen, weil er es nicht selbst gesehen habe. Der Zeuge Am. befand sich in der Nacht zum 31.7. und 1.8.1944 in der Desinfektionsbaracke des Zigeunerlagers. Es war - so hat der Zeuge angegeben - die letzte Baracke des Lagers vom Lagereingang aus gesehen. Der Zeuge hat bekundet, dass 4 SS-Männer mit "Maschinengewehren" (wahrscheinlich hat es sich um Maschinenpistolen gehandelt) sich vor ihrer Baracke postiert und die Baracke abgesperrt hätten. Das ganze Lager sei abgesperrt worden. Der Zeuge konnte daher keine Auskunft darüber geben, ob der Angeklagte Boger im Zigeunerlager gewesen ist.
Der Zeuge Barc., der jetzt als Journalist in Warschau lebt, befand sich vor der "Liquidierung" des Zigeunerlagers eine Zeitlang als Schreiber im HKB des Zigeunerlagers. Der Zeuge hat - wie er bekundet hat - die Vernichtungsaktion selbst nicht miterlebt.
Er sei - so hat er angegeben - mit anderen Häftlingen vor dem Einrücken der SS-Männer aus dem Zigeunerlager herausgeführt worden. Erst danach seien Dr. Mengele, die Angehörigen der Politischen Abteilung und der Verwaltung und andere SS-Männer in das Lager hineingegangen. Der Zeuge war nicht sicher, ob er auch den Angeklagten Boger gesehen hat. Er habe - so hat er erklärt - Angehörige der Politischen Abteilung nur vom Sehen gekannt. Es seien unter anderem die Angeklagten Boger, Broad und Dylewski und der SS-Unterführer Lachmann gewesen. Er könne sich heute jedoch nicht mehr genau erinnern, wer im einzelnen dabeigewesen sei. Er habe zwar alle Angehörigen der Politischen Abteilung gekannt. Er habe auch einige davon in das Zigeunerlager hineingehen sehen. Er könne jedoch nicht mehr konkret angeben, ob z.B. Dylewski und Broad dabeigewesen seien oder nur der Angeklagte Dylewski. Der Angeklagte Dylewski kann jedoch nicht an der "Liquidierung" des Zigeunerlagers beteiligt gewesen sein. Denn die frühere Ehefrau des Angeklagten Dylewski, die Zeugin Ruth Dylewski, hat glaubhaft bekundet, dass ihr früherer Ehemann bis Anfang August 1944 in Studienurlaub gewesen sei. Sie wisse bestimmt, so hat die Zeugin erklärt, dass der Angeklagte Dylewski noch Ende Juli zu Hause bei einer Familienfeier gewesen sei und danach nur noch einmal nach Auschwitz gefahren sei, um seine Sachen zu holen, da er inzwischen seine Versetzung nach Hersbruck erhalten habe. Aus der Aussage des Zeugen Barc. kann daher nicht entnommen werden, dass der Angeklagte Boger beim Abtransport der Zigeuner aus dem Zigeunerlager am 31.7.1944 mitgewirkt hat.
Allerdings will der Zeuge Stern., 70 Jahre alt, den Angeklagten Boger in der Nacht vom 31.7./1.8.1944 im Zigeunerlager gesehen haben. Er hat behauptet, er - der Zeuge - sei damals im Lagerabschnitt B II d untergebracht gewesen und habe die Vorgänge im Zigeunerlager aus einer Entfernung von 100 m beobachtet. Boger habe die Menschen zusammengeschlagen. Es seien insgesamt vielleicht 50 bis 100 Personen totgeschlagen worden. Boger habe mehr als 2 Zigeuner getötet.
Der Zeuge Stern. ist jedoch unglaubwürdig. Nach seinen eigenen Angaben leidet er an Gedächtnisschwäche. Er neigt nach dem Eindruck, den er in der Hauptverhandlung hinterlassen hat, zu phantasievollen Erzählungen. Ausserdem wirkte er, wenn er nach Einzelheiten gefragt wurde oder wenn ihm Vorhalte gemacht wurden, unsicher. Vielfach wich er präzisen Fragen aus, mit der Erklärung, das müsse so gewesen sein. In vielen Punkten hat er sich bei seiner Aussage in der Hauptverhandlung in Widerspruch zu seinen Angaben bei früheren Vernehmungen im Ermittlungsverfahren und vor dem Untersuchungsrichter verwickelt. Schliesslich hat er einige Behauptungen aufgestellt, die nachweislich nicht der Wahrheit entsprechen können. So hat er behauptet, der Angeklagte St. sei sowohl bei der "Liquidierung" des Theresienstädter Lagers als auch bei der "Liquidierung" des Zigeunerlagers dabeigewesen. Das kann jedoch nicht stimmen. Denn der Angeklagte St. ist bereits am 25.5.1943 endgültig vom KL Auschwitz zur Panzergrenadierdivision "Das Reich" versetzt worden, wie sich aus der in der Hauptverhandlung verlesenen Stammrolle des Angeklagten St. ergibt.
Ferner hat er behauptet, dass der Angeklagte Hofmann Lagerführer des Zigeunerlagers gewesen sei, als die Zigeuner in der Nacht vom 31.7. auf den 1.8. abtransportiert worden seien. Auch das ist unrichtig. Denn der Angeklagte Hofmann ist bereits im Mai 1944 vom KL Auschwitz zu dem KL Natzweiler versetzt worden, wie sich aus dem in der Hauptverhandlung verlesenen Kommandanturbefehl Nr.4/44 vom 18.5.1944 des KL Natzweiler ergibt. Unglaubhaft ist auch, dass der Zeuge aus dem Lagerabschnitt B II d die Vorgänge im Zigeunerlager genau beobachtet haben kann. Ebenso unwahrscheinlich ist es, dass er auf einer Entfernung von 100 m SS-Angehörige irrtumsfrei erkannt haben kann. Der Zeuge Berg., der ebenfalls in dem Lagerabschnitt B II d untergebracht war, hat - wie oben bereits ausgeführt - demgegenüber bekundet, dass er wegen der Dunkelheit nichts habe sehen können. Die Aussage des Zeugen Stern. war daher insgesamt unverwertbar.
Der Zeuge Piw. will ebenfalls den Angeklagten Boger beim Abtransport der Zigeuner zu den Gaskammern gesehen haben. Aber auch dieser Zeuge ist unglaubwürdig. Der Zeuge will den Abtransport der Zigeuner an einem Nachmittag beobachtet haben. Es sei - so hat er behauptet - bereits gegen Ende der Räumung des Zigeunerlagers gewesen. Seine Beobachtungen habe er in einem Gebüsch versteckt von dem Lagerabschnitt B II f (Krankenlager) aus gemacht. Boger hat mit anderen SS-Männern die Blöcke durchsucht. Die SS-Männer hätten aus den Blöcken Kinder herausgezogen. Sie hätten die Kinder hinter sich hergeschleift und zu dem Angeklagten Boger gebracht. Dieser hätte nach den Kindern getreten und sie dann an den Füssen gepackt und an die Wand geworfen. So sei es mit 6 Kindern geschehen. Ihm - dem Zeugen - sei es dann schlecht geworden und er sei weggelaufen. "Das ist die reine Wahrheit!" hat der Zeuge noch zur Bekräftigung seiner Angaben hinzugefügt. Er habe alles mit eigenen Augen gesehen, hat der Zeuge mit aller Bestimmtheit erklärt und seine Aussage mit dem Eid bekräftigt. Gleichwohl hat das Schwurgericht dem Zeugen nicht geglaubt. Er hat einen wenig glaubwürdigen Eindruck gemacht. Der Zeuge hat wahrscheinlich auf Grund von damaligen Lagergerüchten seine Angaben erfunden.
Die zuverlässigen Zeugen Dr. Bej., Am. und Berg. haben übereinstimmend bekundet, dass der Abtransport der Zigeuner in der Nacht vom 31.7./1.8.1944 stattgefunden habe und dass die Aktion gegen Morgen beendet gewesen sei. Die Zeugen Bej. und Am., die beide selbst im Zigeunerlager untergebracht waren, haben nichts davon bemerkt, dass sich Kinder versteckt und dem Abtransport entzogen hätten. Der Zeuge Bej., der sich als Häftlingsarzt auch noch am nächsten Tag im Zigeunerlager befunden hat, hätte es bemerken müssen, wenn der Angeklagte Boger mit anderen SS-Männern des nächsten Tages noch einmal die Blocks durchsucht und die Kinder an die Wand geworfen hätte. Der Zeuge Am. hat allerdings - so hat er angegeben - später von Sanitätern gehört, dass sich 4-5 Kinder in den Kaminen von Öfen versteckt haben sollen. Ob das stimmt, weiss der Zeuge nicht. Nach den Erzählungen der Sanitäter soll man die Kinder nach ihrer Entdeckung jedoch zu den Krematorien (Gaskammern) gebracht haben. Davon, dass der Angeklagte Boger Kinder an die Wand geworfen hätte, hat der Zeuge nichts gehört. Auch sonst hat kein Zeuge davon etwas gesehen oder gehört. Keiner der obenangeführten Zeugen hat auch bestätigt, dass während des Abtransportes der Zigeuner 50-100 Personen totgeschlagen worden seien.
Es erscheint auch unwahrscheinlich, dass der Zeuge sich in einem "Gebüsch" versteckt haben kann. In den Lagerabschnitten des Lagers Birkenau ist kein Gebüsch gewesen, in dem sich erwachsene Häftlinge hätten verstecken können. Bei seiner früheren Vernehmung im Ermittlungsverfahren hat der Zeuge Piw. auch nichts davon erwähnt, dass er sich in einem Gebüsch versteckt hätte. Er hat vielmehr damals erklärt, er habe sich in einem "Graben" versteckt. Auch diese widersprüchlichen Angaben lassen erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Zeugen aufkommen. Seine Aussage hat das Gericht daher insgesamt nicht verwertet.
Schliesslich will noch der Zeuge Pol. den Angeklagten Boger am 31.7.1944 vor dem Zigeunerlager gesehen haben. Der Zeuge hat bekundet, dass er ebenfalls im Zigeunerlager und zwar in Block 4 untergebracht gewesen sei. Am Abend des 31.7.1944 sei - so hat der Zeuge weiter ausgesagt - Blocksperre angeordnet worden. Er habe daraufhin Angst bekommen. Trotzdem habe er die Tür des Blockes ca. 20 cm breit geöffnet und kurz durch die Öffnung hindurchgeschaut. Dann habe er die Tür gleich wieder zugemacht. Bei dieser kurzen Beobachtung will der Zeuge gesehen haben, wie sich die SS-Männer vor dem Lager in Höhe der Blockführerstube versammelt hätten. Unter ihnen will der Zeuge den Angeklagten Boger erkannt haben.
Das Schwurgericht konnte jedoch auf Grund dieser Aussage nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass der Zeuge Pol. den Angeklagten Boger irrtumsfrei unter mehreren SS-Angehörigen erkannt hat. Der Zeuge hat nur ganz kurz beobachtet. Seine Beobachtungsmöglichkeit kann nur sehr beschränkt gewesen sein, da er die Tür nur 20 cm geöffnet hat. Die Entfernung von seinem Block (Nr.4) bis zur Blockführerstube, die ausserhalb des Lagerabschnittes lag, betrug nach dem in Augenschein genommenen Lageplan mehr als 100 m. Zieht man noch in Betracht, dass der Zeuge selbst in Angst war und dass die Sichtverhältnisse möglicherweise trotz der Beleuchtung der Lagerstrasse nicht einwandfrei waren, so kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Zeuge einer Sinnestäuschung zum Opfer gefallen ist und er einen SS-Mann oder SS-Unterführer irrig als den Angeklagten Boger angesehen hat. Wie wenig scharf der Zeuge Pol. beobachtet haben kann, ergibt sich auch daraus, dass er ausser dem Angeklagten Boger nur noch den Chef der Krematorien, den Oberscharführer Moll, erkannt haben will, während er sonst keine Namen nennen konnte. Ob Moll bei dem Abtransport der Zigeuner im Lager dabei war erscheint jedoch zweifelhaft. Denn Moll war Chef der 4 Krematorien und war somit für die Vergasungen und Verbrennungen der Leichen zuständig, jedoch nicht für den Abtransport der Häftlinge zu den Gaskammern.
Es konnte daher trotz erheblichen Verdachts, dass der Angeklagte Boger wegen seiner Zugehörigkeit zur Politischen Abteilung an der "Liquidierung" des Zigeunerlagers mitgewirkt hat, nicht mit jeden Zweifel ausschliessender Sicherheit festgestellt werden, dass der Angeklagte Boger zu der Tötung der Zigeuner einen kausalen Tatbeitrag geleistet hat. Er war daher auch von dem Schuldvorwurf unter Ziffer 24 des Eröffnungsbeschlusses mangels Beweises freizusprechen.
IV. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten St.
1.
Dem Angeklagten St. wird unter Ziffer 2 des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegt, in einer unbestimmten Anzahl von Fällen bei der rechtswidrigen Erschiessung von Häftlingen an der Schwarzen Wand zwischen Block 10 und 11 mitgewirkt zu haben.
Im 3. Abschnitt ist unter D.II.1. am Ende bereits ausgeführt worden, dass der Angeklagte St. ausser an der Erschiessung von zwei Gruppen jüdischer Menschen im kleinen Krematorium auch an weiteren Erschiessungen von Personen (die nicht uniformierte sowjetische Kriegsgefangene waren) im Hof zwischen Block 10 und 11 teilgenommen hat. Es konnte jedoch nicht festgestellt werden, dass es sich bei diesen Personen um Häftlinge aus dem Lager gehandelt hat. Er blieb ungeklärt - wie unter D.II.1. bereits ausgeführt - um welche Personengruppen es sich gehandelt hat. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei den Opfern um Zivilisten gehandelt hat, die auf Grund von Sondergerichts- oder Standgerichtsurteilen zur Vollstreckung der verhängten Todesstrafen in das Lager eingeliefert worden sind. Somit war nicht mit letzter Sicherheit zu klären, ob die Tötung dieser Menschen rechtmässig war und ob der Angeklagte St., falls Zivilpersonen von ausserhalb des Lagers rechtswidrig getötet worden sind, klar erkannt hat, dass die Erschiessung dieser Personen, an denen er auf Befehl seiner Vorgesetzten mitgewirkt hat, so dass seine strafrechtliche Verantwortlichkeit im Rahmen des §47 MStGB zu prüfen ist, ein allgemeines Verbrechen war. Dass er an Erschiessungen nach sog. Bunkerentleerungen teilgenommen hat, konnte nicht festgestellt werden.
2.
In Ziff.2 des Eröffnungsbeschlusses wird dem Angeklagten St. ferner zur Last gelegt, dass er ausserdem an der Erschiessung von sowjetischen Kriegsgefangenen teilgenommen haben soll. Nach Ziff.2 des Eröffnungsbeschlusses soll er insbesondere im Herbst 1941 zusammen mit anderen SS-Angehörigen an der Schwarzen Wand zwischen Block 10 und 11 jeweils abwechselnd etwa 20 bis 30 sowjetische Kommissare erschossen haben. Er selbst soll eigenhändig 5 oder 6 Kommissare getötet haben. Der Angeklagte St. hat eingeräumt, dass im September und Oktober 1941 zwei Transporte russischer Kommissare von ausserhalb in das Lager Auschwitz eingeliefert worden seien. Sie seien nicht in die Lagerstärke aufgenommen worden. Er - der Angeklagte - habe sie auf Befehl des Leiters der Politischen Abteilung, Grabner, zur Exekution in den Block 11 führen müssen. Dort seien die Kommissare an der Schwarzen Wand erschossen worden. An einer dieser Exekutionen habe er selbst teilgenommen. Zunächst hätten Palitzsch und ein Blockführer einen Teil der Kommissare erschossen. Dann hätte ihm Grabner befohlen, weiter zu machen. Er habe dann eigenhändig mindestens 4 Kommissare erschossen. Nach der Exekution habe er die eine Hälfte der Erkennungsmarken der Kommissare abbrechen müssen. Auf den Karteikarten, die mit den Kriegsgefangenen in das Lager gekommen seien, hätte er vermerken müssen: "Liquidiert gemäss OKW-Befehl." Die Exekutionen seien auf Grund eines OKW-Befehles erfolgt. Den Befehl selbst habe er nicht gelesen. Bei einer Dienstbesprechung sei aber über den OKW-Befehl gesprochen worden. Er - St. - habe den Befehl des OKW und die Erschiessung der sowjetischen Kriegsgefangenen damals für rechtmässig gehalten.
Nach dieser Einlassung des Angeklagten St. kann kein Zweifel bestehen, dass es sich bei den russischen Kriegsgefangenen um politische Kommissare gehandelt hat, die gemäss dem OKW-Befehl vom 6.6.1941 und den danach ergangenen weiteren Befehlen und Richtlinien zum Zwecke der "Liquidierung" in das KL Auschwitz eingeliefert worden sind (vgl. 2. Abschnitt VII.3.). Es kann auch nicht zweifelhaft sein, dass die Tötung dieser Person rechtswidrig war. Denn die russischen Kommissare waren nicht durch ein Gericht zum Tode verurteilt worden. Ihre "Liquidierung" erfolgte nur deswegen, weil sie Funktionäre der KPdSU waren.
Der Angeklagte St. hat an der Tötung der in das Lager eingelieferten Kommissare auf Befehl mitgewirkt. Nach §47 MStGB Abs.1 Nr.2 ist er hierfür strafrechtlich nur verantwortlich, wenn ihm bekannt gewesen ist, dass die Befehle des Vorgesetzten eine Handlung betrafen, die ein allgemeines oder militärisches Verbrechen oder Vergehen bezweckten. Der Angeklagte St. beruft sich darauf, dass er die Tötung der russischen Kriegsgefangenen für rechtmässig gehalten habe, weil sie durch das OKW angeordnet worden sei, und dass die Erschiessungen nach Kriegsrecht erlaubt seien. Das kann ihm nicht widerlegt werden. Ihm kann nicht mit letzter Sicherheit nachgewiesen werden, dass er die Hintergründe für die Tötung der sowjetrussischen Kommissare gekannt hat. Was dem Angeklagten St. bei der Dienstbesprechung im KL Auschwitz über die Hintergründe für die Erschiessung der Kommissare mitgeteilt worden ist, konnte nicht mehr geklärt werden. Es ist daher möglich, dass er geglaubt hat, die Erschiessung der Kommissare erfolge als kriegsrechtlich erlaubte Repressalie gegen Saboteure oder Partisanen, wobei es nicht darauf ankommt, ob solche Repressalien rechtlich erlaubt sind oder nicht. Es kommt allein darauf an, ob der Angeklagte St. positive Kenntnis von dem Unrechtscharakter der Tötung der russischen Kriegsgefangenen gehaben hat. Da nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte, dass der Angeklagte St. gewusst hat, dass die russischen Kommissare bereits als Kriegsgefangene in Kriegsgefangenenlagern untergebracht gewesen waren und sich nichts hatten zuschulden kommen lassen und nur wegen ihrer Funktion in der Roten Armee bzw. der KPdSU getötet wurden, kann auch nicht gesagt werden, dass sich ihm die Erkenntnis hätte aufdrängen müssen, dass die Tötung der Kommissare rechtswidrig sei und dass der Unrechtscharakter ihrer Tötung so klar auf der Hand gelegen hätte, dass seine Behauptung, er habe die Erschiessung der Kommissare für rechtmässig gehalten, nur eine Schutzbehauptung sei. Nicht ausreichend für seine strafrechtliche Verantwortlichkeit ist, dass er hätte wissen müssen, dass die Erschiessung der russischen Kommissare nicht rechtmässig sein könne.
Eine Verurteilung des Angeklagten St. wegen der Mitwirkung an einer Tötung russischer Kriegsgefangener konnte daher nicht erfolgen.
3.
Dem Angeklagten St. wird ferner unter Ziffer 2b des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegt, im Frühjahr 1942 einen Häftling an der "Schwarzen Wand" erschossen zu haben, nachdem er zunächst zusammen mit dem Rapportführer Palitzsch auf Grund einer durch Namensgleichheit hervorgerufenen Verwechslung einen anderen Häftling erschossen gehabt habe.
Hierzu hat der Zeuge Bart. folgendes bekundet: Eines Tages habe der Rapportführer Palitzsch dem Angeklagten St. das Gewehr gegeben und habe zu ihm gesagt, er solle gehen. St. sei daraufhin mit dem Gewehr weggegangen. Es seien zwei bis drei Personen erschossen worden (was der Zeuge Bart. allerdings nicht gesehen hat). Nach seiner Rückkehr habe St. gesagt: "Ein Häftling ist erschossen worden, der nicht erschossen werden sollte. Mein Gott, was wird Grabner dazu sagen!"
Nach dieser Aussage des Zeugen Bart. kann zwar davon ausgegangen werden, dass der Angeklagte St. an der Erschiessung von zwei bis drei Personen mitgewirkt, sie wahrscheinlich sogar selbst erschossen hat. Es fehlen jedoch Anhaltspunkte dafür, um welche Personen es sich gehandelt hat. Möglich ist, dass es Häftlinge waren, die sich als Geiseln im Lager befanden und auf Grund einer Exekutionsanordnung des RSHA erschossen werden sollten. Möglich ist auch, dass es Personen waren, die auf Grund eines Sondergerichts- oder Standgerichtsurteils zur Vollstreckung einer verhängten Todesstrafe in das Lager gebracht worden waren. Nach der vom Zeugen Bart. zitierten Äusserung des Angeklagten St. muss angenommen werden, dass Grabner die Exekution der Personen befohlen hat. St. hat somit auf Befehl an der Erschiessung der Personen mitgewirkt bzw. sie auf Befehl erschossen. Was dem Angeklagten St. über den Grund der Erschiessung dieser Personen gesagt worden ist, konnte nicht geklärt werden. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass der Angeklagte St. geglaubt hat, die Personen seien von einem Gericht zum Tode verurteilt worden und ihre Tötung sei rechtmässig. Ihm hat daher die positive Kenntnis, dass die Erschiessung dieser Personen verbrecherisch sei, gefehlt, so dass er hierfür strafrechtlich nicht verantwortlich ist (§47 MStGB). Wenn er eine Person irrtümlich erschossen hat, die nicht erschossen werden sollte, was auf Grund seiner Äusserung gegenüber Bart. anzunehmen ist, so kann er sich in einem Irrtum über die tatsächlichen Voraussetzungen eines Rechtfertigungsgrundes befunden haben. Er kann nämlich irrtümlich angenommen haben, dass gegen die Person, die er irrtümlich erschossen hat, ebenfalls ein rechtmässiges Todesurteil vorläge und dass die Tötung dieser Person rechtmässig sei. Aus subjektiven Gründen kann er daher wegen der Erschiessung dieser Person ebenfalls strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden.
Im übrigen wird dem Angeklagten St. die Erschiessung dieser zwei bis drei Personen unter Ziff.2b des Eröffnungsbeschlusses nicht zur Last gelegt. Ihm wird nur vorgeworfen, dass er nach der Exekution eines Häftlings einen weiteren Häftling (der ursprünglich auf Befehl Grabners hätte erschossen werden sollen und an dessen Stelle der Angeklagte St. irrtümlich einen anderen Häftling getötet habe) erschossen habe. Der Zeuge Bart. hat bei seiner Vernehmung in der Hauptverhandlung nicht bekundet, dass der Angeklagte St. nach der Rückkehr von der Exekution und nach der gemachten zitierten Äusserung noch einen weiteren Häftling hätte erschiessen müssen. Aber auch wenn man annimmt, dass St. auf Befehl Grabners auch noch die Person, an dessen Stelle er einen anderen Häftling erschossen hatte, anschliessend hat erschiessen müssen, kann nicht festgestellt werden, welches der Grund für die Exekution dieses Menschen gewesen ist. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Befehl Grabners auf ein Sondergerichts- oder Standgerichtsurteil gestützt hat und dass St. geglaubt hat - vielleicht irrig, falls die Tötung dieser Person rechtswidrig gewesen ist, was zu vermuten ist - die Tötung dieses Menschen sei rechtmässig. Jedenfalls kann ihm das Gegenteil nicht nachgewiesen werden.
Der Angeklagte St. war daher von den Schuldvorwürfen unter Ziffer 2 des Eröffnungsbeschlusses mangels Beweises freizusprechen.
4.
Dem Angeklagten St. wird schliesslich durch die Nachtragsanklage, die mit seiner Zustimmung in das Verfahren einbezogen worden ist, zur Last gelegt, im Jahre 1941 in dem KL Auschwitz durch mehrere selbständige Handlungen teils allein, teils gemeinschaftlich mit anderen aus Mordlust und aus sonst niedrigen Beweggründen heimtückisch und grausam Menschen getötet zu haben.
Der Angeklagte St. soll nach der Nachtragsanklage im Sommer 1941, als er eines Tages drei Zivilisten vom Lagereingang durch das Stammlager Auschwitz I zum Block 11 gebracht und dabei an einer Baustelle vorbeigeführt habe, eine Gruppe von Häftlingen der Strafkompanie, die dort mit Ausschachtungsarbeiten beschäftigt gewesen sei, in die etwa 4 m tiefe und halb mit Wasser gefüllte Grube hineingestossen haben, so dass hierbei zwei Häftlinge den Tod gefunden hätten. Er soll ferner im Anschluss an diesen Vorfall, nachdem er die drei Zivilisten im Block 11 abgeliefert gehabt habe, mit einem SS-Unterführer der Strafkompanie wieder zu der Baustelle zurückgekehrt sein und zusammen mit diesem die Angehörigen der Strafkompanie sog. "Sport" haben machen lassen; dabei hätten die Häftlinge in die halb mit Wasser gefüllte Baugrube hineinspringen müssen und ein besonders starker Häftling namens Isaak soll auf Befehl St's mehrere Häftlinge so lange unter Wasser gedrückt haben, bis diese Häftlinge tot gewesen seien. Als Isaak schliesslich auf diese Weise auch noch seinen eigenen Vater hätte ertränken müssen, sei er wahnsinnig geworden, woraufhin der Angeklagte St. den Häftling Isaak mit seiner Pistole erschossen haben soll. Insgesamt sollen hierbei 20 Häftlinge gestorben sein.
Der Angeklagte St. bestreitet entschieden, an einem solchen Vorfall beteiligt gewesen zu sein.
Zu dem Schuldvorwurf hat nur der Zeuge Krx. Bekundungen gemacht. Er hat folgendes geschildert: Im Sommer 1941 hätte die SK beim Block 15 Ausschachtungsarbeiten gemacht. Er - der Zeuge - habe damals als Maurer gearbeitet. Er habe die Ecke des Blockes 4 mauern müssen. Eines Tages habe der Angeklagte St. 3 Zivilisten in Richtung des Blockes 11 geführt. Auf dem Wege zu Block 11 sei er an der von den Häftlingen der SK ausgehobenen Grube vorbeigekommen. Die Grube sei etwa 4 m tief und mit Wasser gefüllt gewesen. Die Tiefe des Wassers habe 1 1/2 bis 2 m betragen. St. habe die Häftlinge der SK in das Wasser hineingetrieben. Den Grund hierfür wisse er - der Zeuge - nicht. Wahrscheinlich hätten die Häftlinge der SK den drei Zivilisten nachgeschaut. Die Häftlinge der SK hätten einer über den anderen in die Grube hineinspringen müssen. Dabei seien zwei Häftlinge im Wasser ertrunken. St. sei dann mit den drei Zivilisten zu Block 11 gegangen. Nach deren Ablieferung sei er in Begleitung des Oberscharführers Engelschall zurückgekommen. Beide hätten nun die Häftlinge der SK "Sport machen" lassen. Die Häftlinge hätten von oben in das Wasser hineinspringen und darin herumschwimmen müssen. Anschliessend hätten sie wieder heraussteigen müssen. Das sei längere Zeit so gegangen. Nachdem die Häftlinge der SK durch das Hineinspringen in das Wasser und das Herauskommen aus dem Wasser ermüdet gewesen seien, habe man einem Juden namens Isaak befohlen, die Häftlinge im Wasser zu ertränken. Der Jude sei ein sehr starker Mensch gewesen. Er habe etwa 20 Häftlinge ertränkt. Schliesslich habe man dem Isaak befohlen, seinen eigenen Vater zu ertränken. Während Isaak seinen Vater ertränkt habe, sei er wahnsinnig geworden und habe angefangen zu schreien. Daraufhin habe St. den Isaak erschossen. Er - der Zeuge - habe das aus einer Entfernung von 20 m beobachtet.
Das Gericht konnte auf Grund dieser Aussage des Zeugen Krx. nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass sich der von ihm geschilderte Vorfall tatsächlich abgespielt hat und
dass, falls er sich tatsächlich so abgespielt haben sollte, wie es der Zeuge Krx. geschildert hat, der Angeklagte St. daran beteiligt gewesen ist.
Gegen die Glaubwürdigkeit des Zeugen Krx. bestehen Bedenken. Hierzu kann auf die Ausführungen im 3. Abschnitt unter E.IV.2. Bezug genommen werden.
In diesem Fall ist auffällig, dass der Zeuge Krx. bei seiner Anhörung durch den Zeugen Sm. von diesem grauenhaften Vorfall nichts erzählt hat. Es erscheint unwahrscheinlich, dass er ein Ereignis, bei dem der Sohn seinen eigenen Vater hat ertränken müssen, vergessen haben kann. Wenn der Zeuge tatsächlich Augenzeuge des geschilderten Vorfalls gewesen ist, muss es sich um eines seiner schwersten Erlebnisse gehandelt haben, so dass es kaum verständlich erscheint, dass er dem Zeugen Sm. nichts davon erzählt hat, als dieser ihn über seine Erlebnisse im KL Auschwitz ausfragte.
Weitere Bedenken bestehen deshalb, weil damals - wie oben unter E.IV.2. bereits erwähnt - zwischen den polnischen Häftlingen und einer Gruppe ukrainischer Häftlinge zu denen die Gebrüder Bandera gehörten, starke Spannungen bestanden. Der Zeuge Krx. wurde damals, wie er gegenüber dem Zeugen F. bereits im Lager geäussert hat, für den Tod der Gebrüder Bandera verantwortlich gemacht. Er wurde deswegen festgenommen und in den Arrestbunker eingeliefert. Der Angeklagte St. war damals der Betreuer der ukrainischen Häftlinge. Er sorgte dafür, dass sie besser untergebracht wurden und allmählich in gewissen Funktionen im Lager aufrückten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Zeuge Krx. den Angeklagten St. dafür verantwortlich macht, dass er - Krx. - für den Tod der Gebrüder Bandera damals zur Rechenschaft gezogen, misshandelt und in den Arrestbunker eingeliefert worden ist. Dies kann zwar nicht mit Sicherheit festgestellt werden, muss aber bei der Würdigung der Aussage des Zeugen Krx. in Betracht gezogen werden. Möglicherweise hat Krx. aus diesem Grund den Angeklagten St. zu Unrecht belastet.
Auffällig ist, dass kein anderer Zeuge etwas von dem Vorfall, der auch nach den damaligen Lagerverhältnissen ein furchtbares Erlebnis für alle Beteiligten gewesen sein muss, gewusst oder gehört hat. Kein Zeuge hat die Aussage des Zeugen Krx. bestätigt. Schliesslich muss auch in Betracht gezogen werden, dass sich der Zeuge Krx., selbst wenn sich der Vorfall so abgespielt hat, wie er es geschildert hat, in der Person des Täters geirrt haben kann. Bei dem Zeugen Krx. kann diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, da er sich auch in anderer Hinsicht - wie unter E.IV.2. näher ausgeführt worden ist - als unzuverlässig gezeigt hat. Den Angeklagten Dylewski hat er ebenfalls mit Ereignissen in Verbindung gebracht, an denen dieser Angeklagte mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht beteiligt gewesen ist. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass er auch den Angeklagten St. mit dem geschilderten Vorfall zu Unrecht in Verbindung bringt, wenn auch dem Angeklagten St. nach seinem sonstigen Verhalten im KL Auschwitz die Tat ohne weiteres zuzutrauen ist.
Auf die Aussage des Zeugen Krx. allein konnten daher keine sicheren Feststellungen zum Nachteil des Angeklagten St. gestützt werden.
Der Angeklagte St. war daher von dem Schuldvorwurf in der Nachtragsanklage mangels Beweises freizusprechen.
V. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Dylewski
1.
Dem Angeklagten Dylewski wird unter Ziffer 4 des Eröffnungsbeschlusses auch die Beteiligung an Erschiessungen von sowjetischen Kriegsgefangenen in den Jahren 1941/1942 zur Last gelegt.
Hierzu hat der russische Zeuge Mi. ausgesagt, er sei als russischer Kriegsgefangener im Oktober 1941 mit anderen russischen Kriegsgefangenen in das Stammlager in Auschwitz gekommen. Zunächst sei er in einem Block des für die russischen Kriegsgefangenen eingerichteten Kriegsgefangenenlagers im Stammlager untergebracht gewesen. Später sei er mit anderen Kriegsgefangenen von ihren Kameraden isoliert worden. Sie seien in das sog. Kommando "Au" gekommen. Tagsüber seien sie in ihrer Stube eingeschlossen worden und hätten ihre Stube nicht verlassen dürfen. Nachts seien SS-Männer gekommen und hätten die Kriegsgefangene aus dem Kommando "Au" aufgerufen und zum Erschiessen weggebracht. Einmal sei auch der Angeklagte Dylewski bei dieser Kommission gewesen. Weitere Angaben konnte der Zeuge hierzu nicht machen. Insbesondere hat er nicht ausgesagt, dass der Angeklagte Dylewski bei dieser Gelegenheit irgendeine Tätigkeit entfaltet hätte.
Nach dieser Aussage kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass der Angeklagte Dylewski an der Erschiessung von russischen Kriegsgefangenen beteiligt gewesen ist. Der Zeuge hat bekundet, dass die nächtlichen Besuche der SS-Männer in der Zeit zwischen November 1941 bis Januar 1942 stattgefunden hätten. Woher der Zeuge den Angeklagten Dylewski bereits zu dieser Zeit gekannt haben soll, ist nicht ersichtlich. Die SS-Angehörigen haben sich den russischen Kriegsgefangenen nicht vorgestellt. Der Zeuge hat auf die Frage, woher er den Angeklagten Dylewski gekannt habe, erklärt, er habe ihn in der Schreibstube getroffen, als er in der Politischen Abteilung überprüft worden sei. Das sei in der zweiten Hälfte des Oktober 1942 gewesen. Dylewski habe bei dieser Gelegenheit ein einfaches Verhör durchgeführt. Demnach könnte der Zeuge den Angeklagten Dylewski erst im Oktober 1942 kennengelernt haben. Es erscheint unwahrscheinlich, dass der Zeuge im Oktober 1942 den Angeklagten Dylewski von einem einmaligen Sehen während der Nacht fast ein Jahr zuvor wiedererkannt haben soll, zumal mehrere SS-Männer während der Nacht in die Stube, in der sich der Zeuge befand, gekommen sind und alle Kriegsgefangenen in Angst schwebten, zur Erschiessung abgeholt zu werden. Möglich ist allerdings, dass sich der Zeuge Mi. im Jahr geirrt oder versprochen hat und dass seine Überprüfung bereits im Oktober 1941 gewesen ist. Das muss sogar angenommen werden, da logischerweise die Überprüfung der Kriegsgefangenen vor ihrer Einweisung in das Kommando "Au" gewesen sein muss. Aber auch wenn der Zeuge Mi. bereits im Oktober 1941 überprüft und in der Politischen Abteilung vernommen worden ist, erscheint es nicht sicher, dass er bei seiner Überprüfung erfahren hat, dass der Vernehmende der Angeklagte Dylewski sei. Die Angehörigen der Politischen Abteilung haben sich den Angeklagten, die sie vernommen bzw. überprüft haben, nicht vorgestellt. Möglicherweise ist dem Zeugen durch einen anderen Häftling der vernehmende SS-Angehörige irrtümlich als der Angeklagte Dylewski bezeichnet worden. Nicht sicher erscheint es auch, dass die russischen Kriegsgefangenen überhaupt von den Angehörigen der Politischen Abteilung vernommen worden sind. Für die Überprüfung der Kriegsgefangenen waren besondere Einsatzkommandos gebildet worden. Es ist daher eher anzunehmen, dass sie von Angehörigen eines solchen Einsatzkommandos überprüft worden sind. Wahrscheinlich nimmt der Zeuge heute - nach über 20 Jahren - aus nicht näher zu erforschenden Gründen irrig an, dass ihn der Angeklagte Dylewski überprüft habe.
Nicht sicher erscheint es auch, dass der Zeuge, selbst wenn er den Angeklagten Dylewski bereits im November 1941 gekannt haben sollte, während der Nacht in der Stube den Angeklagten Dylewski unter mehreren SS-Angehörigen einwandfrei hat identifizieren können, zumal der Zeuge nichts Auffälliges über den Angeklagten Dylewski hat berichten können und er selbst mit grosser Wahrscheinlichkeit in Angst geschwebt hat, selbst zur Erschiessung gebracht zu werden. Schliesslich kann der Zeuge auch nicht wissen, ob der Angeklagte Dylewski anschliessend, sofern die aufgerufenen Kriegsgefangenen sofort danach erschossen worden sein sollten, was der Zeuge ebenfalls nicht wissen kann, an den Erschiessungen teilgenommen hat. Wegen der aufgezeigten Unsicherheiten konnte das Gericht auf Grund der Aussage des Zeugen Mi. nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass der Angeklagte Dylewski an der Erschiessung russischer Kriegsgefangener beteiligt war, wenn hierfür auch ein erheblicher Verdacht bestehen mag.
Ferner hat der Zeuge Joa. behauptet, dass die Angeklagten St. und Dylewski russische Kriegsgefangene, die mit Sankas zum Block 11 gebracht worden seien, erschossen hätten. Der Zeuge konnte in der Hauptverhandlung nicht vernommen werden. Seine Vernehmung erfolgte am 26.4.1965 durch das Kreisgericht in Krakau. Das Protokoll über diese Vernehmung wurde in der Hauptverhandlung verlesen. Das Gericht war somit nicht in der Lage, sich einen persönlichen Eindruck von dem Zeugen und seiner Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Gegen seine Glaubwürdigkeit bestehen Bedenken.
Der Zeuge hat zunächst die Erschiessung der russischen Kriegsgefangenen so dargestellt, als ob er sie selbst mit angesehen habe. Wörtlich hat er folgendes geschildert:
"Im Frühjahr 1942, als ich auf dem Block Nr.15 A war, sah ich einige Male im Verlauf einer bestimmten Zeitspanne mehrere Male an einem Tag die Sankas zum Block 11 kommen, und ich sah, dass oft bis 15 Personen, die mit russischen Militärmänteln bekleidet waren, ausgestiegen sind und man danach diese Personen auf den Block, genauer gesagt auf den Hof des Blockes Nr.11 führte. Gleich danach hörte ich die Erschiessungen von diesen Personen und sah dann, dass andere Häftlinge die Körper dieser erschossenen Personen mit einem Wagen fortbrachten. Ich sah aus geringer Entfernung, etwa von ca. 20 m, dass an jeder solchen Exekutionen Dylewski und St. persönlich teilgenommen haben ...."
Nach dieser Aussage muss man annehmen, dass der Zeuge persönlich aus einer Entfernung von ca. 20 m gesehen haben will, wie die Angeklagten Dylewski und St. die russischen Kriegsgefangenen erschossen haben.
Später hat der Zeuge jedoch seine Aussage auf die Frage der Staatsanwaltschaft, von welcher Stelle aus er so genau die Erschiessungen habe beobachten können, eingeschränkt. Er hat erklärt, dass er auf dem Block 15 A untergebracht gewesen sei. Die Erschiessungen habe er aus dem Fenster des Blockes Nr.15 A gesehen, hat jedoch hinzugefügt, dass er "natürlich" die Aktion nicht habe sehen können, er habe aber die Schüsse gehört und habe gesehen, wie die sowjetischen Kriegsgefangenen gebracht worden seien und von Dylewski und St., welche Karabiner mitgebracht hätten, hineingeführt worden seien.
Von Block 15 kann der Zeuge aber kaum die Schüsse gehört haben. Denn in der Regel wurden die Erschiessungen mit einem Kleinkalibergewehr, auf das ein Schalldämpfer aufgesetzt wurde, durchgeführt. Die Behauptung des Zeugen, er habe die Schüsse gehört, erscheint daher ebenso unglaubhaft wie seine ursprüngliche Behauptung, er habe die Erschiessungen aus einer Entfernung von ca. 20 m selbst mit angesehen. Der Block 15 war nach dem Lagerplan erheblich mehr als 20 m von Block 11 entfernt. Block 15 stand in der zweiten Blockreihe vom Lagereingang aus gesehen, während Block 11 in der dritten (letzten) Reihe stand. Zwischen Block 15 und Block 11 befanden sich noch mehrere andere Blocks. Die Lagerstrasse, auf der wahrscheinlich die Kriegsgefangenen von dem Lagertor zu dem Block 11 in dem Sanka gefahren worden sind, führte nicht unmittelbar an Block 15 vorbei. Zwischen Block 15 und der Lagerstrasse, die vom Lagertor zu der hintersten Blockreihe führte, befand sich noch der Block 16. Es erscheint daher fraglich, ob der Zeuge überhaupt hat beobachten können, wie die Kriegsgefangenen zu Block 11 gefahren worden sind. Ausgeschlossen erscheint es, dass der Zeuge das Aussteigen der Kriegsgefangenen vor dem Block 11 von Block 15 aus hat beobachten können. Die Sicht zu Block 11 aus den Seitenfenstern des Blockes 15 war durch andere Blocks verdeckt. Eine Sichtmöglichkeit aus einem der Fenster an der Giebelseite des Blockes 15 zu Block 11 hin könnte allenfalls bestanden haben, wenn sich der Zeuge ganz weit aus einem dieser Fenster hinausgebeugt hätte. Das erscheint jedoch unwahrscheinlich. Denn vor Erschiessungen wurde in der Regel Blocksperre angeordnet. Die Häftlinge durften die Blocks nicht verlassen und auch nicht aus den Fenstern der Blöcke herausschauen. Die SS-Männer achteten darauf, dass sich kein Häftling an den Fenstern zeigte. Es erscheint daher völlig unwahrscheinlich, dass sich der Zeuge aus einem der Fenster hinausgebeugt haben soll.
Bei der Art wie der Zeuge seine Aussage gemacht hat, dass er nämlich zunächst die Erschiessungen selbst angesehen haben will, was er später zurücknehmen musste, erscheint es nicht ausgeschlossen, dass der Zeuge nur von anderen Häftlingen etwas über die Erschiessung der russischen Kriegsgefangenen und die daran beteiligten SS-Männer gehört hat und dass er das, was er gehört hat, nun als eigene Beobachtungen wiedergibt.
Das Gericht konnte daher auf Grund seiner Aussage keine sicheren Feststellungen zum Nachteil des Angeklagten Dylewski treffen.
Der Angeklagte Dylewski musste daher von dem Vorwurf, an der Erschiessung russischer Kriegsgefangener beteiligt gewesen zu sein, mangels Beweises freigesprochen werden.
2.
Dem Angeklagten Dylewski wird schliesslich in Ziffer 5 des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegt, er habe die Häftlinge Sojecki und Pisenczykiewicz bei einem Verhör so schwer misshandelt, dass sie daran gestorben seien.
Zu diesen Schuldvorwürfen hat ebenfalls nur der Zeuge Joa. Bekundungen gemacht.
Er hat erklärt, Sojecki sei eines Tages im Frühjahr 1942 oder Ende 1941 von Dylewski aus dem Block 11 und zwar aus der Strafkompanie geholt und zur Politischen Abteilung gebracht worden. Sojecki sei sehr lange bei dieser Vernehmung geblieben und sei dort sehr geschlagen worden. Mithäftlinge hätten ihn dann wieder auf Block 11 zurückgebracht. Später sei er erneut von Dylewski vernommen worden. Nach dieser Vernehmung sei Sojecki nicht mehr auf Block 11 zurückgekommen. Jede Spur sei von ihm verschwunden. In der SK habe man gemeldet, dass Sojecki gestorben sei.
Diese Aussage enthält einige Unklarheiten. Der Zeuge hat behauptet, er habe selbst gesehen, wie der Angeklagte Dylewski den Sojecki aus Block 11 abgeholt habe. Von wo er diese Beobachtung gemacht haben will, hat der Zeuge nicht angegeben. Nach seiner Aussage war er selbst nicht in Block 11 untergebracht. Wie er angegeben hat, hat er von Sommer 1941 bis zur Hälfte des Jahres 1942 als Hilfsarbeiter in dem IG-Farben Buna-Werk gearbeitet. Das war gerade in der Zeit, in der der Häftling Sojecki von Dylewski von Block 11 abgeholt worden sein soll. Wenn aber der Zeuge im Buna-Werk in Monowitz gearbeitet hat, kann er die Abholung von Sojecki nicht gesehen haben. Allerdings hat er später auf Befragen der Staatsanwaltschaft erklärt, er sei während dieser Zeit krank geworden und habe sich deswegen auf dem Gebiet des Stammlagers, insbesondere auf Block 15 A aufgehalten, wohin ihn ein Kamerad namens Zycki gebracht habe.
Wenn der Zeuge Joa. aber krank war, ist kaum zu erklären, wieso er gesehen haben kann, dass der Angeklagte Dylewski den Sojecki aus dem Block 11 abgeholt hat, zumal Block 15 A und Block 11 weit auseinander lagen. Aus der Aussage des Zeugen geht auch nicht hervor, woher er weiss, dass der Angeklagte Dylewski den Sojecki vernommen hat. Er behauptet selbst nicht, dass er bei der Vernehmung dabeigewesen sei. Er musste auf Befragen des Woidwodschaftsstaatsanwalts einräumen, dass er mit dem Häftling Sojecki über seine Vernehmung nicht gesprochen habe. Von Sojecki kann er es also nicht erfahren haben.
Ferner bleibt ungeklärt, woher der Zeuge weiss, dass Sojecki bei der ersten Vernehmung lange geblieben und sehr geschlagen worden ist. Schliesslich hat der Zeuge auch nicht näher erläutert, woher er weiss, dass der Angeklagte Dylewski die zweite Vernehmung des Sojecki durchgeführt hat und dass in die SK gemeldet worden ist, dass Sojecki gestorben sei. Er selbst kann von dieser Meldung nicht unmittelbar erfahren haben, da er gar nicht in Block 11 untergebracht war. Auch in diesem Fall besteht der Verdacht, dass der Zeuge seine Angaben nur auf die Erzählung anderer Kameraden gestützt hat, ohne dass nachgeprüft werden kann, ob das, was ihm andere Häftlinge berichtet haben, der Wahrheit entspricht.
Es kann daher nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass der Angeklagte Dylewski den Häftling Sojecki vernommen und dabei so schwer misshandelt hat, dass der Häftling anschliessend gestorben ist, ganz abgesehen davon, dass jegliche Anhaltspunkte dafür fehlen, dass der Angeklagte Dylewski den Sojecki mit Tötungsvorsatz (direktem oder bedingtem Vorsatz) geschlagen hat.
Der Zeuge Joa. hat ferner behauptet, dass der Angeklagte Dylewski einen Häftling namens Pisenczykiewicz mehrfach vernommen und dabei so geschlagen habe, dass dieser Häftling dabei gestorben sei. Pisenczykiewicz sei - so hat der Zeuge Joa. bekundet - in Block 15 untergebracht gewesen. Im Jahre 1941 oder 1942 habe Dylewski diesen Häftling im Verlaufe von 2-3 Tagen mehrfach aus dem Block abgeholt und zu der Politischen Abteilung geführt. Wenn Pisenczykiewicz von den Verhören zurückgekommen sei, habe er - der Zeuge - gesehen, dass der Kopf des Häftlings so geschwollen gewesen sei, dass er wie ein "Ballon" ausgesehen habe. Nach einer dieser Vernehmungen habe ihm Pisenczykiewicz gesagt, dass ihn Dylewski verhört habe, und dass man ihm irgendwelche Verbindungen mit militärischen Formationen vorwerfe. Dylewski habe ihn während der Vernehmung auf so schreckliche Weise gefoltert.
Der Zeuge Joa. hat dann weiter erklärt, dass Pisenczykiewicz nach einem der Verhöre gestorben sei, und zwar etwa eine Stunde nach der Vernehmung.
Auch hier bestehen Bedenken, ob die Angaben des Zeugen der Wahrheit entsprechen. Dem Häftling Pisenczykiewicz soll die Verbindung zu einer militärischen Organisation zur Last gelegt worden sein. Dann erscheint es unwahrscheinlich, dass man Pisenczykiewicz nach einem Verhör wieder zu Block 15 zurückgeführt und freigelassen habe. In der Regel wurden Häftlinge - nach den in der Beweisaufnahme getroffenen Feststellungen - jeweils in den Arrestbunker des Blockes 11 eingeliefert, wenn sie in den Verdacht gerieten, Mitglieder einer militärischen Untergrundorganisation oder Widerstandsgruppe zu sein. Von Block 11 wurden sie dann zu den Vernehmungen in die Vernehmungsbaracke der Politischen Abteilung geführt. Damit wollte man verhindern, dass die Verdächtigen ihre Kameraden warnen und über den Inhalt ihrer Vernehmungen anderen Häftlingen Informationen geben konnten. Wenn Pisenczykiewicz nach den Vernehmungen stets wieder in den Block 15 gebracht worden wäre, hätte er seine Kameraden über das, was ihm durch die Vernehmungen zur Kenntnis kam, ins Bild setzen und sich mit ihnen absprechen können. Dass man das zugelassen hat, erscheint sehr zweifelhaft.
Nicht sicher ist ferner, ob tatsächlich der Angeklagte Dylewski den Pisenczykiewicz vernommen hat, auch wenn man unterstellt, dass Dylewski ihn mehrfach zu Vernehmungen abgeholt hat. Der Zeuge Joa. war bei den Vernehmungen nicht dabei. Nach seiner Aussage soll ihm Pisenczykiewicz erklärt haben, Dylewski habe ihn gefoltert. Ob Pisenczykiewicz den Angeklagten Dylewski einwandfrei erkannt hat, lässt sich nicht mehr nachprüfen. Unklar bleibt, woher Pisenczykiewicz die Namen der einzelnen Angehörigen der Politischen Abteilung erfahren hat. Möglich ist immerhin, dass Pisenczykiewicz den Angeklagten Dylewski mit einem anderen SS-Unterführer verwechselt hat. Denkbar ist zum Beispiel, dass der SS-Unterscharführer Lachmann, der ebenfalls gut polnisch sprach, die Vernehmungen durchgeführt hat. Ferner muss in Betracht gezogen werden, dass die Behauptung des Zeugen, Pisenczykiewicz habe ihm - dem Zeugen - den Angeklagten Dylewski als denjenigen bezeichnet, der ihn vernommen und geschlagen habe, überhaupt nicht stimmt. Bei den Bedenken, die gegen die Glaubwürdigkeit des Zeugen nach den obigen Ausführungen bestehen, kann dies jedenfalls nicht ausgeschlossen werden.
Schliesslich kann auch nicht festgestellt werden, dass der Angeklagte Dylewski, selbst wenn man davon ausgeht, dass er den Pisenczykiewicz vernommen und misshandelt hat, mit Tötungsvorsatz (direktem oder bedingtem Vorsatz) gehandelt hat. Bei der Persönlichkeit des Angeklagten Dylewski, wie sie von den Zeugen P., Pi., Ber. und Bur. geschildert worden ist (vgl. oben, 3. Abschnitt E.IV.2) kann das nicht ohne weiteres festgestellt werden. Kein anderer zuverlässiger Zeuge hat ausgesagt, dass der Angeklagte Dylewski einen Häftling bei Vernehmungen getötet oder so schwer misshandelt habe, dass der betreffende Häftling anschliessend gestorben sei.
Zusammenfassend lässt sich somit nicht mit Sicherheit feststellen, dass der Angeklagte Dylewski den Häftling Pisenczykiewicz bei einer oder mehreren Vernehmungen mit Tötungsvorsatz so schwer misshandelt hat, dass der Häftling anschliessend gestorben ist. Der Angeklagte Dylewski war daher von den Schuldvorwürfen unter Ziffer 5 des Eröffnungsbeschlusses mangels Beweises freizusprechen.
VI. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Broad
Der gegen den Angeklagten Broad durch den Eröffnungsbeschluss in Ziffer 3 weiterhin erhobene Vorwurf, er habe in den Jahren 1942 bis 1945 als SS-Rottenführer und Ermittlungsbeamter der Politischen Abteilung in einer unbestimmten Zahl von Fällen Häftlinge während des Verhörs durch Schläge getötet oder erschossen, ist in der Hauptverhandlung nicht bestätigt worden.
Der Angeklagte hat sich dahin eingelassen, er habe nur gelegentlich Vernehmungen durchzuführen gehabt und dabei niemals Gefangene misshandelt, gefoltert, getreten oder erschlagen.
Die Zeugin Wa. hat zwar glaubhaft ausgesagt, dass der Angeklagte Broad Häftlinge bei Vernehmungen auch sehr heftig geschlagen habe; sie weiss aber nicht, ob jemand infolge solcher Schläge gestorben ist.
Auch die Zeugin Leb., die 1942/1943 Schreiberin bei dem Angeklagten war, hat überzeugend darüber berichtet, wie er bei Vernehmungen, selbst aus geringfügigem Anlass, heftig zugeschlagen und Häftlinge, oft zusammen mit dem SS-Mann Hoyer, auf der Schaukel brutal misshandelt hat. Der Zeugin ist aber nicht erinnerlich, dass ein Häftling nach einer derartigen Misshandlung verstorben sei.
Der Zeuge Dr. Bej. hat glaubhaft folgenden Vorgang geschildert: Ein Häftlingspfleger des Zigeunerlagers namens Dzialek habe sich eines Tages von ihm mit der Bemerkung verabschiedet, er müsse zur Vernehmung zu Broad, er komme wohl nicht mehr zurück.
Nach einiger Zeit sei Dzialek auf einer Bahre in den chirurgischen Block des Krankenhauses gebracht worden, völlig zerschlagen, bewusstlos und nur noch röchelnd. Sein Zustand sei hoffnungslos gewesen, er sei bald darauf verstorben. Den Zigeuner, der Dzialek von der Blockführerstube des Zigeunerlagers zurückgebracht habe, habe er gefragt, wer bei der Vernehmung "drin" gewesen sei. Der Zigeuner habe ihm geantwortet: "Broad".
Es besteht der dringende Verdacht, dass der Angeklagte Broad, der einen Fall Dzialek nicht kennen will, diesen Häftling totgeschlagen hat, zumal er in dieser Zeit der in dieser Blockführerstube tätige zuständige Angehörige der Politischen Abteilung gewesen ist. Gleichwohl bleiben Zweifel an der Täterschaft des Angeklagten. Denn es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Zigeuner, dessen Person unbekannt ist, der bei der Vernehmung von Dzialek nicht anwesend war und auch Dr. Bej. keine konkreten Einzelheiten irgendwelcher Wahrnehmungen mitgeteilt hat, nur angenommen hat, Broad sei als einziger SS-Mann in dem Vernehmungszimmer gewesen, während ausnahmsweise ein anderer Angehöriger der Politischen Abteilung im Falle Dzialek tätig geworden ist. Der Schluss, der Angeklagte Broad müsse der Täter sein, ist bei den dem Gericht vorliegenden Beweisanzeichen nicht zwingend.
Auch die Aussagen anderer, zu diesem Vorwurf des Eröffnungsbeschlusses vernommener Zeugen reichen zu einer Überführung nicht aus.
Der Zeuge Neu. schildert zwar, er sei von den SS-Leuten Broad und Lachmann nach seiner missglückten Flucht bei zahlreichen Vernehmungen brutal zusammengeschlagen und misshandelt worden. Er habe dann aber Broad gesagt, dass er infolge der Schläge auf die Nieren Blut im Urin habe; daraufhin sei das Schlagen unterblieben.
Die Zeuginnen Kag. und Cou. haben während ihres Aufenthaltes im Konzentrationslager Auschwitz lediglich gehört, dass auch Broad bei Vernehmungen geschlagen habe.
Der Angeklagte war somit im Punkte 3 des gegen ihn ergangenen Eröffnungsbeschlusses mangels Beweises freizusprechen.
VII. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Schlage
Dem Angeklagten Schlage wird in der Nachtragsanklage, die mit Zustimmung des Angeklagten in das Verfahren einbezogen worden ist, zur Last gelegt, in den Jahren 1942/1943 im KL Auschwitz durch mehrere selbständige Handlungen aus Mordlust und sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch und grausam Menschen getötet zu haben. Er soll in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen als Arrestaufseher im Block 11 des Stammlagers Häftlinge in dem sog. Stehbunker haben verhungern lassen. Der Angeklagte Schlage soll insbesondere im Januar/Februar 1943 bei einem aus Düsseldorf stammenden Musiker oder Artisten, der im Stehbunker inhaftiert gewesen sei und während des Urlaubs des Angeklagten Schlage heimlich durch den Bunkerkalfaktor und andere Häftlinge immer etwas zu essen erhalten habe, nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub bewusst verhindert haben, dass der Artist Nahrungsmittel erhielt, so dass der Häftling in der Folgezeit verhungert sei.
Ferner soll der Angeklagte Schlage im Mai 1943 den Häftling Heinz Romann, der im Stehbunker inhaftiert gewesen sei, haben verhungern lassen, indem er verhindert habe, dass Romann etwas zu essen erhielt, so dass Roman verstorben sei.
Zu dem Schuldvorwurf, der Angeklagte Schlage habe einen deutschen Artisten verhungern lassen, hat der Zeuge Se. bei zwei Vernehmungen in der Hauptverhandlung Bekundungen gemacht. Bei seiner ersten Vernehmung in der Hauptverhandlung am 20.3.1964 hat der Zeuge Se. hierzu folgendes ausgesagt: Während er - Se. - im Bunker in Block 11 eingesperrt gewesen sei, habe sich in einer Stehzelle im Keller des Blockes 11 ein deutscher Artist befunden. Dieser Artist habe nichts zu essen und zu trinken bekommen, bis er gestorben sei. Er - Se. - habe nicht gesehen, wie der Artist in die Stehzelle eingeliefert worden sei. Man habe sich aber, als der Häftling eine Zeitlang in der Stehzelle gewesen sei, gewundert, dass er immer noch am Leben sei. Der Artist habe offenbar heimlich von anderen Häftlingen Nahrungsmittel zugesteckt bekommen. Der Angeklagte Schlage sei damals eine Zeitlang im Urlaub gewesen. Als Schlage aus dem Urlaub zurückgekommen sei, hätten ihm - dem Zeugen - die Kalfaktoren erzählt, dass sie dem Artisten nichts mehr zu essen geben dürften. Schlage passe auf, dass der Artist nichts mehr erhalte. Er - der Zeuge - habe dann aus seiner Zelle gehört, wie der Artist immer schwächer geworden sei. Schliesslich sei der Artist gestorben. Er - der Zeuge - habe gehört, wie man die Leiche aus dem Loch, durch das man in die Stehzelle habe hineinkriechen müssen, herausgeschleift habe. Als er - Se. - aus dem Bunker entlassen worden sei, habe Schlage ihn "ausschreiben" müssen.
Bei seiner zweiten Vernehmung in der Hauptverhandlung am 6.8.1964 hat der Zeuge die Sache etwas anders und zwar wie folgt dargestellt: Während er im Bunker in Block 11 gewesen sei, habe ein deutscher Artist, der in einer Stehzelle eingesperrt gewesen sei, ihm - Se. - erzählt, "das Schlage ihn zum Verhungern verurteilt habe". Schlage hätte zu ihm - dem Artisten - gesagt: "Jetzt wirst Du vor Hunger verrecken!" Der Artist habe den Namen "Schlage" genannt. Als der Artist ihm - Se. - das erzählt habe, sei Schlage im Urlaub gewesen. Während des Urlaubs des Angeklagten Schlage hätten die Kalfaktoren dem Artisten zu essen und zu trinken gegeben. Als Schlage aus dem Urlaub zurückgekommen sei, habe er sich gewundert, dass der Artist noch am Leben sei. Seine Verwunderung habe er den Kalfaktoren gegenüber geäussert. Er habe sie beschuldigt, dass sie in seiner - Schlages - Abwesenheit dem deutschen Artisten zu essen und zu trinken gegeben hätten. Dieses Gespräch zwischen Schlage und den Kalfaktoren habe er - Se. - in seiner Zelle durch die Zellentür hindurch mit angehört. Während des Gespräches habe er den Angeklagten Schlage nicht gesehen. Es sei morgens gegen 11.00 Uhr gewesen. Gegen 12.00 Uhr habe er - Se. - Mittagessen bekommen. Beim Austeilen des Mittagessens sei Schlage dabeigewesen. Er habe die Zellentüren aufgeschlossen. Daher müsse er an diesem Vormittag Dienst gehabt und auch die Äusserung gegenüber den Kalfaktoren, die er - Se. - durch die Zellentür mit angehört habe, gemacht haben.
Schlage habe dann in der Folgezeit aufgepasst, dass der Artist kein Essen mehr erhalten habe. Er - Se. - habe sich noch deswegen mit anderen Häftlingen und auch mit dem Artisten unterhalten. Der Artist sei dann von Tag zu Tag schwächer geworden. Schliesslich habe er nur noch vor Hunger gebrüllt wie ein Tier. An einem Tag im Februar 1943 sei er schliesslich gestorben. Ja. habe ihn aus seiner Zelle herausgezerrt. Dies sei 8-10 Tage vor seiner - des Zeugen Se. - Entlassung aus dem Bunker gewesen.
Auf die Frage, welche sonstigen Zeugen das noch bestätigen könnten, hat der Zeuge Se. erklärt, der Zeuge Krx. habe diese Vorgänge miterlebt, er müsse sie daher bestätigen können. Den Namen des Artisten wusste der Zeuge Se. nicht mehr. Auf die Frage, ob es sich bei dem Artisten um Bruno Graf gehandelt habe, der auch nach der Aussage anderer Zeugen verhungert sein soll und dessen Tod am 5.2.1943 im Bunkerbuch vermerkt ist, glaubte der Zeuge sich an diesen Namen wieder erinnern zu können.
Nach den einschlägigen Eintragungen im Bunkerbuch, die in der Hauptverhandlung durch Verlesen zum Gegenstand der Verhandlung gemacht worden sind, war der Zeuge Se. vom 21.1.1943 bis 13.2.1943 in dem Arrestbunker inhaftiert. Ein Häftling Bruno Graf befand sich vom 7.1.1943 bis zum 5.2.1943 im Arrestbunker (Bunkerbuch Band I Seite 105). Seine Einlieferung ist nach der Eintragung im Bunkerbuch auf Anordnung der Lagerführung erfolgt. Neben das Datum vom 5.2.1943 hat der Blockschreiber ein Kreuz gemacht. Das bedeutet an sich, dass der Häftling erschossen worden ist. Es könnte allerdings auch bedeuten, dass er (Hungers) gestorben ist. Denn reichsdeutsche Häftlinge wurden, soweit das in der Beweisaufnahme feststellbar war, nicht an der Schwarzen Wand erschossen. Wahrscheinlich befürchtete man Komplikationen. Es erscheint daher glaubhaft, dass der Zeuge Se. tatsächlich den Hungertod des Bruno Graf miterlebt hat. Seine Angabe, der Artist sei etwa 8-10 Tage vor seiner - des Zeugen - Entlassung verstorben, stimmt mit den Eintragungen im Bunkerbuch überein. Denn vom 5.2.1943 bis 13.2.1943 (dem Tag der Entlassung des Zeugen Se.) sind genau acht Tage vergangen.
Es bestehen jedoch Bedenken, ob der Zeuge Se. den Hungertod des Artisten (Bruno Graf) zutreffend mit dem Angeklagten Schlage in Verbindung bringt. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass der Zeuge - nach 20 Jahren - guten Glaubens den Angeklagten Schlage mit einem anderen SS-Angehörigen, der für den Tod des Artisten verantwortlich ist, verwechselt. Diese Bedenken des Gerichts beruhen auf folgendem:
Der Zeuge Krx., der - wie bereits mehrfach erwähnt - vom 18.12.1942 bis 15.2.1943 im Arrestbunker inhaftiert war und auf den sich der Zeuge Se. als Zeugen für den Hungertod des deutschen Artisten berufen hat, hat bei seiner Vernehmung in der Hauptverhandlung erklärt, Bruno Graf sei von dem SS-Oberscharführer Gehring in die Stehzelle gebracht worden. Gehring habe darauf geachtet, dass Graf nichts zu essen erhalte. An den Namen Schlage konnte sich der Zeuge Krx. nicht mehr erinnern. Er hat zwar gemeint, er habe so einen Namen wie Schlage gehört, mit Bruno Graf hat er ihn jedoch nicht in Verbindung gebracht. Wenn auch der Zeuge Krx. in anderer Hinsicht nicht zuverlässig erschien, ist es doch denkbar, dass Gehring als Arrestverwalter der Bruno Graf in den Arrestbunker eingeliefert und an ihn die Worte gerichtet hat: "Du bleibst jetzt hier, bis Du vor Hunger verreckst." Es erscheint dann naheliegend, dass Gehring als Arrestverwalter darüber gewacht hat, dass Bruno Graf nichts mehr zu essen bekam.
Weitere Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Erinnerungsvermögens des Zeugen Se. an den für den Hungertod des deutschen Artisten verantwortlichen SS-Angehörigen ergeben sich aus folgendem: Der Zeuge hat sich ursprünglich, als Ermittlungen wegen der Vorgänge im KL Auschwitz durchgeführt wurden, brieflich an den Zeugen La. gewandt und ihm seine Erlebnisse im KL Auschwitz geschildert. In diesem Brief hat er die Namen einer Reihe von ehemaligen SS-Angehörigen, die im KL Auschwitz tätig gewesen sind, genannt. Den Namen des Angeklagten Schlage hat er jedoch in dem Brief nicht erwähnt. Bei seiner Vernehmung durch den Untersuchungsrichter am 8.10.1962 hat der Zeuge Se. ebenfalls eine Reihe
von Namen ehemaliger SS-Angehöriger aus dem KL Auschwitz genannt, so die Namen Boger, Wosnitza, Lachmann, Grabner, Aumeier, Palitzsch, Kaduk, Glombik, Hofmann, Fries, Klehr, B. und Bednarek. Den Namen des Angeklagten Schlage hat er jedoch nicht angeführt. Als ihm Lichtbilder früherer SS-Angehöriger im KL Auschwitz, unter denen sich auch die Fotografie des Angeklagten Schlage befand, durch den Untersuchungsrichter vorgelegt wurden, hat der Zeuge den Angeklagten Schlage nicht erkannt. Ferner hat er sich, als ihm durch den Untersuchungsrichter eine Liste mit Namen vorgelegt wurde, auf der auch der Name des Angeklagten Schlage verzeichnet war, nicht an den Namen Schlage erinnern können. Bei seiner Vernehmung in der Hauptverhandlung hat der Zeuge auf Befragen zunächst abgestritten, dass ihm durch den Untersuchungsrichter solche Bilder und eine Liste vorgelegt worden seien. Erst auf besonderen Vorhalt aus den Akten musste er einräumen, dass ihm tatsächlich Bilder gezeigt worden sind. Das zeigt, dass seine Erinnerung an die damalige Vernehmung nicht mehr ganz zuverlässig ist. Auf die Frage des Verteidigers, warum der Zeuge bei seinen früheren Vernehmungen des Angeklagten Schlage nicht genannt habe, antwortete der Zeuge, dass er den Namen Schlage in der Zeitung gelesen habe. Durch diese Zeitungsnotiz sei ihm der Name Schlage wieder in Erinnerung gekommen. Damit ist jedoch nicht geklärt, warum der Zeuge, als ihm die Liste mit den Namen der ehemaligen SS-Angehörigen, auf der auch der Name Schlage stand, keine Vorstellung mit dem Namen Schlage hat verbinden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Zeuge infolge des Zeitungsberichtes nachträglich irrtümlich annimmt, dass Schlage für den Hungertod des deutschen Artisten (Bruno Graf) verantwortlich sein müsse, weil er eine Zeitlang Arrestaufseher im Block 11 gewesen ist (was der Zeuge wahrscheinlich aus der Zeitung erfahren hat). Die Gefahr einer Verwechslung ist vor allem auch deswegen nicht auszuschliessen, weil im Arrestblock eine Zeitlang ein SS-Angehöriger mit dem ähnlich klingenden Namen "Plagge" tätig war.
Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Erinnerungsvermögens des Zeugen Se. an die damaligen Vorgänge im Block 11 bestehen ferner deswegen, weil der Zeuge bei seinen beiden Vernehmungen in der Hauptverhandlung abweichende Darstellungen gegeben hat. Bei der ersten Vernehmung hat der Zeuge nichts davon erwähnt, dass der deutsche Artist mit ihm vor seinem Tode persönlich gesprochen habe und dass ihm Bruno Graf persönlich erklärt habe, Schlage habe ihn zum Hungertod verurteilt mit der Erklärung: "Du bleibst jetzt hier, bis Du vor Hunger verreckst."
Bei seiner ersten Vernehmung in der Hauptverhandlung hat der Zeuge Se. ferner ausgesagt, dass er nur von Funktionshäftlingen gehört habe, dass sie dem deutschen Artisten nichts mehr zu essen geben dürften und dass Schlage aufpasse, dass der Artist keine Verpflegung mehr erhalte. Nach seiner zweiten Vernehmung will der Zeuge das Gespräch zwischen Schlage und den Kalfaktoren selbst durch die Zellentür mit angehört haben. Diese Unstimmigkeiten in beiden Aussagen des Zeugen Se. zeigen ebenfalls, dass er keine sichere Erinnerung mehr an die damaligen Vorgänge hat.
Schliesslich konnte auch nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass der Angeklagte Schlage am 5.2.1943 noch als Arrestaufseher im Block 11 tätig gewesen ist. Die Zeugin Berge. hat glaubhaft bekundet, dass sie den Angeklagten Schlage im Januar oder Februar 1943 in Golleschau kennengelernt hat. Ihr Vater sei damals Betriebsleiter einer Zementfabrik in Golleschau gewesen. Er habe eines Tages den Angeklagten Schlage in ihre Wohnung eingeführt. Die Zeugin wusste allerdings nicht mehr genau, wann dies gewesen war. Sie gab an, dass sie sich aber noch erinnern könne, es sei etwa 10-14 Tage nach ihrer Verlobung gewesen, als ihr Vater den Angeklagten Schlage in ihre Wohnung eingeladen habe. Ihre Verlobung sei am 24.1.1943 gewesen. Die Einführung des Angeklagten Schlage in die Wohnung Berge. müsste demnach zwischen dem 3. und 7.2.1943 gewesen sein. Zieht man in Betracht, dass der Vater Berge. den Angeklagten Schlage, der - wie er unwiderlegt angibt - in der damaligen Zeit Kommandoführer eines Häftlingskommandos in Golleschau gewesen ist, wahrscheinlich nicht schon am ersten Tag nach seinem Eintreffen in Golleschau zu sich in die Wohnung eingeladen hat, so erscheint es fraglich, ob Schlage in der ersten Februarwoche 1943 überhaupt noch als Arrestaufseher im Arrestblock Nr.11 gewesen ist.
Unwahrscheinlich erscheint es jedenfalls, dass der Angeklagte Schlage noch am 13.2.1943, dem Tag der Entlassung des Zeugen Se. aus dem Arrestbunker, noch im Block 11 eingesetzt war. Der Zeuge Se. hat jedoch behauptet, dass ihn der Angeklagte Schlage bei seiner Entlassung habe "ausschreiben" müssen. Auch insoweit dürfte sich der Zeuge irren. Denn nach der Aussage der Zeugin Berge. müsste Schlage zu dieser Zeit auf jeden Fall schon in Golleschau gewesen sein. Im übrigen erscheint es auch unwahrscheinlich, dass der Angeklagte Schlage die schriftlichen Eintragungen gemacht hat. Das war Sache des Blockschreibers, zu der damaligen Zeit der Zeuge Pi.
Aus all diesen Gründen erscheint es nicht sicher, dass der Zeuge Se. irrtumsfrei den Angeklagten Schlage mit dem Hungertod des deutschen Artisten (Bruno Graf) in Verbindung bringt. Das Schwurgericht konnte daher trotz erheblichen Verdachtes nicht mit jeden Zweifel ausschliessender Sicherheit feststellen, dass der Angeklagte Schlage einen kausalen Tatbeitrag zu dem Hungertod des deutschen Artisten geleistet hat.
Dem Angeklagten Schlage konnte auch nicht nachgewiesen werden, dass er für den Hungertod eines anderen Häftlings namens Heinz Romann verantwortlich war.
Der Zeuge Brei. hat zwar glaubhaft geschildert, dass man in der Zeit zwischen dem 11.4.1943 und dem 25.6.1943 einen deutschen Häftling namens Heinz Romann in einer der Stehzellen im Arrestbunker habe verhungern lassen. Der Zeuge, der selbst im Arrestbunker inhaftiert war, hat diesen Hungertod selbst miterlebt und ihn eingehend geschildert. Nach der dem Häftling Heinz Romann betreffenden Eintragungen im Bunkerbuch ist dieser Häftling am 18.12.1942 in den Bunker eingeliefert worden und am 31.5.1943 verstorben. Der Zeuge Brei. konnte jedoch nicht angeben, ob damals der Angeklagte Schlage Arrestaufseher im Block 11 gewesen ist. Er hat erklärt, dass er keine Anhaltspunkte dafür habe, dass der Angeklagte Schlage den Häftling Romann habe verhungern lassen.
Von dem Zeugen Krx. sind noch weitere Fälle, in denen man Häftlinge im Arrestbunker, und zwar in den Stehzellen, hat verhungern lassen, geschildert worden. Der Zeuge Krx. hat jedoch in keinem Fall behauptet, dass der Angeklagte Schlage mit dem Hungertod dieser Häftlinge etwas zu tun gehabt habe. Andere Zeugen haben den Angeklagten Schlage insoweit nicht belastet.
Der Angeklagte Schlage war daher von den Schuldvorwürfen in der Nachtragsanklage mangels Beweises freizusprechen.
VIII. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Hofmann
Der Angeklagte Hofmann soll sich noch in einer Vielzahl von Fällen im Stammlager Auschwitz und als Lagerführer des Zigeunerlagers in Birkenau des Mordes schuldig gemacht haben. Diese Taten konnten ihm jedoch nicht sicher nachgewiesen werden.
1.
In Ziffer 3 des ihn betreffenden Teiles des Eröffnungsbeschlusses wird ihm zur Last gelegt, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen als Lagerführer des Zigeunerlagers in Birkenau Häftlinge so schwer misshandelt zu haben, dass sie starben. Er soll weiterhin im Herbst 1943 die Stubendienste und Blockältesten dieses Zigeunerlagers durch "Sportmachen" derart gequält und misshandelt haben, dass 6 oder 7 Häftlinge starben (Ziffer 4 des Eröffnungsbeschlusses). Hofmann bestreitet; ab und zu habe er zwar solches Sportmachen strafweise angeordnet, es sei aber hierdurch oder auf andere Weise kein Häftling des Zigeunerlagers zu Schaden gekommen.
Der Zeuge Fri. war im Jahre 1943 in diesem Lager und hat bekundet, dass zwei Verwandte seiner Frau, die Brüder Adolf Oskar und Max Schopper, nach einem derartigen Sportmachen gestorben seien. Er selbst habe hiervon nichts gesehen und später von anderen nur gehört, Hofmann hätte den Auftrag für das Sportmachen gegeben. Diese Aussage enthält keine konkreten, eine Schuldfeststellung ermöglichenden Tatsachen. Dasselbe gilt für die Bekundungen der Zeugen Schrö. und Morg. Schrö. war gleichfalls im Jahre 1943 Gefangener in diesem Zigeunerlager und nimmt lediglich "mit Bestimmtheit an", Hofmann sei für dieses Sportmachen verantwortlich gewesen, ohne sagen zu können, worauf er diese seine Annahme gründet. Der Zeuge Morg. hat als Häftling des Zigeunerlagers im Frühsommer 1943 an "Sport" der Stubendienste und Blockschreiber teilnehmen müssen, den die Rapportführer Plagge und Palitzsch geleitet haben. Bei einem zweiten Sportmachen kurze Zeit später brauchte er nicht mitzumachen. Ob der Angeklagte Hofmann diesen zweiten Sport angeordnet oder geleitet hat, glaubt der Zeuge zwar, weiss es nach seiner Aussage jedoch nicht. Es habe sich, wie er bekundete, so herumgesprochen, dass viele (7 bis 8 Häftlinge) nach Sportmachen "kaputt gegangen" seien.
Die Zeugin Hilli Wei. hat bei ihrer Vernehmung vom 15.März 1965, die am 5.4.1965 verlesen worden ist, angegeben, sie habe von der damaligen Lagerschreibstube aus gesehen, wie unter der Leitung des Angeklagten Hofmann Blockschreiber und Stubendienste unter Schlägen der Blockältesten hätten Sport machen müssen; bald danach habe sie die Totenmeldungen von 4 bis 5 Teilnehmern dieses Sportes gesehen. Hiermit ist noch nicht dargetan, dass das Verhalten des Angeklagten ursächlich für den Tod dieser 4 bis 5 Menschen war.
Daneben bestehen aber auch Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der Aussagen dieser Zeugin. Sie hat nämlich bei ihrer früheren Vernehmung vom 15.7.1960 vor der Kriminalpolizei ausgesagt, sie hätte in Birkenau keinerlei Verbrechen, wie Mord oder Totschlag, selbst beobachtet; über Hofmann, der nur kurze Zeit Lagerführer gewesen sei, könne sie keine Angaben machen. Nach Vorhalt dieser Aussage hat sie erklärt, der Angeklagte Hofmann sei ihr im Lager dem Namen nach unbekannt gewesen; sie habe ihn bei ihrer Vernehmung vom 15.7.1960 nur nach dem ihr vorgelegten Bilde erkannt. Diese Erklärung ist nicht glaubhaft. Denn die Zeugin hat vom 18.3.1943 an täglich auf der Schreibstube des Lagers gearbeitet, dessen zuständiger und gefürchteter Führer der Angeklagte Hofmann bis September 1943 war. Sie hat Hofmann nach der Überzeugung des Gerichts seit dem Tage ihres ersten Dienstes in der Lagerschreibstube mit Namen gekannt. Diese Widersprüche machen die Aussagen dieser Zeugin unverwertbar.
Die Zeugin Gut. kennt den Angeklagten Hofmann von der Zeit ihrer Inhaftierung im Zigeunerlager in Birkenau. Sie hat in ihrer Vernehmung vom 2.Februar 1965, die am 11.2.1965 verlesen worden ist, geschildert, dass sie den Angeklagten einige Male als Aufsichtsführenden erlebt habe, wenn Plagge und Palitzsch mit Gefangenen so brutal "Sport" machten, dass viele von ihnen blutüberströmt liegen geblieben seien. In einer am 3.12.1963 in dem Verfahren gegen Albrecht u.a. (4 Js 1031/61 der StA Ffm.) durchgeführten richterlichen Vernehmung sagte sie dazu, viele Gefangene seien dabei infolge Erschöpfung liegen geblieben. Die Zeugin weist im übrigen darauf hin, dass sie infolge der Leiden der Lagerzeit erkrankt sei und Erinnerungsschwierigkeiten habe. Bestehen hiernach bereits Zweifel, ob man der einen oder der anderen ihrer Schilderungen folgen soll, so reicht die weitere Bekundung der Zeugin, sie habe vom Hörensagen erfahren, dass manche dieser geschundenen Häftlingen im Häftlingskrankenbau verstorben seien, jedenfalls nicht aus, den Angeklagten der ihm zur Last gelegten weiteren Mordtaten sicher zu überführen.
2.
Zu dem Vorwurf, der Angeklagte Hofmann habe im Sommer 1943 einen jüdischen Häftling erschossen, weil dieser sich wehrte, in die Gaskammer gebracht zu werden (Ziffer 5 des Eröffnungsbeschlusses), hat lediglich der Zeuge Holt. Aussagen gemacht.
Er gibt folgende Schilderung: An einem Tag im Jahre 1944 hätten mehrere SS-Leute Häftlinge hinter der Häftlingsküche entlanggeführt. Der von Hofmann geführte Häftling sei immer störrischer geworden, Hofmann habe daraufhin mit der Pistole auf ihn geschossen, so dass er zusammengesackt sei. Der Häftling sei nach seiner festen Überzeugung gleich tot gewesen, man habe ihn dann weggetragen.
Es ist bereits fraglich, ob der von dem Zeugen geschilderte dem von dem Eröffnungsbeschluss umfassten Vorgang entspricht. Darüber hinaus aber besteht auch die Möglichkeit, dass der Zeuge den Angeklagten Hofmann, der diese Tat bestreitet, mit einem anderen SS-Führer verwechselt. Denn er hat trotz Vorhalts immer wieder behauptet, Hofmann habe um Weihnachten 1944 im Konzentrationslager Auschwitz an einer Erhängung von 3-4 Häftlingen teilgenommen, einem der Delinquenten den Schemel weggestossen und nach der Exekution eine Rede gehalten; es ist aber erwiesen, dass Hofmann bereits im Mai 1944 vom Konzentrationslager Auschwitz nach dem Konzentrationslager Natzweiler versetzt worden ist. Dieser Zeuge ist unzuverlässig und daher ein ungeeignetes Beweismittel.
3.
Seine Bekundungen sind deshalb auch nicht zu einer Überführung des Angeklagten im Punkte 7 des Eröffnungsbeschlusses zu werten. Hiernach soll der Angeklagte Hofmann, was er in Abrede stellt, im Winter 1942 oder 1943 etwa 10 oder 12 entkräftete sowjetische Kriegsgefangene gezwungen haben, sich nackt im Freien aufzustellen, so dass sie infolge der grossen Kälte erfroren. Der Zeuge hat ausserdem zu diesem Punkte widersprüchliche Angaben gemacht. Während er in seiner Vernehmung vom 18.Mai 1960 ausgesagt hatte, es hätten 10 oder 12 Kriegsgefangene völlig nackt bei frierender Kälte vor ihrem Block gestanden, bis sie tot umgefallen seien, hat er in der Hauptverhandlung trotz Vorhaltes dieser seiner früheren Aussage behauptet, es habe nur ein Kriegsgefangener ausgezogen vor Hofmann gestanden, er nehme an, der Gefangene sei daran gestorben.
Der Zeuge Fat., der einzige weitere Zeuge zu diesem Sachverhalt, kann keine konkreten Angaben machen, die eine Schuldfeststellung ermöglichten. Seine Darstellung ist folgende: Im strengen Winter 1942 seien 4-6 russische Kriegsgefangene umgefallen; die anderen Kriegsgefangenen hätten ihnen, obwohl sie noch lebten, die Kleider ausgezogen. Hofmann hätte mit dem Fuss gegen die Liegenden gestossen und dazu gesagt: "Lasst sie verrecken!" Von Kameraden habe er später gehört, der russische Blockälteste habe die Halbtoten im Keller des Blockes mit einer Stange ins Genick geschlagen, bis sie tot gewesen seien.
4.
Nach Ziffer 8 des Eröffnungsbeschlusses sollen im Jahre 1943 sämtliche im Keller des Blockes 18 im Stammlager untergebrachten Kinder zwischen 6 und 12 Jahren auf Veranlassung des Angeklagten ausgesondert und in Birkenau durch Gas umgebracht worden sein. Der Angeklagte behauptet, die Kinder seien ordnungsgemäss nach Birkenau verlegt, aber nicht getötet worden. Ausser dem Gastwirt Gr. konnte kein Zeuge Bekundungen hierzu machen. Nach seiner Schilderung hat er eines Tages ein Gespräch zwischen Hofmann und dem ersten Schutzhaftlagerführer Schwarz mit angehört. Hofmann habe gesagt, diese Kinder müssten aus dem Lager und "überstellt" (vergast) werden. Früher hat der Zeuge erklärt, er habe nicht hören können was Hofmann über das Schicksal der Kinder bestimmt habe; er habe aber selbst die für diese Kinder aufgestellten Transportlisten bearbeitet und wisse, da sie mit dem Vermerk "B II f" versehen gewesen seien, dass diese 40-50 Kinder vergast worden seien; Hofmann sei hierfür allein verantwortlich. Nach Vorhalt dieser Aussagen erklärte der Zeuge dann, von den Kindern seien nicht viele übrig geblieben, ein Teil sei nach Reisko, ein Teil nach Birkenau gekommen. Hofmann habe ihm die Transportlisten gegeben, damit er sie auf die Schreibstube bringe; sie seien vom 1. Schutzhaftlagerführer Schwarz und dem Angeklagten Hofmann, der damals 3. Schutzhaftlagerführer war, unterzeichnet gewesen.
Diese nicht aufgeklärten Widersprüche begründen erhebliche Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Zeugen. Die Bedenken werden verstärkt durch den Umstand, dass der Zeuge anfänglich in der Hauptverhandlung zu seinem Lebensweg bewusst unrichtige Angaben gemacht hat. Er hat nämlich bekundet, er habe - um sich zu tarnen - Fragebogen gefälscht und sei deshalb wegen Urkundenfälschung im Mai oder Juni 1939 in Abwesenheit zu einem oder zwei Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Erst auf Vorhalt räumte er ein, damals auch wegen Betrugs bestraft worden zu sein. Seine Vorstrafen stünden aber in Zusammenhang mit seiner Flucht vor den Verfolgungen im Dritten Reich, sein Vater sei Israelit gewesen. Erst nach Verlesen des über ihn eingeholten Strafregisterauszuges gab er zu, bereits vor 1933 wegen Rückfallbetrugs bestraft worden zu sein.
Die Aussage des Zeugen Gr. konnte daher nicht als Grundlage für sichere Feststellungen dienen.
5.
Im Januar 1944 soll der Angeklagte nach Ziffer 9 des Eröffnungsbeschlusses in der alten Wäscherei zwischen Block 1 und 2 gemeinsam mit dem Angeklagten Kaduk und dem damaligen Rapportführer Clausen etwa 600 Häftlinge, darunter auch einige Kinder, ausgesondert und veranlasst haben, dass sie durch Gas getötet wurden.
Der Zeuge Wö. konnte dazu lediglich bekunden, er habe von anderen Häftlingen gehört, der Angeklagte habe an einer Selektion im Januar 1944 in der alten Wäscherei teilgenommen. Vom Standortarzt habe er erfahren, dass diese Selektion von Berlin befohlen gewesen sei, daraus habe er geschlossen, dass es eine Selektion zur Vergasung gewesen sei.
Die Schlussfolgerung des Zeugen Wö. mag zutreffend sein; die Mitteilung der "anderen Häftlinge" ist aber kein sicherer Beweis dafür, dass Hofmann wirklich mit selektiert hat. Wö. konnte die Mitteilung nicht überprüfen, der Ursprung des Wissens dieser anderen Häftlinge ist ungewiss.
Der Zeuge Stein. hat zwar bekundet, dass der Angeklagte einer Kommission angehört habe, die zwischen Frühling und Herbst 1943 allgemeine Selektionen im Lager durchgeführt habe - diese Vorgänge sind nicht Gegenstand des Eröffnungsbeschlusses -, er hat aber weiterhin ausgesagt, die Selektion in der alten Wäscherei im Winter 1943/1944 sei durch Kaduk und Clausen vorgenommen worden, den Namen des Angeklagten Hofmann nannte er in diesem Zusammenhange nicht. Dieser Umstand ist ein Indiz dafür, dass Hofmann an dieser ihm vorgeworfenen Tat möglicherweise, wie er behauptet, nicht beteiligt war.
In den Punkten 3, 4, 5, 7, 8 und 9 des Eröffnungsbeschlusses musste der Angeklagte Hofmann somit mangels Beweises freigesprochen werden.
IX. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Kaduk
1.
Dem Angeklagten Kaduk wird unter Ziffer 4 des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegt, im Sommer 1943 einen jüdischen Häftling aus Holland, bei dem er Lebensmittel gefunden haben soll, so schwer misshandelt zu haben, dass der Häftling bewusstlos in den HKB habe eingeliefert werden müssen, wo er kurze Zeit später in Block 21 an den Folgen dieser Misshandlung gestorben sein soll.
Der Angeklagte Kaduk konnte dieser Tat, die er leugnet, nicht mit jedem Zweifel ausschliessender Sicherheit überführt werden.
Der Zeuge Rei. hat in der Hauptverhandlung zunächst bekundet, dass der Angeklagte Kaduk im Sommer 1943 einmal bei einer "Visitation" am Lagertor einen holländischen Häftling so geschlagen habe, dass der Häftling zu ihnen in den HKB hätte eingeliefert werden müssen. Der Häftling sei an den Folgen der Misshandlung gestorben. Er - der Zeuge - sei damals im HKB gewesen und hätte die Einlieferung des Häftlings gesehen. Auf die Frage, woher der Zeuge wisse, dass Kaduk den holländischen Häftling zuvor geschlagen habe, musste der Zeuge einräumen, dass er das nur vom Hörensagen wisse. Erläuternd hat er hinzugefügt, dass die Funktionshäftlinge - der Zeuge war als Schreiber im HKB eingesetzt, zählte also auch zu den Funktionshäftlingen - alle Dinge, die im Lager vorgefallen seien, erfahren hätten. Er selbst habe jedoch - so hat der Zeuge erklärt - die Misshandlung nicht selbst mitangesehen. Der Zeuge konnte nicht mehr angeben, wer ihm damals berichtet hat, dass der Angeklagte Kaduk diesen holländischen Häftling geschlagen habe. Wenn dem Angeklagten Kaduk nach seinem sonstigen Verhalten im KL Auschwitz auch ohne weiteres zuzutrauen ist, dass er den holländischen Häftling misshandelt hat, konnte das Gericht jedoch nicht nachprüfen, ob dem Zeugen Rei. damals zutreffend berichtet worden ist. Es gab im KL Auschwitz noch andere SS-Männer und SS-Unterführer, die die Häftlinge geschlagen und misshandelt haben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die nicht bekannten Gewährsleute des Zeugen Rei. sich in der Person des Täters geirrt haben oder dass sie die Misshandlungen selbst nicht mit angesehen sondern davon ebenfalls nur von anderen gehört haben, wobei nicht feststellbar ist, ob die Berichte der anderen Häftlinge auf eigenen Beobachtungen oder nur auf Vermutungen beruhten.
Die Erinnerung des Zeugen Rei. erschien im übrigen nicht mehr ganz zuverlässig. Seine Aussage in der Hauptverhandlung stand in Widerspruch zu der Aussage, die er bei seiner früheren Vernehmung durch den Untersuchungsrichter am 15.1.1962 gemacht hat. Damals hat er behauptet, er habe auf einem dienstlichen Gang mit eigenen Augen gesehen, wie der Angeklagte Kaduk ein Häftlingskommando am Lagertor "gefilzt" und dabei den holländischen Häftling zusammengeschlagen habe. Diese Aussage hat er in der Hauptverhandlung zunächst nicht mehr aufrecht erhalten. Wie schon ausgeführt, will er nach seiner Bekundung in der Hauptverhandlung nur die Einlieferung des misshandelten Häftlings in den HKB gesehen haben. Letzteres erscheint glaubhafter. Denn der Zeuge hat damals als Schreiber im Block 21 gearbeitet. An dem Lagertor hatte er an sich nichts zu tun. Als dem Zeugen dann in der Hauptverhandlung seine frühere Aussage vorgehalten wurde, erklärte er plötzlich, er habe doch das "Filzen" der Häftlinge durch den Angeklagten Kaduk am Lagertor gesehen. Eine überzeugende Erklärung für seine widersprüchlichen Angaben konnte der Zeuge nicht geben. Es muss daher mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass der Zeuge bei seiner früheren Vernehmung eigene Beobachtungen mit den Berichten anderer Häftlinge und eigenen Schlussfolgerungen vermengt und - vielleicht guten Glaubens - wahrheitswidrig behauptet hat, er habe das "Filzen" durch Kaduk und die Misshandlung des holländischen Häftlings mit eigenen Augen gesehen. Wenn er in der Hauptverhandlung auf den Vorhalt aus der früheren Vernehmung hin schliesslich wieder - in Widerspruch zu seiner ursprünglichen Aussage in der Hauptverhandlung - zu der früheren Aussage zurückgekehrt ist, so konnte das nicht zu der sicheren Überzeugung führen, dass die damaligen Angaben richtig waren. Die Reaktion des Zeugen nach dem Vorhalt aus der früheren Vernehmung kann vielmehr die Reaktion eines bei einem Widerspruch ertappten Zeugen gewesen sein, der nicht zugeben wollte, dass er bei seiner Vernehmung im Ermittlungsverfahren als angeblicher Augenzeuge über Vorfälle berichtet hat, die er gar nicht selbst beobachtet hat. Jedenfalls muss nach der ursprünglichen Aussage des Zeugen in der Hauptverhandlung mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass der Zeuge tatsächlich nur die Einlieferung des misshandelten holländischen Häftlings in den HKB, jedoch nicht dessen Misshandlung gesehen hat, ohne dass mit Sicherheit festgestellt werden kann, wer den Häftling geschlagen und misshandelt hat.
Eine sichere Überführung des Angeklagten Kaduk war daher in diesem Fall nicht möglich. Er musste daher mangels Beweises freigesprochen werden.
2.
Dem Angeklagten Kaduk wird ferner unter Ziffer 12 des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegt, im Mai 1943 und im August 1944 an etwa 8-10 Erschiessungen von Häftlingen an der "Schwarzen Wand" mitgewirkt zu haben.
Auch in diesem Anklagepunkt konnte der Angeklagte Kaduk einer strafbaren Handlung nicht mit Sicherheit überführt werden.
Der Zeuge Law. hat bekundet, dass er den Angeklagten Kaduk mehrfach mit einem Gewehr auf den Block 11 habe gehen sehen. Kaduk habe in diesen Fällen Gummistiefel angehabt. Auch der Zeuge Bart. hat nach seiner Bekundung gesehen, wie der Angeklagte Kaduk mit einem Kleinkalibergewehr auf Block 11 gegangen ist. Das spricht zwar dafür, dass der Angeklagte Kaduk zu Erschiessungen in den Block 11 gegangen ist und dort an den Erschiessungen in irgend einer Weise teilgenommen hat, wobei es allerdings offen bleiben muss, ob er auch eigenhändig geschossen hat. Aus den Aussagen der Zeugen ergibt sich jedoch nicht, welche Personengruppen an der Schwarzen Wand getötet worden sind und welches der Grund für ihre Erschiessung war. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um Zivilisten gehandelt hat, die auf Grund von Stand- oder Sondergerichtsurteilen zur Erschiessung in das Lager Auschwitz eingeliefert worden waren. Da nähere Umstände nicht bekannt sind, kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass die Erschiessungen rechtswidrig waren. Das kann allenfalls vermutet werden. Für eine Verurteilung reichen solche Vermutungen jedoch nicht aus. Nicht zu klären ist auch, ob der Angeklagte Kaduk, der - was zu seinen Gunsten angenommen werden muss - auf Befehl zu diesen Erschiessungen hingegangen ist, klar erkannt hat, dass die befohlenen Exekutionen ein allgemeines Verbrechen darstellten, wenn man einmal unterstellt, dass sie rechtswidrig waren. Schliesslich fehlen auch jegliche Anhaltspunkte dafür, ob es sich bei den Exekutionen, zu denen der Angeklagte Kaduk nach den Beobachtungen der Zeugen Law. und Bart. hingegangen ist, um Erschiessungen im Mai 1943 oder im August 1944, die allein in Ziffer 12 des Eröffnungsbeschlusses dem Angeklagten Kaduk zur Last gelegt werden, gehandelt hat.
Auf Grund der Aussagen dieser beiden Zeugen konnte daher der Angeklagte Kaduk nicht des Mordes und der Beihilfe zum Mord im Sinne von Ziffer 12 des Eröffnungsbeschlusses oder des Totschlages oder der Beihilfe zum Totschlag überführt werden.
Der Zeuge Dr. Gl. will oft gesehen haben, wie der Angeklagte Kaduk Gruppen von Häftlingen zu Block 11 geführt und dort erschossen hat. Einmal hat Kaduk - so hat der Zeuge ausgesagt - eine Gruppe von Menschen vor sich her zu Block 11 getrieben. Nach einer halben Stunde seien die Leichenträger, zu denen er auch gehört habe, zu Block 11 bestellt worden. Dann seien die Menschen erschossen worden. Kaduk habe jeweils Gruppen von 8-10 Personen zu Block 11 geführt. Es seien zahlreiche Gruppen gewesen, die er zu Block 11 gebracht habe. Insgesamt seien es bestimmt mehr als 20 Gruppen gewesen. Jede Gruppe habe aus mindestens 8 Personen bestanden. Viele Gruppen seien auch erheblich stärker gewesen. Kaduk sei jeweils allein gewesen. Der Angeklagte Kaduk müsste demnach nach der Aussage des Zeugen Dr. Gl. mehr als 80 Personen eigenhändig erschossen haben.
Wie schon mehrfach ausgeführt, bestehen gegen die Zuverlässigkeit des Zeugen Dr. Gl. Bedenken (vgl. oben 3. Abschnitt E.III.3.; 3. Abschnitt P.III.2. und Q.III.2.; 5. Abschnitt I.2a.). Es ist daher nicht sicher, ob der Zeuge Dr. Gl. bezüglich des Angeklagten Kaduk zutreffende Bekundungen gemacht hat.
Aber auch wenn man unterstellt, dass die Angaben des Zeugen Dr. Gl. insoweit im Kern richtig sind und der Angeklagte Kaduk tatsächlich wiederholt Personengruppen in den Block 11 geführt und erschossen hat, was bei seiner Funktion als Rapportführer durchaus nahe liegt, kann nicht festgestellt werden, welche Personengruppen der Angeklagte Kaduk erschossen hat. Um Häftlinge, die im Bunker eingesessen haben, kann es sich nicht gehandelt haben, da die Opfer nach der Aussage des Zeugen Dr. Gl. erst in den Block 11 geführt worden sind. Bei den Erschiessungen kann es sich also nicht um Exekutionen nach sog. Bunkerentleerungen gehandelt haben. Es ist vielmehr anzunehmen, dass die Opfer von ausserhalb zu Exekutionen in das Lager Auschwitz eingeliefert worden sind. Jedenfalls kann dies nicht ausgeschlossen werden. Ob gegen diese Menschen durch Sondergerichte oder Polizeistandgerichte Todesurteile verhängt worden waren oder ob gegen sie nur Exekutionsanordnungen des RSHA vorlagen, muss offen bleiben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Personen durch irgendwelche Gerichte zum Tode verurteilt worden waren. Inwieweit diese Todesurteile und dementsprechend die Exekutionen rechtswidrig waren, konnte nicht geklärt werden, da die näheren Umstände nicht bekannt sind. Auch wenn sie rechtswidrig waren, was nur vermutet werden kann, ist dem Angeklagten Kaduk nicht mit Sicherheit nachzuweisen, dass er den verbrecherischen Charakter der Erschiessungsbefehle erkannt hat, was Voraussetzung für seine strafrechtliche Verantwortlichkeit wäre (§47 MStGB), da er, was zu seinen Gunsten angenommen werden muss, an den Erschiessungen nur auf Befehl mitgewirkt hat.
Die Aussage des Zeugen Dr. Gl. kann daher, auch wenn man unterstellt, dass der Zeuge zutreffend berichtet hat, nicht zu einer Verurteilung des Angeklagten Kaduk führen, ganz abgesehen davon, dass aus der Aussage des Zeugen Dr. Gl. nicht hervorgeht, ob die Erschiessungen durch den Angeklagten Kaduk im Mai 1943 oder im August 1944 stattgefunden haben.
Der Zeuge Fab. will ebenfalls gesehen haben, wie der Angeklagte Kaduk Menschen an der Schwarzen Wand erschossen hat. Kaduk habe niemals - so hat der Zeuge angegeben - sein Gewehr hinter dem Rücken versteckt. Er habe zusammen mit Stiebitz, Lachmann und Palitzsch geschossen. Palitzsch war bereits im Frühjahr 1943 mit Hofmann nach Birkenau gekommen. Es erscheint daher zweifelhaft, ob der Zeuge tatsächlich Kaduk zusammen mit Palitzsch hat schiessen sehen.
Gegen die Zuverlässigkeit des Erinnerungsvermögens des Zeugen bestehen Bedenken. Es kann hierzu auf die Ausführungen im 3. Abschnitt unter E.II.3. Bezug genommen werden. Aber auch wenn es stimmt, dass der Zeuge Fab. den Angeklagten Kaduk wiederholt Menschen an der "Schwarzen Wand" hat erschiessen sehen, was bei der Funktion des Angeklagten Kaduk im Lager durchaus nahe liegt, so fehlt es an Anhaltspunkten dafür, welche Personengruppen durch den Angeklagten Kaduk erschossen worden sind und welches die Gründe für die Erschiessungen der Menschen gewesen sind. Dass es sich um Häftlinge aus dem Lager oder um Häftlinge aus dem Arrestbunker, die nach sog. Bunkerentleerungen erschossen worden sind, gehandelt habe, hat der Zeuge Fab. nicht behauptet. Es kann sich daher in den vom Zeugen Fab. beobachteten Fällen ebenfalls um Zivilpersonen gehandelt haben, die zu Exekutionen in das KL Auschwitz eingeliefert worden sind.
Hier gilt das gleiche, was bereits bei der Erörterung der Aussage des Zeugen Dr. Gl. (siehe oben) ausgeführt worden ist. Es kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass die Menschen rechtswidrig getötet worden sind, wenn hierfür auch eine starke Vermutung besteht. Ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Angeklagte Kaduk nur auf Befehl an den Erschiessungen mitgewirkt hat und es kann ihm nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden, dass er den verbrecherischen Charakter der ihm gegebenen Befehle erkannt hat, wenn man einmal unterstellt, dass die Erschiessungen rechtswidrig waren.
Die Aussage des Zeugen Fab. kann daher ebenfalls nicht zu einer Verurteilung des Angeklagten Kaduk wegen Mordes oder Beihilfe zum Mord oder wegen Totschlags oder Beihilfe zum Totschlag führen.
Schliesslich hat noch der Zeuge Wö. bekundet, er habe gesehen, dass der Angeklagte Kaduk Menschen erschossen habe. Der Zeuge will seine Beobachtungen aus dem Arrestbunker heraus gemacht haben. Der Zeuge war ausweislich des Bunkerbuches vom 28.8.1943 bis zum 23.11.1943 im Arrestbunker eingesperrt (Bunkerbuch Band II Seite 36). Er kann somit Erschiessungen durch den Angeklagten Kaduk im Mai 1943 oder im August 1944 nicht gesehen haben. Nur diese werden dem Angeklagten Kaduk unter Ziffer 12 des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegt. Nur am Rande sei darauf hingewiesen, dass nach den getroffenen Feststellungen im August 1944 keine Erschiessungen mehr an der Schwarzen Wand stattgefunden haben. Wie bereits im 3. Abschnitt unter E.III.3. ausgeführt worden ist, wurde die Schwarze Wand nach dem Kommandantenwechsel im November 1943 abgerissen (Aussage des Zeugen Pi.). Erschiessungen fanden ab Februar 1944 nur noch an der Sauna in Birkenau statt, dagegen nicht mehr im Hof zwischen Block 10 und 11 (Aussage des Zeugen Sm.).
Der Angeklagte Kaduk war daher von den in Ziffer 12 des Eröffnungsbeschlusses enthaltenen Schuldvorwürfen mangels Beweises freizusprechen.
3.
Unter Ziffer 22 des Eröffnungsbeschlusses wird dem Angeklagten Kaduk zur Last gelegt, bei der letzten öffentlichen Exekution am 30.12.1944 (vgl. oben 5. Abschnitt III.8.) mitgewirkt zu
haben.
Der Angeklagte Kaduk war zwar bei dieser Exekution dabei. Zu einer Verurteilung kann dies jedoch nicht führen. Es gilt hier das gleiche, was bereits oben in diesem Abschnitt unter III.8. bezüglich des Angeklagten Boger erörtert worden ist. Auf diese Ausführung kann daher Bezug genommen werden.
Der Angeklagte Kaduk musste daher ebenso wie der Angeklagte Boger in diesem Punkt mangels Beweises freigesprochen werden.
4.
Dem Angeklagten Kaduk wird schliesslich unter Ziffer 25 des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegt, ein oder zwei Tage nach der Evakuierung des Konzentrationslagers Auschwitz den holländischen Häftling Ackermann in den Bauch geschossen zu haben, so dass der Häftling an den erlittenen Verletzungen verstorben sei.
Zu diesem Schuldvorwurf hat nur der Zeuge Toc. Bekundungen gemacht. Der Zeuge hat ausgesagt, er sei nach der Evakuierung des Lagers im Lager zurückgeblieben und habe die bettlägerigen Kranken versorgt. Im Block 28 habe er aus der Diätküche Verpflegung geholt und habe den Kranken auch Wasser gebracht. Einmal sei er gerade im Block 28 die Stiege heruntergekommen, da habe er den Angeklagten Kaduk mit einem holländischen Häftling stehen sehen. Kaduk habe dem Häftling ungefähr 3 m gegenübergestanden. Kaduk habe plötzlich die Pistole gezogen und den Häftling niedergeschossen. Er - der Zeuge - sei sofort die Stiege heruntergesprungen und habe sich versteckt. Kaduk habe dann weiter geschossen. Der Häftling, den Kaduk niedergeschossen habe, sei im HKB als Pfleger oder Häftlingsarzt beschäftigt gewesen. Er habe den Namen Ackermann gehabt. Zwei Ärzte hätten ihm - dem Zeugen - bestätigt, dass Ackermann an den Folgen von Bauchschüssen gestorben sei. Der Zeuge hat als möglich eingeräumt, dass er den Namen Ackermann erst später erfahren habe.
Das Gericht konnte nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass der Zeuge Toc. den Angeklagten Kaduk damals so genau gekannt habe, dass er ihn bei dem geschilderten Vorfall einwandfrei hat identifizieren können. Der Vorfall muss sich nach der Schilderung des Zeugen ziemlich schnell abgespielt haben. Nachdem der erste Schuss gefallen war, ist der Zeuge sofort weggelaufen. Bei seiner früheren Vernehmung im Ermittlungsverfahren hat der Zeuge angegeben, dass er den Vorfall aus Block 17, den er gerade habe verlassen wolle, beobachtet habe. Nach seiner Bekundung in der Hauptverhandlung will er den Vorfall von Block 28 aus gesehen habe. Nach der früheren Schilderung soll Kaduk an der Ecke der Häftlingsküche im Gespräch mit Ackermann gestanden haben. Auch nach der Schilderung in der Hauptverhandlung soll Kaduk mit dem Häftling vor der Häftlingsküche gestanden haben. Für die Beobachtungsmöglichkeit des Zeugen ist es jedoch von erheblicher Bedeutung, ob er den Vorfall von Block 17 oder von Block 28 aus gesehen hat. Block 17 lag unmittelbar gegenüber der Küche. Von hier aus war eine Sichtmöglichkeit. Zwischen Block 28 und der Küche lagen drei weitere Blocks. Von Block 28 bestand für den Zeugen keine gute Beobachtungsmöglichkeit. Es ist daher nicht sicher, dass er die Person des Schützen genau hat erkennen können.
Bedenken bestehen auch deshalb, weil in dem Auschwitzheft Nr.8 die Erschiessung des Häftlings Ackermann einem SS-Sturmbannführer zur Last gelegt wird, der Ackermann mit einer Abteilung SS-Männer erschossen haben soll. Die Hefte von Auschwitz und die in den Heften enthaltenen Angaben können zwar nicht als Beweismittel dienen. Die Angaben in den Auschwitzheften beruhen nach der glaubhaften Aussage der Zeugin Cze., die als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Historikerin bei dem Auschwitz-Museum angestellt ist, auf Dokumenten der SS, auf Mitteilung der Widerstandsbewegung während des Krieges sowie auf Aussagen, Berichten und Erklärungen von ehemaligen Häftlingen. Es ist daher anzunehmen, dass die Angabe, dass Ackermann von einem Sturmbannführer erschossen worden sei, ebenfalls auf einem Bericht oder einer Erklärung eines ehemaligen Häftlings aus dem KL Auschwitz oder aus der damaligen Widerstandsbewegung beruht. Irgendjemand muss daher einmal berichtet haben, der Häftling Ackermann sei von einem Sturmbannführer erschossen worden. Im Hinblick darauf erscheint es möglich - jedenfalls ist es nicht mit Sicherheit auszuschliessen -, dass sich der Zeuge Toc. in der Person des damaligen Täters geirrt hat.
Der Angeklagte Kaduk musste daher trotz erheblichen Verdachts auch von dem Schuldvorwurf unter Ziffer 25 des Eröffnungsbeschlusses mangels Beweises freigesprochen werden.
X. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Baretzki
1.
In Ziffer 2 des Eröffnungsbeschlusses wird dem Angeklagten Baretzki zur Last gelegt, in einer unbestimmten Zahl von Fällen durch einen Schlag mit der Hand, den er anderen SS-Angehörigen als "Spezialschlag" vorführte, Häftlinge getötet zu haben.
Er bestreitet dies. Er behauptet, er habe keinen Spezialschlag gehabt.
Der Zeuge Kugel. hat wohl gesehen, wie der Angeklagte mit Häftlingen Sport machte und sie geschlagen hat; er hat aber nicht gesehen, dass der Angeklagte jemanden totgeschlagen hätte.
Der Zeuge Stern. hat ausgesagt, der Angeklagte Baretzki habe auf der Lagerstrasse einem Häftling die Mütze heruntergerissen und ihm dann mit der Hand gegen die Halsschlagader geschlagen, so dass er tot umgefallen sei; das habe er in zwei bis drei Fällen gesehen. Die Aussage des Zeugen hat jedoch keinen Beweiswert. Wie bereits oben (5. Abschnitt III.9.) ausgeführt worden ist, ist der Zeuge Stern. unglaubwürdig. Auf die oben dargelegten Gründe kann Bezug genommen werden. Auf seine Aussagen konnten daher keine Feststellungen gestützt werden. Der Zeuge Got. meinte, es sei nicht schlimm gewesen, wenn Baretzki mit der Hand geschlagen habe, da sei nicht viel geschehen. Demgegenüber hat der Zeuge Pol. geschildert, der Angeklagte habe mit der Hand und dem Ellenbogen geschlagen und sehr gefährlich nach den Häftlingen getreten; Baretzki hat selbst gesagt, wenn er einmal hinschlüge, fiele jeder Häftling um. Aber auch dieser Zeuge erinnert sich nicht, dass der Angeklagte einen Häftling totgeschlagen hätte.
Der Zeuge Ros. hat gesehen, dass Baretzki schwache Häftlinge durch einen Spezialschlag mit dem Ellenbogen umschlug, so dass sie liegenblieben. Er weiss jedoch nichts davon, ob jemand nach einem solchen Schlag gestorben ist.
Auch der Zeuge Bac. hat geschildert, wie der Angeklagte einen Häftling derart zusammenschlug und trat, dass er nicht mehr aufstand. Ihm ist jedoch ebenfalls unmöglich zu sagen, was mit diesem Menschen geschehen ist.
Der Zeuge Doe. hat folgenden Vorfall mitangesehen, als er mit dem Arbeitskommando ins Lager einrückte: Baretzki schlug auf einen Häftling ein, der hinfiel, getreten wurde, aufstand, wieder geschlagen wurde und dann fortlief; Baretzki schoss zweimal nach dem Häftling, dieser fiel dann um. Was aus ihm geworden ist, konnte Doe. nicht erfahren.
Nach der Aussage des Zeugen Buk. hat der Angeklagte einen Angehörigen des Sonderkommandos im Lager B II d zusammengeschlagen, weil dieser nicht "Achtung" gerufen hat, als Baretzki den Block betrat. Der Häftling wurde in den Häftlingskrankenbau gebracht und soll dort, was der Zeuge aber nicht sicher weiss, gestorben sein.
Der dem Angeklagten in Ziffer 2 des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegte Sachverhalt ist danach nicht erwiesen.
2.
Auch in Punkt 3 des Eröffnungsbeschlusses war eine Verurteilung des Angeklagten nicht möglich. Nach ihm soll der Angeklagte Baretzki in zahlreichen Fällen bei der Hinrichtung von Häftlingen, die durch Erhängen vollzogen wurde, den Stuhl oder die Kiste weggestossen haben, auf denen die Häftlinge mit der Schlinge um den Hals standen. Der Angeklagte behauptet, nur ein einziges Mal bei einer derartigen Exekution als Zuschauer dabeigewesen zu sein.
Die Zeugen Laza., Fuk. und Knut. haben allerdings bekundet, der Angeklagte habe das eine oder andere Mal bei solchen Hinrichtungen einem Häftling die Schlinge um den Hals gelegt oder auch den Schemel, auf dem dieser stand, weggestossen. Sie haben aber auch ausgesagt, dass bei jeder dieser Hinrichtungen das gesamte Lager habe antreten müssen und vor der Vollstreckung ein Hinrichtungsbefehl, bzw. ein Urteil verlesen worden sei.
Danach steht nicht fest, ob diese Exekutionen auf Grund rechtswidriger Befehle - etwa des RSHA - stattgefunden oder ob Gerichtsurteile vorgelegen haben.
Im übrigen konnte dem Angeklagten, falls nur Exekutionsbefehle vorgelegen haben sollten, nicht nachgewiesen werden, dass er die Unrechtmässigkeit der Befehle kannte und infolgedessen wusste, das sie ein Verbrechen zum Gegenstand hatten. Da diese Hinrichtungen vor dem ganzen Lager vollzogen wurden und der Angeklagte erst im Laufe des Krieges nach Deutschland kam, konnte er bei seiner einfachen Denkungsart der Ansicht sein, die Hinrichtung sei wegen eines todeswürdigen Verbrechens nach Durchführung eines vorgeschriebenen Verfahrens ordnungsgemäss von der zuständigen Stelle angeordnet worden. Andere Zeugen, wie Cor., Gl. und Mir. konnten konkrete Aussagen hierzu nicht machen.
3.
Der Vorwurf unter Ziffer 4 des Eröffnungsbeschlusses, der Angeklagte habe Anfang des Jahres 1943 zwei Gefangene an den mit Starkstrom geladenen Lagerzaun gestossen, ist ausschliesslich von dem Zeugen Knut. bestätigt worden. Das Gericht hatte jedoch Bedenken, seiner Aussage zu folgen. Denn der Zeuge hat in verschiedenen Punkten Angaben gemacht, die sich nicht mit den auf andere Weise getroffenen Feststellungen decken. So hat er den Angeklagten, den er gut gekannt haben will, als den späteren SS-Unterscharführer Baretzki bezeichnet, obgleich dieser niemals SS-Unterscharführer war. Es besteht somit die Möglichkeit, dass der Zeuge den Angeklagten infolge einer Personenverwechslung für den Täter hält. Da der Zeuge bereits verstorben ist, konnte das Gericht hierzu nichts weiter aufklären, es konnte auch keinen persönlichen Eindruck von diesem Zeugen gewinnen.
Auch in diesem Punkte war eine Überführung des bestreitenden Angeklagten nicht möglich. 4.
In Ziffer 5 des Eröffnungsbeschlusses wird dem Angeklagten zur Last gelegt, er habe sich am 4.Oktober 1943 mit anderen SS-Angehörigen an einer sog. "Hasenjagd" beteiligt, d.h. an einer Verfolgung willkürlich gegen den elektrisch geladenen Draht getriebener Häftlinge, wobei 11 Häftlinge eines Transportes aus Lemberg erschossen worden sein sollen. Der Angeklagte behauptet, von einem solchen Ereignis nichts zu wissen.
Nun hat zwar der Zeuge Dr. Wo., der es mit seinen Zeugenpflichten ausserordentlich erst genommen hat, erklärt, Baretzki sei bei der Erschiessung dieser 11 neu im Quarantänelager angekommenen Häftlinge dabeigewesen; es habe sich um eine Gruppe von angetretenen Polen gehandelt, die plötzlich von SS-Leuten mit Stöcken geschlagen wurden, so dass sie auseinander stoben, alle SS-Leute hätten dann geschossen. Der Zeuge stand aber etwa 50 m vom Orte des Geschehens entfernt. Er ist kurzsichtig und hat auf die Frage, ob auch Baretzki geschossen habe, ob er ihn habe zielen sehen, geantwortet: "Keiner hat nicht geschossen - es ist schon zu lange her."
In seinem Bericht vom 17.4.1945, auf den er sich bei seiner Aussage gestützt hat, hat er lediglich ausgesagt, die Neuankömmlinge seien von Wachtposten (die auf den Wachttürmen standen) erschossen worden. Er nennt dabei Baretzki nicht. Es kann daher nicht mehr irrtumsfrei festgestellt werden, wer wen erschossen hat und ob sich der Angeklagte an diesen Tötungen beteiligt hat.
5.
Nach Punkt 7 des Eröffnungsbeschlusses soll der Angeklagte, was er bestreitet, im Sommer 1944 einen Häftling im Gang einer Baracke getötet haben.
Der Zeuge Gw. hat im Ermittlungsverfahren am 9.3.1960 ausgesagt, er habe gesehen, wie Baretzki mit einem Häftling allein in die Baracke gegangen und bald danach ohne diesen wieder herausgekommen sei; der Häftling habe dann tot am Eingang der Baracke gelegen.
In der Hauptverhandlung dagegen hat der Zeuge mehrfach erklärt, ausser Baretzki sei noch ein anderer Blockführer mit in diese Baracke gegangen.
Infolge dieses erheblichen Widerspruches zwischen den Aussagen dieses Zeugen konnten keine Feststellungen dahin getroffen werden, der Angeklagte sei an der Tötung dieses Gefangenen in der einen oder anderen Weise beteiligt gewesen. Es besteht nach der Bekundung des Zeugen - weitere Beweismittel standen nicht zu Verfügung - die Möglichkeit, dass der von ihm neuerdings erwähnte andere Blockführer den Häftling getötet hat, ohne dass Baretzki diese Tötung gewollt oder gebilligt hat.
6.
Der Angeklagte soll weiterhin im Jahre 1944 bei der Ankunft eines Häftlingstransportes aus Lodz eine Frau, die von ihrem bereits im Lager befindlichen Bruder erkannt und angerufen worden sein soll, erschossen haben (Ziffer 8 des Eröffnungsbeschlusses). Er erklärt, hiervon nichts zu wissen. Als einziger Zeuge konnte der Kaufmann Mont. dazu vernommen werden. Er hat ausgesagt: Baretzki habe im Frühjahr 1944 einen Transport aus Lodz auf der Strasse zwischen den Lagerabschnitten c und d hindurchgeführt, vermutlich zur Gaskammer. Eine Frau aus dieser Gruppe habe ihren im Lager B II d befindlichen Bruder erkannt und angerufen. Dieser sei daraufhin ausgerissen. Baretzki habe die Frau aus der Reihe geholt und erschossen, sie sei hingefallen und später weggetragen worden. Er habe das alles aus dem Lagerabschnitt d beobachtet, er sei nur 3 bis 4 m von dem Ort des Geschehens entfernt gewesen.
Diese Schilderung bietet keine ausreichende Grundlage für eine Schuldfeststellung.
Es steht zunächst nicht fest, ob diese Frau tatsächlich tot war. Ausserdem bestehen Bedenken, ob sich der Vorfall so ereignet hat, wie ihn der Zeuge schildert.
Es erscheint nämlich denkbar, dass - umgekehrt wie der Zeuge es schildert - der Bruder die Schwester angerufen hat, da er bereits im Lager war und Gelegenheit hatte, sich die Angekommenen in Ruhe anzusehen. Das hat der Zeuge früher auch so ausgesagt und hinzugefügt, Baretzki habe zuerst auf den Bruder angelegt, dieser sei aber weggelaufen.
Dann ist es aber naheliegend, dass die anderen am Zaun stehenden Häftlinge auch sofort weggelaufen sind aus Furcht, andernfalls erschossen zu werden und dass der Zeuge lediglich im Weglaufen noch einen Schuss gehört, nicht aber gesehen hat, wer geschossen hat. Er weiss auch nicht zu sagen, ob Baretzki einen Karabiner oder eine Pistole in der Hand gehabt hat. Der Zeuge hat erst nachher, als die Frau weggetragen worden war, erfahren, dass der Häftling, welcher zuerst davonlief, deren Bruder gewesen ist. Es besteht danach die Möglichkeit, dass der Zeuge in Wirklichkeit den Hergang des Geschehens nicht verfolgen konnte und auch nicht verfolgt hat, weil er sich selbst in Sicherheit brachte, als Baretzki die Waffe hob und später nur Schlussfolgerungen über den von ihm angenommenen Geschehensablauf gezogen hat.
7.
Dem Angeklagten wird ferner zur Last gelegt, im Herbst 1944 nach einem Aufstand der Häftlinge in einem Krematorium innerhalb der Postenkette von einem Fahrrad aus auf Häftlinge geschossen zu haben, wobei mehrere getötet worden sein sollen (Ziffer 10 des Eröffnungsbeschlusses).
Es steht aber nicht fest, ob der Angeklagte bei dieser Gelegenheit einen dieser auf der Flucht befindlichen Gefangenen erschossen hat. Er gibt zwar zu, zum "Einfangen" der Häftlinge eingesetzt gewesen zu sein, ein Teil von ihnen sei auch wieder ergriffen worden, er habe aber keinen erschossen.
Der eben erwähnte Zeuge Mont. hat lediglich gesehen, dass Baretzki mit dem Fahrrad ausserhalb des Lagers herumgefahren ist und, einen Karabiner tragend, Häftlinge gesucht hat; er hat jedoch nicht gesehen, sondern nur erzählen hören, dass der Angeklagte auf Häftlinge geschossen habe.
Der Zeuge Pol. konnte nicht sehen, dass Baretzki zu dem Wiederergreifen der Gefangenen eingesetzt war. Allerdings hat der Angeklagte später ihm und anderen Häftlingen gegenüber damit geprahlt, er habe an diesem Tage 15 der "Ausgebrochenen" mit der Maschinenpistole erschossen.
Bei der Wesensart des Angeklagten, der im übrigen nach der Aussage des Zeugen Mont. einen Karabiner, nicht aber eine Maschinenpistole mitführte, ist es nicht ausgeschlossen, dass diese seine Erzählung eine reine Prahlerei war und er in Wirklichkeit auf keinen Häftling geschossen hat.
8.
Schliesslich soll der Angeklagte noch nach Ziffer 11 des gegen ihn ergangenen Eröffnungsbeschlusses im Jahre 1944 willkürlich einen jüdischen Häftling im Lager Birkenau mit der Pistole erschossen haben.
Eine Überführung des auch diese Mordtat bestreitenden Angeklagten war nicht möglich. Der Kaufmann Ti. hat bei seiner eidlichen Vernehmung durch das Landgericht in Wien, die im Wege der Rechtshilfe erfolgte, ausgesagt:
Eines Tages sei ein jüdischer Häftling etwa 20 m vor ihm auf der Lagerstrasse in dem Abschnitt B II g (Lager "Kanada") von Baretzki angerufen worden. Er sei aber um die Ecke einer Unterkunftsbaracke gebogen, Baretzki sei ihm nachgelaufen und dann habe er - der Zeuge - einen oder mehrere Schüsse gehört, sich erst vorsichtshalber in diese Baracke zurückgezogen und nach dem Weggang von Baretzki den Häftling tot hinter der Baracke liegen sehen.
Das Gericht hatte Bedenken, allein auf diese Aussage - andere Beweismittel liegen auch in diesem Falle nicht vor - die Verurteilung des Angeklagten zu stützen. Der Zeuge, österreichischer Staatsangehöriger, hat es abgelehnt, vor dem Schwurgericht auszusagen, weil er in Deutschland die Vollstreckung einer Gefängnisstrafe von 10 Monaten zu erwarten hat, die das Amtsgericht Wesel im Jahre 1961 wegen bestimmungswidriger Verwendung von Wiedergutmachungsgeldern - nach seiner Meinung zu Unrecht - gegen ihn ausgesprochen hat. Das Gericht konnte deshalb keinen persönlichen Eindruck von dem Zeugen gewinnen, was aber zur Feststellung, ob er ein zuverlässiger Zeuge mit sicherem Erinnerungsvermögen ist, unerlässlich gewesen wäre.
In den Fällen 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 und 11 des Eröffnungsbeschlusses musste daher der Angeklagte Baretzki mangels Nachweises der ihm weiterhin zur Last gelegten Straftaten freigesprochen werden.
XI. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Dr. Capesius
1.
Dem Angeklagten Dr. Capesius wird in Ziffer 2 des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegt, in mindestens 5 Fällen bei Aussonderungen (Selektionen) im Lager Birkenau mitgewirkt zu haben, wobei zahlreiche Häftlinge zur Vergasung bestimmt und anschliessend getötet worden sein sollen. Der Angeklagte Dr. Capesius konnte jedoch insoweit einer strafbaren Handlung nicht überführt werden.
a. Er soll einmal während einer Selektion im Frauenlager Birkenau in einem Block nach Frauen, die sich versteckt hatten, gesucht und hierbei eine Frau gefunden haben, die alsdann vergast worden sei.
Hierzu hat die Zeugin Sa. bekundet, dass sie den Angeklagten Dr. Capesius einmal bei einem normalen Appell im Frauenlager gesehen habe. Dr. Capesius sei zusammen mit Dr. Mengele und Dr. Klein zu diesem Appell erschienen. Während des Appells hätte er nichts gemacht. Er habe nur dabeigestanden. Ein anderes Mal habe sich eine Frau vor einem Appell versteckt gehabt. Dr. Capesius habe an dem betreffenden Morgen mit einem Stock im Stroh gesucht. Er habe eine schwangere Frau im Stroh gefunden und habe sie mit dem Stock zu dem Zählappell hinausgejagt. Später habe sie Dr. Capesius nicht mehr gesehen. Auch die Frau habe sie später nicht mehr gesehen. Bei dem Appell seien dann schwache Häftlingsfrauen ausgesucht worden. Dabei habe sie aber Dr. Capesius nicht mehr gesehen.
Diese Aussage der Zeugin Sa. reicht nicht aus, um sichere Feststellungen treffen zu können. Zunächst erscheint es unwahrscheinlich, dass der Angeklagte Dr. Capesius als SS-Hauptsturmführer und Apotheker in den Baracken nach versteckten Frauen gesucht haben soll. Das haben die SS-Führer in der Regel den SS-Unterführern und SS-Männern überlassen. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass sich die Zeugin Sa. insoweit irrt.
Aber auch wenn der Angeklagte Dr. Capesius die Frau zu dem Zählappell hinausgejagt haben sollte, steht nicht fest, was später mit der Frau geschehen ist. Die Zeugin Sa. konnte darüber keine Angaben machen. Die Tatsache, dass sie die Frau später nicht wiedergesehen hat, reicht allein nicht aus, um feststellen zu können, dass die Frau auch tatsächlich getötet worden ist. Es kann auch nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass der Angeklagte Dr. Capesius die Frau deswegen zu dem Appell geschickt hat, dass sie getötet werde. Nach der Aussage der Zeugin handelte es sich um einen normalen Zählappell. Zwar sollen später von den angetretenen Frauen die Schwachen ausgesucht worden sein. Die Zeugin wusste jedoch nicht, was mit den schwachen Frauen geschehen ist. Im KL Auschwitz und in Birkenau sind zwar viele Menschen umgebracht worden und man hat häufig schwache und arbeitsunfähige Menschen zur Vergasung ausgesucht. Aus der Schilderung der Zeugin ergibt sich jedoch nicht, ob man auch in diesem Fall die schwachen Frauen anschliessend durch Gas getötet hat. Es erscheint nicht völlig ausgeschlossen, dass man sie in diesem Fall auf einen anderen Lagerabschnitt verlegt oder in den HKB gebracht hat. Nicht sicher ist auch, dass der Angeklagte Dr. Capesius, den die Zeugin bei der Aussonderung der schwachen Frauen nicht mehr gesehen hat, von vornherein gewusst hat, dass eine Selektion stattfinden sollte. Wegen dieser Unsicherheiten konnte das Gericht auf Grund der Aussage der Zeugin Sa. nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass der Angeklagte Dr. Capesius bewusst und gewollt an einer Selektion, bei der Frauen für die Vergasung ausgesucht worden sind, mitgewirkt hat.
Die Zeugin Sza. will ebenfalls einmal gesehen haben, wie der Angeklagte Dr. Capesius nach versteckten Frauen in einer Baracke gesucht habe. Sie hat bekundet, dass der Angeklagte Dr. Capesius eine Frau, die sich auf einem Bett versteckt gehabt habe, gefunden und hinausgejagt habe.
Gegen die Zuverlässigkeit des Erinnerungsvermögens der Zeugin Sza. bestehen Bedenken. Insbesondere konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass sie den Angeklagten Dr. Capesius damals im KL Auschwitz-Birkenau richtig identifiziert hat. Ihre Aussage hat das Gericht daher nicht verwertet. Zur näheren Begründung kann auf die Ausführungen im 3. Abschnitt unter N.III.4. verwiesen werden.
Hier erscheint es unwahrscheinlich, dass die Zeugin Sza., die zu dem Appell mit hat antreten müssen, selbst gesehen haben kann, wie der Angeklagte Dr. Capesius eine Frau auf dem Bett gefunden und hinausgejagt hat. Wenn sie bereits draussen mit den anderen Frauen angetreten war, konnte sie das nicht sehen. Im übrigen ergibt sich aus der Aussage der Zeugin nicht, was mit dieser Frau später geschehen ist.
Die Aussage der Zeugin Sza. kann daher ebenfalls nicht zu einer Verurteilung des Angeklagten Dr. Capesius führen.
b. Der Angeklagte Dr. Capesius soll ferner an zwei verschiedenen Tagen im Sommer 1944 jeweils gemeinschaftlich mit dem Lagerarzt Dr. Mengele in einer Baracke des Frauenlagers bei Selektionen in der Form mitgewirkt haben, dass er die Aufforderung des Dr. Mengele, kranke Frauen sollten sich melden, in die ungarische Sprache übersetzt habe. Die Häftlingsfrauen, die sich daraufhin gemeldet hätten, sollen anschliessend durch Gas getötet worden sein. Zu diesem Anklagepunkt hat ebenfalls nur die Zeugin Sza. Bekundungen gemacht. Sie hat ausgesagt, dass Dr. Mengele eines Tages mit dem SS-Offizier, den sie auf der Rampe gesehen habe und der nach Meinung der Zeugin Dr. Capesius gewesen sein soll, in ihren Block im Lagerabschnitt B II c gekommen sei und gesagt habe, wer krank sei, solle sich melden. Die Kranken kämen in ein Krankenhaus. Der Offizier (Dr. Capesius) habe diese Erklärung des Dr. Mengele in die ungarische Sprache übersetzt. Er habe so schön gesprochen. Seinen Namen habe sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekannt. Die Kranken seien dann weggekommen. Sie haben nicht gesehen, wohin die Kranken gekommen seien.
Auch in diesem Punkt kann nicht festgestellt werden, dass der Angeklagte Capesius der "Offizier" gewesen ist, der den Dr. Mengele begleitet hat. Die Zeugin will erst später erfahren haben, dass der Offizier der Angeklagte Dr. Capesius gewesen sei. Im Hinblick auf die Bedenken, die gegen die Zuverlässigkeit der Zeugin Sza. bestehen, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Zeugin insoweit einem Irrtum zum Opfer gefallen ist und den Angeklagten Dr. Capesius mit einem anderen SS-Führer (möglicherweise mit dem Lagerarzt Dr. Klein, der ebenfalls die ungarische Sprache beherrscht hat) verwechselt. Im übrigen geht aus der Aussage der Zeugin nicht klar hervor, ob die kranken Frauen später tatsächlich auch getötet worden sind. Dies kann nur vermutet werden. Sichere Feststellungen sind jedoch, da weitere Anhaltspunkte fehlen, nicht möglich.
c. Dem Angeklagten Dr. Capesius wird ferner zur Last gelegt, dass er im August 1944 gemeinschaftlich mit dem Lagerarzt Dr. Mengele und zwei weiteren namentlich nicht bekannten SS-Führern jüdische Knaben aus Ungarn, die in dem Kinderblock untergebracht gewesen seien und zu fliehen versucht hätten, mit Schlägen in die Baracke zurückgetrieben hätte. Alle Kinder aus dieser Baracke, etwa 1200 sollen 4 Tage später in die Gaskammer abtransportiert worden sein.
Zu diesem Anklagepunkt haben nur die Zeugen Glü. und von Sebe. Bekundungen gemacht. Beide Zeugen sind nicht zuverlässig. Hierzu kann auf die Ausführungen im 3. Abschnitt unter N.III.4. verwiesen werden. Das Gericht hat die Aussagen dieser beiden Zeugen insgesamt nicht verwertet.
Auch bezüglich der 1200 jüdischen Knaben weicht die Darstellung, die der Zeuge Glü. in der Hauptverhandlung gegeben hat, von seiner Darstellung vor dem Untersuchungsrichter am 16.10.1961 ab. In der Hauptverhandlung hat der Zeuge Glü. über das Schicksal von 1200 jüdischen Knaben folgendes ausgesagt: Die Knaben im Alter von 16-18 Jahren seien im Block 11 des Lagerabschnittes B II e (Zigeunerlager) untergebracht gewesen. Anfang Oktober 1944 sei der Lagerarzt Dr. Mengele mit dem Lagerführer und Dr. Capesius in den Lagerabschnitt hereingekommen. Der Lagerführer habe zwei Hunde dabeigehabt. Die Kinder aus dem Block hätten irgend etwas geahnt und seien weggelaufen. Der Lagerführer habe daraufhin die Kinder mit den Hunden zusammengetrieben und in den Block 11 hineingetrieben. Es sei am jüdischen Neujahrsfest gewesen. Die erwachsenen Häftlinge hätten während dieser Zeit gerade beim Appell gestanden. Nach zwei Tagen seien LKWs gekommen. Man habe die Kinder auf die LKWs verladen und in das Gas geschickt. Ob der Angeklagte Dr. Capesius bei der Verladung dabeigewesen sei, wisse er nicht. Auf die Frage, welche Rolle der Angeklagte Dr. Capesius beim Zusammentreiben und Hineintreiben der Kinder in den Block 11 gespielt habe, hat der Zeuge erklärt: Beim Hineintreiben der Kinder in den Block 11 hätte jeder der SS-Führer (Dr. Mengele, Dr. Capesius und andere "Offiziere") den Knaben "so einen Stoss" gegeben. Geschlagen habe jedoch nur der Lagerführer.
Demgegenüber hat der Zeuge Glü. bei seiner Vernehmung durch den Untersuchungsrichter am 16.10.1961, was ihm in der Hauptverhandlung vorgehalten worden ist, erklärt, einige Knaben hätten versucht, aus den kleinen Fenstern des Blockes 11 zu entkommen. Sie seien jedoch durch Schläge zurückgetrieben worden. Auch der Angeschuldigte Dr. Capesius habe auf die Kinder eingeschlagen. Er - der Zeuge - wisse noch genau, dass der Angeklagte Dr. Capesius auf die Knaben eingeschlagen habe. Dr. Capesius habe die Kinder mit der Hand geschlagen. Nach mehreren habe er auch mit dem Fuss getreten.
Der bereits mehrfach erwähnte Häftlingsarzt Dr. Bej., der damals noch als Häftlingsarzt im Lagerabschnitt B II e tätig war und auf das Gericht einen glaubwürdigen Eindruck gemacht hat, hat den Angeklagten Dr. Capesius jedoch nie in seinem Lagerabschnitt gesehen. Dieser Zeuge hat - wie er glaubhaft bekundet hat - den Lagerapotheker überhaupt nicht gekannt. Er habe ihn nie - so hat der Zeuge Bej. erklärt - in seinem Lagerabschnitt gesehen. Als Häftlingsarzt kannte der Zeuge Bej. jedoch die Lagerärzte Dr. Mengele und Dr. Klein sehr gut. Letzteren hat der Zeuge als den Assistenten des Dr. Mengele bezeichnet. Wenn auch der Lagerapotheker mit in den Lagerabschnitt hereingekommen wäre, hätte das der Zeuge sehen und als Häftlingsarzt auch seinen Namen erfahren müssen, ebenso wie er die Namen der Ärzte Dr. Mengele und Dr. Klein erfahren hat. Der Zeuge war nach seiner glaubhaften Bekundung auch noch am Versöhnungstag des Jahres 1944 im Lagerabschnitt B II e. Da der Versöhnungstag im Jahre 1944 eine Woche nach dem jüdischen Neujahrstag 1944 gefeiert wurde, muss der Zeuge Bej. demnach noch im Lager gewesen sein, als die 1200 Knaben nach der Aussage des Zeugen Glü. zusammengetrieben worden sein sollen. Der Zeuge Bej. hätte demnach als Häftlingsarzt die Aktion gegen die Kinder miterleben und auch den Angeklagten Dr. Capesius sehen müssen. Hiervon wusste jedoch der Zeuge Bej. nichts. Die Aussage des Zeugen Glü. kann daher wegen der Widersprüche in seinen beiden Darstellungen vor allem aber auch im Hinblick auf die Aussage des Zeugen Bej. nicht Grundlage für sichere Feststellungen sein.
Das gleiche gilt für die Aussage des Zeugen von Sebe. Auch dieser Zeuge ist nicht zuverlässig. Er hat ebenfalls widersprüchliche Angaben über die Aktion gegen die 1200 jüdischen Kinder gemacht, die im übrigen auch nicht mit der Aussage des Zeugen Glü. übereinstimmen. In der Hauptverhandlung hat der Zeuge von Sebe. erklärt, dass am 10.11. oder 12.10.1944 Dr. Mengele in Begleitung des Dr. Capesius in den Lagerabschnitt B II e hereingekommen sei. Sie - die Häftlinge - hätten gerade in Reih und Glied gestanden. Dr. Capesius habe keine Tätigkeit ausgeübt. Er - der Zeuge - glaube, dass die Kinder auf LKWs geladen worden seien. Er könne es aber nicht mehr beschwören. Die Kinder seien erst im Block 11 gewesen und seien dann herausgekommen. Sie seien nicht selektiert sondern sofort verladen worden. Bei dieser Verladung habe Dr. Capesius dabeigestanden.
Bei seiner früheren Vernehmung durch den Untersuchungsrichter am 17.10.1961 hat der Zeuge jedoch eine ganz andere Darstellung gegeben. Er hat damals ausgesagt, was ihm von dem Verteidiger des Angeklagten Dr. Capesius vorgehalten worden ist, dass die Kinder zunächst mit Hilfe von Spürhunden zusammengetrieben und in den Block 11 hineingebracht worden seien. Dort hätten sie zwei oder drei Tage verweilen müssen. Dann seien sie während der Nachtstunden mit LKWs abtransportiert worden. Nach der Aussage des Zeugen in der Hauptverhandlung sollen die Kinder am Tage während eines Appells verladen worden sein. Eine Erklärung für diese widersprüchlichen Angaben konnte der Zeuge nicht geben. Sichere Feststellungen konnten daher auch nicht auf die Aussagen des Zeugen von Sebe. gestützt werden.
d. Dem Angeklagten Dr. Capesius wird ferner zur Last gelegt, am 13.10.1944 gemeinschaftlich mit dem Lagerarzt Dr. Mengele sämtliche weiblichen Häftlinge, die im Revier des Frauenlagers gewesen sind, zur Vergasung bestimmt und ihren Abmarsch in die Gaskammern überwacht zu haben.
In diesem Punkt wird der Angeklagte Dr. Capesius nur von dem Zeugen Glü. belastet. Der Zeuge will am 13.10.1944 im Lager III (das sog. Lager Mexiko) die Selektion von Frauen, die aus dem Revier herausgeführt worden seien, beobachtet haben. Bei dieser Selektion seien - so hat der Zeuge angegeben - vier bis fünf SS-Männer dabeigewesen. Unter ihnen seien Dr. Mengele und Dr. Capesius gewesen. Unter den kranken Frauen habe er - der Zeuge - auch seine Frau gesehen. Zuvor habe er noch seine Frau in der Baracke besucht gehabt, sei dann jedoch als Dr. Mengele gekommen sei, sofort durch das Fenster der Baracke gesprungen und sei weggelaufen. Er habe sich wieder zu seinem Arbeitskommando begeben. Von dem Arbeitskommando aus habe er die Selektion beobachtet.
Es kann dem Zeugen Glü. zwar geglaubt werden, dass er im Lager Mexiko eine Selektion beobachtet hat, bei der auch seine Frau zum Tode bestimmt worden ist. Im Hinblick auf die Bedenken gegen seine Zuverlässigkeit erscheint es jedoch nicht sicher, dass er den Angeklagten Dr. Capesius bei der Selektion einwandfrei hat identifizieren können, zumal der Zeuge die Selektion nicht aus kurzer Entfernung hat beobachten können. Der Zeuge v. Sebe. hat bekundet, dass damals der Zeuge Glü. ihm von dieser Selektion am gleichen Tage erzählt habe. Glü. habe jedoch nur erwähnt, dass Dr. Mengele die Selektion durchgeführt habe. Daran, dass Glü. auch von Dr. Capesius gesprochen habe, konnte sich der Zeuge nicht erinnern. Es erscheint daher nicht ausgeschlossen, dass der Zeuge Glü. sein Erlebnis auf den Angeklagten Dr. Capesius zu Unrecht projiziert hat. Bedenken bestehen vor allem auch deswegen, weil es kaum zu den Aufgaben des Lagerapothekers gehört hat, an Selektionen im Lager Mexiko teilzunehmen. Das war Sache der für das Lager Birkenau zuständigen SS-
Lagerärzte. Für Dolmetscheraufgaben brauchte der Angeklagte Dr. Capesius nicht hinzugezogen zu werden, da der Lagerarzt Dr. Klein ebenfalls die ungarische Sprache beherrscht hat.
Der Angeklagte Dr. Capesius konnte daher auch in diesem Anklagepunkt nicht mit Sicherheit überführt werden.
e. Dem Angeklagten Dr. Capesius wird schliesslich unter Ziffer 2 des Eröffnungsbeschlusses noch zur Last gelegt, die "Liquidierung" des Zigeunerlagers (31.7.1944) überwacht zu haben.
Auch in diesem Anklagepunkt konnte der Angeklagte Dr. Capesius nicht überführt werden.
Dieser Schuldvorwurf beruhte auf der Aussage des Zeugen Glü., die er im Vorverfahren vor dem Untersuchungsrichter am 16.10.1961 gemacht hat. Damals hat der Zeuge - wie bereits oben (3. Abschnitt N.III.4.) erwähnt - angegeben, er wisse mit "absoluter Sicherheit", dass der Angeklagte Dr. Capesius bei der Räumung des Zigeunerlagers dabeigewesen sei. In der Hauptverhandlung hat der Zeuge diese Aussage jedoch nicht mehr aufrecht erhalten. Er hat erklärt, er habe die Verladung der Zigeuner nur durch Löcher der Baracke beobachtet und habe nicht gesehen, wer bei der Verladung der Zigeuner dabeigewesen sei. Der Zeuge hat also in der Hauptverhandlung nicht mehr behauptet, den Angeklagten Dr. Capesius bei der "Liquidierung" des Zigeunerlagers gesehen zu haben.
Der Angeklagte Dr. Capesius musste daher von sämtlichen unter a.-e. aufgeführten Schuldvorwürfen mangels Beweises freigesprochen werden.
2.
Dem Angeklagten Dr. Capesius wird in Ziffer 3 des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegt, Versuche mit narkotisierenden Mitteln an Häftlingen durchgeführt zu haben. Er soll Evipan und Morphium mit Kaffee gemischt und die Dosis so verstärkt haben, dass mindestens zwei Häftlinge nach dem Genuss dieses Getränkes gestorben sein sollen. Eine sichere Aufklärung war zu diesem Anklagepunkt nicht möglich.
Der Zeuge Dr. M. hat ausgesagt, dass er einmal von einem Versuch des Dr. Rohde mit Narkotika gehört habe. Der Zeuge war - wie bereits ausgeführt - als SS-Arzt im hygienischen Institut tätig. Sein Vorgesetzter war Dr. Weber. Der Zeuge Dr. M. hat bekundet, dass Dr. Rohde, der gut mit ihm und Dr. Weber bekannt gewesen sei, eines Tages zu ihnen gekommen sei und gesagt habe, er wolle einen Versuch mit Narkotika machen. Die Politische Abteilung sei daran interessiert, wie man einen Menschen durch Narkotika in die Hand bekommen und zum Reden bringen könne. Dr. Rohde habe von ihnen einen Rat haben wollen, wie man das mache. Dr. Weber habe daraufhin geantwortet, er solle in der Literatur nachsehen. Er - der Zeuge Dr. M. - habe zwar davon gehört, dass dann eine Versuchsreihe gemacht worden sei, es seien dabei auch Menschen gestorben. Näheres wisse er jedoch nicht. Woher Dr. Rohde die Narkotika und Giftstoffe für die Versuchsreihe gehabt habe, wisse er ebenfalls nicht. Dr. Rohde müsse sie entweder aus dem hygienischen Institut oder aus der Apotheke gehabt haben. Positives wisse er - der Zeuge - jedoch nicht.
Nach dieser Aussage des Zeugen Dr. M. müsste der Initiator der Versuchsreihe der SS-Arzt Dr. Rohde gewesen sein. Zweck der Versuchsreihe war es - nach dem, was Dr. M. von Dr. Rohde gehört hat - offenbar, Menschen durch Medikamente, eine Art "Plauderdroge" zum Reden zu bringen. Inwieweit der Angeklagte Dr. Capesius an der Versuchsreihe beteiligt war, insbesondere inwieweit er die erforderlichen Medikamente und Giftstoffe zur Verfügung gestellt hat, und inwieweit er in den Zweck und die beabsichtigte Ausführung der Versuchsreihe eingeweiht worden ist, konnte nicht geklärt werden.
Der Angeklagte Dr. Capesius hat sich hierzu wie folgt eingelassen:
Eines Tages sei Dr. Rohde mit einer Tüte Kaffeebohnen gekommen und habe ihn gebeten, die Kaffeebohnen mahlen und einen Liter Kaffee kochen zu lassen. Er - der Angeklagte - habe daraufhin den Dr. Rohde nach dem Grund gefragt, da es nicht üblich gewesen sei, in der Apotheke Kaffee für andere zu mahlen. Dr. Rohde habe daraufhin geantwortet, er habe Befehl einen Versuch zu machen. Man wolle durch Beimischen von Evipan und Morphium in Kaffee erreichen, dass ein Mensch nach dem Genuss dieses Getränkes für längere Zeit eingeschläfert werde. Als Beispiel habe Dr. Rohde die Einschläferung eines Spions in einer Kaschemme genannt, den man auf diese Weise festhalten wolle, bis die Polizei herbeigerufen worden sei. Er - der Angeklagte - habe dann Dr. Rohde Evipan und Morphium in einer Menge gegeben, die nicht zum Tode eines Menschen habe führen können. Am nächsten Tage habe er - der Angeklagte - erfahren, dass ein griechischer Häftling an dem Versuch gestorben sei. Er sei dann von Dr. Wirths aufgefordert worden, Aufklärung über den Fall zu geben. Dabei habe er - der Angeklagte - erst genauere Einzelheiten erfahren. Dr. Rohde habe sich bereits vorher, bevor er zu ihm - dem Angeklagten - gekommen sei, von dem Häftlingsapotheker Strauch 5 Ampullen Morphium geben lassen, was er - der Angeklagte - jedoch nicht gewusst habe. Dr. Strauch habe diese 5 Ampullen dem Dr. Rohde auf Grund eines ordnungsmässigen Rezeptes herausgegeben.
Diese Einlassung des Angeklagten Dr. Capesius ist nicht mit Sicherheit zu widerlegen. Der Zeuge Sik. hat bekundet, dass eines Tages ein Läufer gekommen sei und ihm gesagt habe, dass man zwei Häftlingen irgend ein Medikament zu trinken gegeben habe. Einer der Häftlinge sei gestorben. Der Läufer habe dies auch dem Angeklagten Dr. Capesius mitgeteilt. Später hätte er ihm - dem Zeugen erzählt, dass die Nachricht über den Tod des Häftlings grossen Eindruck auf Dr. Capesius gemacht habe. Der Häftlingsapotheker Strauch habe ihm - dem Zeugen Sik. - damals erzählt, dass Dr. Rohde in die Apotheke gekommen sei und dass Dr. Rohde und Dr. Capesius irgend ein Medikament für Versuchszwecke zubereitet hätten. Diese Aussage des Zeugen Sik. kann nur wenig zur Aufklärung des Falles beitragen. Sie widerlegt die Behauptung des Angeklagten Dr. Capesius, dass Dr. Rohde sich 5 Ampullen Morphium ohne sein Wissen aus der Apotheke besorgt hat, nicht. Aus ihr ergibt sich auch nicht, dass der Angeklagte Dr. Capesius bei dem Versuch selbst zugegen war.
Die Zeugen Dr. Kl. und F. haben zu diesem Fall auch Bekundungen gemacht. Auch sie bringen keine Klarheit. Dr. Kl. hat ausgesagt, dass eines Tages einige jüdische Häftlinge in das Zimmer des SS-Lagerarztes auf Block 21 bestellt worden seien. Er - der Zeuge - habe später gehört, dass man den Häftlingen eine Flüssigkeit zum Trinken gegeben habe, die den Geschmack von Kaffee gehabt habe. Gesehen habe er an dem betreffenden Vormittag, wie nach zwei oder drei Stunden die Häftlinge schwankend aus dem Seiteneingang des Blockes 21 herausgekommen seien. Sie seien auf den Hof zwischen Block 20 und 21 gegangen. Bei ihnen seien einige SS-Männer gewesen. Man habe ihm - dem Zeugen - gesagt, dass unter den SS-Männern auch Dr. Capesius sei. Er selbst habe aber den Angeklagten Dr. Capesius damals nicht vom Ansehen gekannt.
Der Zeuge konnte daher keine Gewähr dafür übernehmen, ob der Angeklagte Dr. Capesius tatsächlich auf dem Hof dabeigewesen ist. Möglich ist, dass ihm ein anderer Häftling irrtümlich einen SS-Führer (vielleicht einen SS-Arzt) als den Angeklagten Dr. Capesius bezeichnet hat. Der Zeuge Dr. Kl. hat dann weiter bekundet, dass die SS-Männer den Häftlingen die Pistolen auf die Stirn gesetzt und zu ihnen irgend etwas gesagt hätten. Danach seien die Häftlinge wieder durch den Block 28 auf den Block 19 zurückgegangen. Am nächsten Tag seien dann zwei von den vier Häftlingen gestorben. Sie - die Funktionshäftlinge - hätten dann versucht, das Geheimnis dieser Angelegenheit aufzuklären. Aus dem gesammelten Informationsmaterial von Kameraden hätten sie erfahren, dass es sich um ein Experiment gehandelt habe, ob es gelinge, durch den Einfluss dieser Mittel den psychischen Widerstand von Häftlingen zu brechen.
Der Zeuge Dr. F. hat über den Fall eine etwas andere Darstellung als der Zeuge Dr. Kl. gegeben. Der Zeuge F. hat behauptet, dass Dr. Rohde, Dr. Weber und Dr. Capesius eines Sonntags vormittags in das Lager hereingekommen seien. Dr. Rohde sei auf Block 19 gekommen und habe sich dort drei oder vier jüdische Häftlinge ausgesucht. Dann habe er dem Häftlingspfleger befohlen, die Häftlinge auf das Arztzimmer des Blockes 21 zu bringen. Der Blockälteste des Blockes 19 habe ihm - dem Zeugen - davon benachrichtigt. Er - der Zeuge - sei daraufhin auf Block 21 gegangen und habe sich neben das Arztzimmer gestellt. Nach einer Weile sei dann eine Trage angefordert worden. Wieder einige Zeit später seien die Häftlinge auf der Trage bewusstlos auf den Hof zwischen 20 und 21 getragen worden. Nur ein Häftling sei wieder zum Bewusstsein gekommen. Der Häftling habe ihm - dem Zeugen - erzählt, dass er Kaffee zu trinken bekommen habe. Die Häftlinge seien dann wieder auf Block 19 gebracht worden und seien dort alle gestorben. Der Zeuge hat gemeint, dass Dr. Weber der Initiator des Experiments gewesen sein müsse. Er könne dies jedoch nicht beweisen. Er hat ferner gemeint, dass Dr. Capesius das Medikament zubereitet haben müsse. Auf die Frage, woher er das wisse, hat er erklärt, Dr. Capesius müsse es gemacht haben, weil er der Apotheker gewesen sei.
Auch die Aussage des Zeugen F. ermöglicht nicht die sichere Aufklärung des Falles. Abgesehen davon, dass die Darstellung des Zeugen von der Schilderung des Zeugen Dr. Kl. erheblich abweicht, geht aus ihr nicht klar hervor, welche Rolle der Angeklagte Dr. Capesius dabei gespielt hat. Es ist nicht einmal sicher, ob der Angeklagte Dr. Capesius dabei war, als den Häftlingen das Getränk eingeflösst wurde. Zwar soll nach der Aussage des Zeugen Dr. F. der Angeklagte Dr. Capesius mit in das Lager gekommen sein. Bei Ausführung des Experiments war der Zeuge jedoch nicht dabei. Er konnte nicht sagen, ob der Angeklagte Dr. Capesius auch in dem Arztzimmer des Blockes 21 gewesen ist. Der Zeuge hat auch nicht behauptet, dass er den Angeklagten Dr. Capesius später auf dem Hof zwischen Block 20 und 21 gesehen hat.
Wahrscheinlich ist damals über den Versuch, der ohne Zweifel stattgefunden und unter den Häftlingen erhebliches Aufsehen erregt hat, viel gesprochen worden. Offenbar war man an der Aufklärung des Falles sehr interessiert. Es erscheint nicht sicher, ob der Zeuge Dr. F. heute noch genau unterscheiden kann zwischen dem, was er selbst gesehen und was ihm damals oder später von anderen Häftlingen über den Fall berichtet worden ist. Es erscheint daher auch nicht sicher, ob der Angeklagte Dr. Capesius damals tatsächlich mit in das Lager gekommen ist. Möglicherweise ist dem Zeugen Dr. F. dies nur von dem Blockältesten, der ihn auch über die Auswahl der jüdischen Häftlinge durch Dr. Rohde benachrichtigt hat, berichtet worden, oder der Zeuge glaubt heute noch, da er meint, Dr. Capesius müsse das Getränk zubereitet haben, Dr. Capesius müsse auch mit in das Lager hereingekommen sein. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Zeuge insoweit irrt. Eine genaue Rekonstruktion des Falles ist daher heute nicht mehr möglich. Es scheint jedoch sicher zu sein, dass das Ziel des Versuches nicht die Tötung eines Menschen gewesen ist. Allem Anschein nach wollte man entweder ein Mittel ausprobieren, wie man einen Menschen zum Reden bringen könne oder man wollte versuchen, wie man mit einem Gemisch aus Kaffee, Evipan und Morphium die Widerstandskraft eines Häftlings brechen und ihn eventuell betäuben könne.
Inwieweit der Angeklagte Dr. Capesius über das Ziel des Versuches informiert war und inwieweit er wusste, welche Mittel man den Häftlingen verabreichen wollte und verabreicht hat und in welcher Dosierung, muss jedoch offen bleiben. Vor allem fehlt es an Anhaltspunkten dafür, dass der Angeklagte Dr. Capesius damit gerechnet und es in Kauf genommen hat, dass einer der Häftlinge bei dem Versuch sterben könnte. Er musste daher auch von diesem Schuldvorwurf mangels Beweises freigesprochen werden.
3.
Dem Angeklagten Dr. Capesius wird schliesslich unter Ziffer 4 des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegt, dass er das Phenol, das mit seinem Wissen zur Tötung von Häftlingen verwendet worden sei, angefordert, verwaltet und an die SDGs, die die tödlichen Injektionen verabreicht hätten, herausgegeben habe oder habe herausgeben lassen.
Auch in diesem Anklagepunkt konnte der Angeklagte Dr. Capesius nicht mit Sicherheit überführt werden.
Der Zeuge Wö. hat behauptet, dass die sog. "Abspritzungen" d.h. die Tötung von Häftlingen durch Phenol bereits im Jahre 1943 eingestellt worden seien. Er hat ausgesagt, er - der Zeuge - habe zusammen mit dem Zeugen La. die Einstellung der "Abspritzungen" bei Dr. Wirths dadurch erreicht, dass sie Dr. Wirths gemeldet hätten, dass ein Reichsdeutscher durch eine Phenolinjektion getötet worden sei. Dr. Wirths habe sich dann das Krankenblatt des betreffende Häftlings bringen lassen. Auf dem Krankenblatt habe gestanden, dass der reichsdeutsche Häftling Tuberkulose gehabt habe. Dr. Wirths habe ihnen, den Zeugen Wö. und La., noch den Vorwurf gemacht, sie hätten einen SS-Führer (den Lagerarzt) zu Unrecht verdächtigt. Er - der Zeuge Wö. - habe dann jedoch mit Hilfe des Häftlingsarztes festgestellt, dass Dr. Entress kurz vorher das Krankenblatt des betreffenden reichsdeutschen Häftlings gefälscht habe, indem er wahrheitswidrig eingetragen habe, der reichsdeutsche Häftling habe TK gehabt. Das habe er ebenfalls dem Standortarzt Dr. Wirths gemeldet. Dieser habe daraufhin dem Lagerarzt Dr. Entress einen Verweis erteilt. Die "Abspritzungen" seien daraufhin eingestellt worden. Der Zeuge Wö. hat mit Bestimmtheit erklärt, dass dies im Jahre 1943 gewesen sei. Da der Angeklagte Dr. Capesius erst im Jahre 1944 nach Auschwitz gekommen ist, kann er, wenn die Aussage des Zeugen Wö. insoweit richtig ist, was nicht widerlegt werden kann, nicht mehr Phenol für Phenoltötungen verwaltet und herausgegeben haben.
Der Zeuge Dr. Kl. hat zwar im Gegensatz zur Aussage des Zeugen Wö. gemeint, dass Tötungen mit Phenol noch bis zum Sommer 1944 vorgekommen seien. Die Behauptung des Zeugen beruht jedoch auf einer Schlussfolgerung, deren Richtigkeit zweifelhaft ist. Der Zeuge Dr. Kl. hat nämlich zur Begründung seiner Behauptung angeführt, dass der Lagerarzt Dr. Entress erst im Sommer 1944 von Auschwitz weggekommen sei. Der Zeuge nimmt demnach an, dass Phenolinjektionen bis zum Weggang des Lagerarztes Dr. Entress vorgekommen sein müssten. Dieser Schluss ist jedoch nicht zwingend. Denn nach der Aussage des Zeugen Wö. haben die Phenoltötungen bereits zu einer Zeit aufgehört, als der Lagerarzt Dr. Entress noch in Auschwitz war. Der Zeuge Wö. hat hierfür eine einleuchtende Erklärung gegeben. Durch die Aussage des Zeugen Kl. wird daher die Aussage des Zeugen Wö. nicht widerlegt.
Der Zeuge Pro. will einmal gesehen haben, dass der Angeklagte Dr. Capesius dem Angeklagten Klehr Phenol ausgehändigt habe. Das müsste im Jahre 1944 gewesen sein. Es ist jedoch möglich, dass sich der Zeuge Pro. im Jahr und in der Person des Apothekers geirrt hat. Denn der Angeklagte Klehr war im Jahre 1944 bereits im Nebenlager Gleiwitz. Es erscheint daher wenig wahrscheinlich, dass er sich in Auschwitz beim Apotheker Dr. Capesius Phenol abgeholt hat. Möglich ist, dass der Zeuge gesehen hat, wie der Apotheker Krömer (der Vorgänger des Angeklagten Dr. Capesius) dem Angeklagten Klehr 1943, als Klehr noch im Stammlager war, Phenol ausgehändigt hat und irrtümlich annimmt, dass es der Apotheker Dr. Capesius gewesen sei.
Der Zeuge Sik. will zwar gesehen haben, wie der Angeklagte Dr. Capesius einmal eine Phenolanforderung unterschrieben hat. Die Phenolanforderung sei - so hat der Zeuge erklärt - nach Berlin gegangen. Die Anforderung müsste ebenfalls erst im Jahre 1944 gemacht worden sein, da der Angeklagte Dr. Capesius erst in diesem Jahr nach Auschwitz gekommen ist. Da aber nach der Aussage des Zeugen Wö. im Jahre 1944 keine Phenolinjektionen mehr ausgeführt worden sind, steht nicht fest, dass mit diesem Phenol auch noch Menschen getötet worden sind.
Eine Bestrafung des Angeklagten Dr. Capesius wegen Teilnahme an Tötungshandlungen durch Phenolinjektionen setzt voraus, dass mit dem Phenol, das der Angeklagte Dr. Capesius angefordert hat, tatsächlich auch noch Menschen getötet worden sind oder dass zumindest versucht worden ist, damit Menschen zu töten. Das konnte jedoch im Hinblick auf die Aussage des Zeugen Wö. nicht festgestellt werden. Die Anforderung des Phenols allein ist daher noch kein strafbarer kausaler Beitrag zu einer Tötungshandlung oder versuchten Tötung.
Der Angeklagte Dr. Capesius musste daher auch von dem Schuldvorwurf unter Ziffer 4 des Eröffnungsbeschlusses mangels Beweises freigesprochen werden.
XII. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Klehr
1.
Dem Angeklagten Klehr werden unter Ziffer 1 des Eröffnungsbeschlusses noch einige bestimmte Fälle zur Last gelegt, in denen er Häftlinge zur Vergasung ausgesondert haben soll. In diesen Fällen konnte er jedoch nicht überführt werden.
a. In Ziffer 1c des Eröffnungsbeschlusses wird ihm vorgeworfen, im Januar 1943 auf der Rampe aus einem eingetroffenen Häftlingstransport ungefähr 40-50 Häftlinge zur Vergasung ausgesondert zu haben.
Dieser Schuldvorwurf hat in der Hauptverhandlung keine Bestätigung gefunden. Kein Zeuge hat über diesen konkreten Fall Angaben machen können. Im Ermittlungsverfahren war der Angeklagte Klehr insoweit durch den Zeugen Ce. belastet worden. Auf die Vernehmung dieses Zeugen ist jedoch allseits verzichtet worden, da er in der Hauptverhandlung nicht vernommen werden konnte.
Der Angeklagte Klehr konnte daher insoweit nicht überführt werden. Er war deshalb von dem Schuldvorwurf unter Ziffer 1c des Eröffnungsbeschlusses mangels Beweises freizusprechen.
b. In Ziffer 1e 2. Satz des Eröffnungsbeschlusses wird dem Angeklagten Klehr zur Last gelegt, im Herbst 1944 im Häftlingskrankenbau mehrere bei einem Bombenangriff verwundete Häftlinge zur Vergasung ausgesondert zu haben. Dieser Schuldvorwurf beruhte auf einer schriftlichen Erklärung des Zeugen Ko. im Ermittlungsverfahren. In der Hauptverhandlung hat der Zeuge seine Erklärung, soweit er den Angeklagten Klehr belastet hatte, jedoch nicht mehr aufrecht erhalten. Der Zeuge hat in der Hauptverhandlung folgendes geschildert: Im September 1944 sei ein Bombenangriff auf das KL Auschwitz erfolgt. Dabei seien viele Häftlinge und SS-Männer verwundet worden. Die Verwundeten seien in den HKB gekommen und dort behandelt worden. Die durch den Bombenangriff verletzten Häftlinge seien nach einiger Zeit, als sie wieder zu Kräften gekommen seien, mit Wagen fortgebracht worden. Im Lager habe man erzählt, das sei auf Anweisung der Lagerkommandantur erfolgt. Nach einigen Tagen seien die Häftlinge, die man weggebracht habe, als verstorben vom HKB abgesetzt worden.
In seiner früheren Erklärung hatte der Zeuge angegeben, - was ihm in der Hauptverhandlung vorgehalten worden ist und von ihm bestätigt wurde - Klehr habe allein viele von den verwundeten Häftlingen für einen Transport in die Gaskammern ausgesucht. Nachdem ihm dies in der Hauptverhandlung vorgehalten worden war, hat der Zeuge erklärt, es habe zwar eine Selektion bei den Verwundeten stattgefunden, er habe jetzt Zweifel, ob der Angeklagte Klehr diese Selektion durchgeführt habe. Andere Zeugen haben über die Aktion gegen die Verwundeten aus dem Bombenangriff im Herbst 1944 keine Bekundungen machen können. Es erscheint auch nicht wahrscheinlich, dass der Angeklagte Klehr im Herbst 1944 noch an Selektionen im HKB des Stammlagers teilgenommen hat. Denn zu dieser Zeit war er bereits im Nebenlager Gleiwitz tätig, was der Zeuge Fa. bestätigt hat.
Der Angeklagte musste daher auch von diesem Schuldvorwurf mangels Beweises freigesprochen werden.
c. Unter Ziffer 1f des Eröffnungsbeschlusses wird dem Angeklagten Klehr zur Last gelegt, zu einem nicht mehr festzustellenden Zeitpunkt in Block 21 des HKB des Stammlagers mehrere kranke Häftlinge zur Vergasung ausgesondert zu haben, unter denen sich der Häftling Szende, der an Erfrierungserscheinungen gelitten hätte, befunden habe. Zu diesem Schuldvorwurf hat nur der Zeuge Rei. Bekundungen gemacht. Er hat in der Hauptverhandlung erklärt, er könne sich noch an den Fall Szende erinnern. Szende sei ein Wiener Jude gewesen. Er sei zusammen mit seinem Sohn nach Auschwitz gekommen. Zuerst sei er im Stammlager geblieben, dann sei er zu einem Nebenlager versetzt worden. Eines Tages sei er mit Erfrierungen an Händen und Füssen in das Stammlager zurückgekommen. Seine Finger seien schon schwarz gewesen. Kurze Zeit später sei Szende mit anderen Häftlingen bei einer Selektion ausgesondert worden. Er sei dann mit den anderen Häftlingen mit einem LKW nach Birkenau gebracht worden. Sein Sohn habe kurz vor der Abfahrt des LKWs davon erfahren, dass sein Vater nach Birkenau gebracht werden solle. Es habe zwischen dem Vater und dem Sohn eine erschütternde Szene stattgefunden. Als der Vater auf den LKW gebracht worden sei, habe man den Sohn bei ihm gelassen und ihn ebenfalls nach Birkenau gefahren. Er - der Zeuge - wisse jedoch nicht mehr, wer damals die Selektion gemacht und den Vater Szende ausgesucht habe.
Bei seiner früheren Vernehmung im Vorverfahren hatte der Zeuge Rei. behauptet, dass der Angeklagte Klehr damals die Selektion und die Aussonderung des Häftlings Szende durchgeführt habe. Nachdem ihm dies in der Hauptverhandlung vorgehalten worden war, meinte zwar der Zeuge, wenn er das damals so gesagt habe, dann stimme es auch. Er fügte noch hinzu, dass er nun wisse, dass der Angeklagte Klehr die Selektion gemacht habe. Wegen der Differenzen zwischen den beiden Aussagen des Zeugen Rei. hat das Gericht jedoch Bedenken, ob die Erinnerung des Zeugen Rei. insoweit noch ganz zuverlässig ist. Da kein anderer Zeuge diesen Vorfall bestätigt hat, konnte das Gericht nicht die sichere Überzeugung gewinnen, dass der Angeklagte Klehr in diesem Fall der Täter gewesen ist oder an der Selektion in irgendeiner Weise mitgewirkt hat.
Der Angeklagte Klehr musste daher trotz erheblichen Tatverdachts von dem Schuldvorwurf unter Ziffer 1f mangels Beweises freigesprochen werden.
2.
Unter Ziffer 2 des Eröffnungsbeschlusses werden dem Angeklagten Klehr einige konkret aufgeführten Tötungshandlungen zur Last gelegt, die ihm ebenfalls nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden konnten.
a. Nach Ziffer 2b des Eröffnungsbeschlusses soll der Angeklagte Klehr in den Jahren 1942 und 1943 zahlreiche Häftlinge, die an ihnen durchgeführten Fleckfieberexperimente überlebt gehabt hätten, durch Phenolinjektionen getötet haben. Dieser Schuldvorwurf hat in der Hauptverhandlung keine Bestätigung erfahren. Kein Zeuge hat konkrete Angaben darüber machen können, dass der Angeklagte Klehr Häftlinge, an denen die Lagerärzte Dr. Entress und Dr. Vetter in Block 20 Experimente durchgeführt hatten, durch Phenolinjektionen getötet habe. Dies kann zwar vermutet werden, sichere Feststellungen lassen sich insoweit jedoch nicht treffen. Eine Verurteilung konnte daher insoweit nicht erfolgen, vielmehr musste der Angeklagte Klehr von dem Schuldvorwurf unter Ziffer 2b mangels Beweises freigesprochen werden.
b. Unter Ziffer 2d des Eröffnungsbeschlusses wird dem Angeklagten Klehr zur Last gelegt, im September 1942 die Häftlinge Teofil Cyron, Dr.phil. Weiner und den Studenten Siegmund Stobiecki, die hätten erschossen werden sollen, jedoch nicht transportfähig gewesen seien, durch Phenolinjektionen getötet zu haben.
Hierzu hat der Zeuge Glo. folgendes ausgesagt: Im September 1942 hätten die drei Häftlinge Weiner, Cyron und Stobiecki, die wegen Typhusverdachtes in HKB und zwar in Block 20 gelegen hätten, in Block 11 erschossen werden sollen. Sie hätten zu einem Transport aus Krakau gehört. Dort seien sie bei einer Razzia in einem Cafehaus verhaftet worden. Die Gruppe, zu der sie gehört hätten, sei unter dem Namen "Plastikergruppe" bekannt gewesen. Eines Tages sei Klehr erschienen und habe die Namen der drei Häftlinge aufgerufen. Alle drei seien dann durch Phenolinjektionen getötet worden. Er - der Zeuge - habe zwar nicht selbst die Tötung dieser drei Häftlinge mit angesehen. Er habe aber die drei Häftlinge vom Stand des Blocks absetzen müssen. Als Todesursache sei Körperschwäche und Herzanfall angegeben worden.
Bei seiner früheren polizeilichen Vernehmung im Ermittlungsverfahren am 21.November 1960 hatte der Zeuge angegeben - was er auf Vorhalt in der Hauptverhandlung bestätigt hat -, dass die drei Häftlinge vom Rapportführer angefordert worden seien, weil sie im Block 11 hätten erschossen werden sollen. Die Häftlinge seien aus irgend einem Grunde "zum Tode verurteilt" gewesen. Welches der Grund hierfür gewesen sei, könne er nicht angeben. Weil die Häftlinge nicht transportfähig gewesen seien, seien sie durch Phenolinjektionen getötet worden. Nachdem dem Zeugen diese seine frühere Aussage in der Hauptverhandlung vorgehalten worden war, erklärte er, es sei möglich, dass die ganze Gruppe zum Tode verurteilt gewesen sei. Er selbst habe aber die Todesurteile nicht gesehen.
Da die drei Häftlinge nach der Aussage des Zeugen Glo. in Krakau in einem Cafehaus verhaftet worden sind, kann die Möglichkeit, dass sie Mitglieder einer Widerstandsgruppe gewesen sind, nicht ausgeschlossen werden. Es erscheint auch möglich, dass sie durch ein Sonder- oder Polizeistandgericht zum Tode verurteilt worden sind und zur Vollstreckung der Todesurteile in das KL Auschwitz eingeliefert worden waren. Da die näheren Umstände nicht bekannt sind, kann nicht geklärt werden, ob die Verhängung der Todesstrafe rechtmässig erfolgt ist oder ob ein durchgeführtes Verfahren und die in diesem Verfahren gefällten Todesurteile gegen anerkannte Rechtsgrundsätze verstossen haben. Die Tötung der Häftlinge durch Phenol kann die Vollstreckung dieser Todesurteile gewesen sein, da die Erschiessung der Häftlinge wegen ihres Gesundheitszustandes nicht möglich war. Wenn auch vermutet werden kann, dass die Tötung der drei Häftlinge rechtswidrig war, da als Todesursache fingierte Krankheiten angegeben worden sind, so lässt sich jedoch nicht mit Sicherheit feststellen, dass der Angeklagte Klehr in diesem Fall klar erkannt hat, dass der Befehl, die Häftlinge zu töten, ein allgemeines Verbrechen bezweckte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ihm erklärt worden ist, die Häftlinge seien zum Tode verurteilt und er müsse die Todesurteile durch Phenolinjektionen vollstrecken, weil die Häftlinge wegen ihres Gesundheitszustandes nicht erschossen werden könnten. Er kann daher angenommen haben, dass er als Henker Todesurteile vollstrecken müsse und die Tötung dieser drei Häftlinge rechtmässig sei.
Eine Verurteilung des Angeklagten Klehr war daher in diesem Fall nicht möglich, auch wenn die Tötung der drei Häftlinge rechtswidrig gewesen sein sollte.
Der Angeklagte Klehr war daher von dem Schuldvorwurf unter Ziffer 2d mangels Beweises freizusprechen (§47 MStGB).
c. In Ziffer 2h des Eröffnungsbeschlusses wird dem Angeklagten Klehr zur Last gelegt, im Sommer 1942 eine Gruppe von 15 jüdischen Häftlingen, die im Nebenlager Jawischowice beschäftigt gewesen seien und zur ambulanten Behandlung in das Stammlager gekommen seien, durch Phenolinjektionen getötet zu haben.
Hierzu hat der Zeuge Joa., der in der Hauptverhandlung nicht vernommen werden konnte, sondern vor dem Kreisgericht in Krakau am 26.4.1955 kommissarisch vernommen worden ist - das Protokoll über diese Vernehmung wurde in der Hauptverhandlung verlesen -, bekundet, er habe im Sommer 1942 eine Gruppe von 15 jüdischen Häftlingen aus dem Nebenlager Jawischowice auf den Block 28 zur ambulanten Behandlung bringen müssen. Er habe die Gruppe aus ihrem Block abgeholt und zu Block 28 gebracht. Dort habe er den Angeklagten Klehr in einer Arztschürze angetroffen. Klehr habe ihn gefragt, warum er gekommen sei. Er - der Zeuge - habe geantwortet, er bringe eine Gruppe von 15 Häftlingen aus dem Nebenlager Jawischowice, damit sie verbunden würden. Klehr habe daraufhin sofort gesagt, dass sie Juden seien. Dann habe er - Klehr - alle 15 ihre Hemden hochziehen lassen. Er - der Zeuge - habe dann bemerkt, dass Klehr dem ersten Häftling, den er durch die Eingangstür in den Korridor habe kommen lassen, eine Spritze in die Herzgegend gegeben habe. Klehr habe dann der Reihe nach die in den Korridor hereingeführten Häftlinge mit der Spritze gestochen. Vor seinen - des Zeugen - Augen habe Klehr vier Häftlinge "abgespritzt". Die vier seien auf den Boden gefallen. Klehr habe ihm dann befohlen, die Evidenzkarten der Häftlinge zu holen zwecks Umschreibung auf den Block 28. Als er - der Zeuge - mit den Evidenzkarten wieder zurückgekommen sei, hätten alle 15 jüdischen Häftlinge hinter dem Block 28 an der Wand auf dem Boden tot gelegen.
Dem Angeklagten Klehr ist diese Handlungsweise zwar ohne weiteres zuzutrauen. Die Darstellung des Zeugen Joa., von dem sich das Schwurgericht keinen persönlichen Eindruck verschaffen konnte, und gegen dessen Glaubwürdigkeit gewisse Bedenken bestehen (vgl. oben 5. Abschnitt V.1.) ist jedoch nicht so überzeugend, dass darauf sichere Feststellungen gestützt werden könnten. Sie enthält gewisse Unklarheiten und Unwahrscheinlichkeiten. Im Jahre 1942 wurden Phenolinjektionen nicht im Block 28 sondern im Block 20 durchgeführt. Die Rekordspritze und das Phenol befanden sich auf Block 20. Der Angeklagte Klehr hat die Tötungen nach den getroffenen Feststellungen stets in aller Heimlichkeit im Zimmer Nr.1 des Blockes 20 unter Assistenz von Funktionshäftlingen durchgeführt. Die Opfer mussten hinter dem Vorhang, der im Korridor des Blockes 20 angebracht war, warten. Es erscheint daher nicht sehr wahrscheinlich, dass der Angeklagte Klehr im Block 28 die Rekordspritze und das Phenol bereits bereit gehabt haben soll, als der Zeuge Joa. mit den 15 jüdischen Häftlingen ankam. Klehr kann über die Ankunft der 15 Häftlinge auch nicht vorher informiert gewesen sein. Denn sonst hätte er den Zeugen Joa. nicht gefragt, warum er mit den 15 Häftlingen komme. Wenn er über die Ankunft der 15 Häftlinge bereits vorher informiert gewesen wäre und schon vorher die Absicht gehabt hätte, die Häftlinge zu töten, hätte er sie sich wahrscheinlich auf Block 20 bringen lassen.
Der Angeklagte Klehr hat ferner darauf hingewiesen, dass ambulante Behandlung von Häftlingen aus Jawischowice nicht im Stammlager durchgeführt worden sei. Es ist zwar denkbar, dass man den Häftlingen nur vorgespielt hat, sie sollten zur ambulanten Behandlung nach Auschwitz gebracht werden, während man sie in Wirklichkeit zur Tötung nach Auschwitz überstellt hat. Dann hätte der Angeklagte Klehr die Tötung aber nach seinen sonstigen Gepflogenheiten mit aller Wahrscheinlichkeit auf Block 20 im Zimmer Nr.1 durchgeführt. Nicht sehr wahrscheinlich erscheint es auch, dass der Angeklagte Klehr die ersten Häftlinge sofort in Gegenwart des Zeugen Joa. getötet haben soll.
Die Aussage des Zeugen Joa. erscheint daher nicht so zuverlässig, dass darauf sichere Feststellungen gestützt werden könnten. Da andere Zeugen diesen Fall nicht bestätigt haben, war daher der Angeklagte Klehr von diesem Schuldvorwurf mangels Beweises freizusprechen.
3.
In Ziffer 4 des Eröffnungsbeschlusses wird dem Angeklagten Klehr zur Last gelegt, in der zweiten Hälfte des Jahres 1942 mehrere Häftlingspfleger auf dem Dachboden eines Blockes des HKB im Stammlager durch sog. "Sportmachen" so lange gequält zu haben, dass der Häftling Rudek an Herzschwäche gestorben sei. Hierzu hat der Zeuge Glo. glaubhaft bekundet, dass der Angeklagte Klehr eines Tages, nachdem er - der Zeuge - zwei Wochen im HKB gewesen sei, ohne jeden Anlass mit einer Gruppe von Häftlingspflegern, zu denen er - der Zeuge - auch gehört habe, auf dem Speicher des Blockes 28 sog. "Sportübungen" gemacht habe. Die Übungen hätten eine "Ewigkeit" gedauert, Klehr habe die Häftlinge dabei auch getreten. Ein Häftling namens Rudek sei bei den Sportübungen auf den Boden gefallen. In der folgenden Nacht sei er gestorben.
Das Gericht hat zwar keinen Zweifel, dass die Aussage des Zeugen Glo. der Wahrheit entspricht. Es fehlt jedoch an Anhaltspunkten dafür, dass der Angeklagte Klehr bei diesen Sportübungen den (direkten oder bedingten) Vorsatz gehabt habe, den Häftling Rudek zu töten. Es besteht die Möglichkeit, dass er die Häftlinge nur quälen und schikanieren wollte, ohne dass er den Tod des Häftlings Rudek in Rechnung gestellt und billigend in Kauf genommen hat.
Eine Verurteilung des Angeklagten Klehr wegen Mordes oder Totschlages in diesem Fall war daher nicht möglich. Er war daher von dem Schuldvorwurf unter Ziffer 4 des Eröffnungsbeschlusses mangels Beweises freizusprechen.
4.
Dem Angeklagten Klehr wird schliesslich in Ziffer 5 des Eröffnungsbeschlusses zur Last gelegt, im Mai oder Juni 1944 eine ältere Jüdin und deren Tochter, die sich nach einer Selektion nicht hätten trennen
wollen, zu einer der in das Erdreich gegrabenen Brandstellen bei den Krematorien in Birkenau geführt und lebend in das Feuer gestossen zu haben. Der Zeuge Putz. hat bei seiner Vernehmung im Vorverfahren am 26.9.1962 behauptet - was ihm in der Hauptverhandlung vorgehalten und von ihm bestätigt worden ist -, dass der Angeklagte Klehr einmal im Mai oder Juni 1944 eine ältere Jüdin, die bei einer Selektion zur Vergasung ausgesondert worden sei und deren Tochter, die sich von ihrer Mutter nicht habe trennen wollen, zu einer Brandstelle geführt und lebend in das Feuer hineingestossen habe. In der Hauptverhandlung hat der Zeuge zwar den gleichen Vorfall geschildert, hat jedoch behauptet, dass ein slowakischer SDG die beiden Frauen in das Feuer gestossen habe. Auf Vorhalt, dass er bei seiner früheren Vernehmung den Angeklagten Klehr als den Täter bezeichnet habe, hat der Zeuge erklärt, dass er das nicht mehr aufrecht erhalten könne.
Da sonstige Zeugen über diesen Vorfall keine Bekundungen gemacht haben, konnte der Angeklagte Klehr insoweit nicht überführt werden. Im Hinblick auf die Aussage des Zeugen Putz. in der Hauptverhandlung konnte nicht festgestellt werden, dass die früheren Angaben des Zeugen im Ermittlungsverfahren der Wahrheit entsprochen haben.
Der Angeklagte Klehr war daher auch in diesem Anklagepunkt mangels Beweises freizusprechen.
XIII. Weitere Schuldvorwürfe gegen den Angeklagten Bednarek
Dem Angeklagten Bednarek werden in dem Eröffnungsbeschluss weitere, im einzelnen angeführte Fälle zur Last gelegt, in denen er durch Misshandlung den Tod von weiteren Häftlingen verschuldet haben soll. Insoweit jedoch war eine Überführung des Angeklagten nicht möglich. 1.
Nach Ziffer 3 des Eröffnungsbeschlusses soll der Angeklagte Häftlinge der Strafkompanie gezwungen haben, sich so lange unter die kalte Dusche zu stellen, bis sie unterkühlt gewesen seien, erstarrt und umgefallen seien. Danach sollen sie in den Hof des Strafblocks hinausgetragen worden sein, wo sie während der Nacht liegen geblieben sein sollen. Der grösste Teil von ihnen soll danach verstorben sein.
Als einziger Zeuge konnte hierzu Dr. Gl. vernommen werden. Der Zeuge schildert, dass er gesehen habe, wie Bednarek im Winter 1944/1945 Angehörige der Strafkompanie nackt auf die Strasse gejagt und mit Wasser begossen habe. Diese Häftlinge hätten so lange draussen stehen müssen, bis sie umgefallen seien. Sie seien dann später als erfroren in den Häftlingskrankenbau gebracht worden und seien dort als Leichen geblieben. Dies sei mehrere Male geschehen.
Es bestehen Bedenken, ob die Schilderung dieses Zeugen zutreffend ist. Er hat auf Befragen, woher er diese Kenntnis habe, erklärt, er habe in ständiger Verbindung mit dem Häftlingskrankenbau in Birkenau gestanden. Zum anderen hat sich bei der Prüfung der den Angeklagten Dylewski, Scherpe und Hantl vorgeworfenen Straftaten ergeben, dass das Erinnerungsvermögen dieses Zeugen nicht zuverlässig ist.
Die Aussage von Dr. Gl. allein reicht demgemäss nicht aus, den Angeklagten Bednarek der ihm zur Last gelegten weiteren Straftaten zu überführen.
2.
Der Angeklagte soll im Sommer 1944 bei der Liquidierung des Familienlagers B II b gemeinschaftlich mit SS-Dienstgraden auf jüdische Häftlinge eingeschlagen haben, die sich dem Abtransport zur Gaskammer widersetzt haben sollen. Mindestens 10 Häftlinge sollen hierbei ums Leben gekommen sein (Ziffer 4 des Eröffnungsbeschlusses).
Der Angeklagte bestreitet, sich in der ihm vorgeworfenen Weise schuldig gemacht zu haben.
Der Zeuge Ros. hat lediglich gehört, der Angeklagte Bednarek habe an der Vernichtung des Theresienstädter Familienlagers mitgewirkt.
Der bereits in anderem Zusammenhang als unzuverlässig bezeichnete Zeuge Stern. hat lediglich im Ermittlungsverfahren bekundet, Bednarek sei bei der Räumung und Vernichtung dieses Lagers dabeigewesen, als 10 sich widersetzende Häftlinge totgeschlagen worden seien. In der Hauptverhandlung hat er trotz Vorhaltes dieser Aussage immer wieder betont, er habe Bednarek bei der Räumung dieses Lagers nicht gesehen, Bednarek sei nicht dabeigewesen. Die Schilderung dieses Zeugen hatte sonach bei einer Schuldfeststellung unberücksichtigt zu bleiben.
Der Zeuge Dow K. ist als ausserordentlich zuverlässiger Zeuge angesehen worden. Er hat glaubhaft bekundet, Bednarek habe sich bei der ersten Räumung des tschechischen Familienlagers (6./7.März 1944) betätigt; er habe insbesonders heftig auf einen Erzieher namens Bondi eingeschlagen, der sich vor allem der im Lager befindlichen jüdischen Kinder angenommen gehabt habe. Er könne aber nicht sagen, ob Bondi, den man später auf einen Lastwagen geworfen habe, infolge der brutalen Schläge von Bednarek verstorben oder durch Gas umgekommen sei. Auch in diesem Punkt war demgemäss eine Verurteilung des Angeklagten nicht möglich.
3.
Der Zeuge Tam. schildert, dass er im Quarantänelager B II a erlebt habe, wie ein Ungar, der sich beschwert hätte, dass trotz ausdrücklichen Verbots Häftlinge im Lager geprügelt würden, von verschiedenen Funktionshäftlingen, unter ihnen Bednarek, zu Tode geprügelt worden sei. Ausserdem sei er selbst zusammen mit einem Häftling namens Pines von dem Angeklagten geschlagen worden, weil sie sich einige Pellkartoffeln in der Küche mitgenommen und in die Tasche gesteckt hätten; dabei sei Pines an den Folgen dieser Schläge gestorben.
Diese von dem Zeugen bereits im Vorverfahren in gleicher Weise gemachten Aussagen bilden die Grundlage der Beschuldigungen in Punkt 5 und 6 des Eröffnungsbeschlusses.
Der Aussage dieses Zeugen begegnen aber insofern Bedenken, als er selbst sich zur damaligen Zeit im Quarantänelager (B II a) befunden hat, während der Angeklagte in der Strafkompanie (Block 11) des Lagers B II d untergebracht war. Es ist deshalb sehr unwahrscheinlich, dass sich der Angeklagte Bednarek zu der von dem Zeugen angegebenen Nachtzeit in ein anderes Lager hat begeben können. Dies war schon grundsätzlich jedem Lagerangehörigen untersagt, das Verbot galt noch mehr für den Blockältesten der Strafkompanie, der nach dem Abendappell auch seinen Block nicht mehr verlassen durfte.
Auch aus einem weiteren Umstand ergibt sich, dass sich der Zeuge in der Person des Schlägers geirrt haben muss, den Angeklagten Bednarek also zu Unrecht, wenn auch guten Glaubens, belastet. Der Zeuge schildert nämlich, dass bei dem Vorfall mit dem Häftling Pines sein Blockältester namens Siegmund dem Funktionshäftling, den er mit dem Namen Bednarek bezeichnet, Meldung erstattet habe. Dies spricht dafür, dass es sich bei diesem Funktionshäftling nicht um den Angeklagten, vielmehr um den Lagerältesten gehandelt hat, der auch die Befugnis hatte, von Lager zu Lager zu gehen. Es war sonach nicht möglich, den Angeklagten dieser weiteren Taten zu überführen.
4.
In Ziffer 8 des Eröffnungsbeschlusses schliesslich wird dem Angeklagten noch vorgeworfen, er habe im Sommer 1944 einen Häftling auf dem Appellplatz durch Schläge mit einem Schaufelstiel getötet.
Der Zeuge Doe. hat glaubhaft geschildert, wie der Angeklagte Bednarek an einem Samstag des Sommers 1944 einen bereits am Boden liegenden Häftling sehr heftig mit dem Stock geschlagen und ihn auch getreten hat. Der Zeuge ist dann, weil er diese Misshandlungen nicht mehr weiter mit ansehen konnte, weggegangen. Am nächsten Tag fragte er bei Angehörigen der Strafkompanie, was aus dem Häftling geworden sei und hörte, er sei verstorben.
Es besteht hiernach ein erheblicher Verdacht, dass der Angeklagte auch diesen Mithäftling totgeschlagen hat. Da der Zeuge Doe. aber nur die Mitteilung Dritter schildern und das Gericht die Zuverlässigkeit dieser Mitteilung nicht überprüfen konnte, bestehen Zweifel, ob der Misshandelte tatsächlich an den Schlägen verstorben ist, so dass auch in diesem Punkte dem Angeklagten die Tat nicht mit letzter Sicherheit nachgewiesen werden konnte.
6. Abschnitt: Verfahrensvoraussetzungen, Prozesshindernisse
I. Kein Verbot der Doppelbestrafung beim Angeklagten Kaduk
Der Verurteilung des Angeklagten Kaduk steht das Verbot der Doppelbestrafung (Art.103 Abs.3 Grundgesetz) nicht entgegen. Das Urteil des Militärtribunals der sowjetischen Militärverwaltung des Landes Sachsen in der Stadt Bautzen vom 25.8.1947 gegen den Angeklagten Kaduk hat die Strafklage gegen diesen Angeklagten - entgegen der Auffassung der Verteidigung - nicht verbraucht. Zwar ist der Angeklagte Kaduk von dem sowjetischen Militärtribunal wegen im KL Auschwitz begangener Verbrechen verurteilt worden. Das Schwurgericht hat zu Gunsten des Angeklagten Kaduk unterstellt, dass nach dem Recht der Sowjetunion durch dieses Urteil alle vom Angeklagten Kaduk im KL Auschwitz begangenen Verbrechen - auch ohne dass sie in dem Urteil des sowjetischen Militärtribunals besonders aufgeführt worden sind - als Teile einer sog. Komplextat erfasst und mit abgeurteilt worden sind.
Aus den §§3, 5 und 7 StGB und aus §153b StPO ergibt sich jedoch, dass nur die Urteile inländischer Gerichte die Strafklage verbrauchen. Das Urteil des sowjetischen Militärtribunals stünde daher einer erneuten Bestrafung des Angeklagten Kaduk nur dann entgegen, wenn dieses Gericht inländische Gerichtsbarkeit ausgeübt hätte. Das ist jedoch nicht der Fall. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (vgl. BGHSt. 6, 176 und die dort zitierten Entscheidungen), der sich das Schwurgericht anschliesst, haben die Besatzungsgerichte keine inländische Gerichtsbarkeit ausgeübt, selbst wenn sie deutsches Recht angewendet haben. Denn diese Gerichte beruhen nicht auf der deutschen Staatsgewalt, wovon die richterliche Gewalt ein Teil ist. Die Besatzungsgerichte verdanken ihre Entstehung allein dem Willen ihres eigenen Staates und leiten nur von ihm ihre richterliche Gewalt ab. Hier wird das noch dadurch besonders deutlich, dass das sowjetische Militärtribunal das Recht der Sowjetunion angewendet hat. Das Verfahren gegen den Angeklagten Kaduk beruhte auf den Art.319, 320 der Strafprozessordnung der Russischen Sozialistischen Föderativen Republik. Die Verurteilung des Angeklagten Kaduk erfolgte nicht nach deutschem Recht, sondern nach Art.4 des Strafgesetzbuches der Russischen Sozialistischen Föderativen Republik. Unerheblich ist, dass die sowjetrussische Militärverwaltung die Vollstreckung der gegen den Angeklagten Kaduk ausgesprochenen Strafe später auf die Behörden der Sowjetzone übertragen hat und dass diese dem Angeklagten Kaduk die Strafe schliesslich im Gnadenwege erlassen haben. Bei diesem Gnadenakt handelt es sich um einen Verwaltungsakt, jedoch nicht um die Entscheidung eines Gerichts. Die Frage, ob die Entscheidung sowjetzonaler Gerichte als Urteile inländischer Gerichte anzusehen sind, stellt sich daher nicht. Der Akt der Begnadigung durch die sowjetzonalen Behörden konnte das Urteil des sowjetrussischen Militärtribunals nachträglich nicht zu einem Urteil eines inländischen Gerichtes machen.
Unerheblich ist auch, ob nach dem Recht der Sowjetzone die Strafklage gegen den Angeklagten Kaduk durch das Urteil des sowjetrussischen Militärtribunals verbraucht ist, was das Schwurgericht zu Gunsten des Angeklagten Kaduk unterstellt hat. Denn die Frage, ob eine Strafklage verbraucht ist, richtet sich allein nach dem in der Bundesrepublik geltenden Recht. Gesetzliche Bestimmungen in der Sowjetzone und zwischenstaatliche Verträge zwischen der Sowjetzone und der Sowjetunion können die Bundesrepublik nicht binden. Der Vertrag vom 30.3.1955 (BGBl. II, 405 - sog. Überleitungsvertrag -) kann hier keine Anwendung finden, da die Sowjetunion nicht Partner dieses Vertrages ist.
Inwieweit der Angeklagte Kaduk gegenüber solchen Personen, die durch Besatzungsgerichte der drei Westmächte verurteilt worden sind und deren erneuter Verurteilung der Überleitungsvertrag entgegensteht, schlechter gestellt ist, braucht hier nicht untersucht zu werden. Auch wenn eine solche Schlechterstellung bestehen sollte, konnte das nicht dazu führen, dass das Schwurgericht den Verbrauch der Strafklage durch das Urteil eines ausländischen Gerichtes gegen bestehende gesetzliche Bestimmungen fingieren durfte. Eine Lösung könnte hier nur durch den Gesetzgeber oder im Gnadenwege gefunden werden. Eine Anrechnung des von dem Angeklagten Kaduk verbüssten Teiles der von dem sowjetischen Militärtribunal verhängten Strafe nach §7 StGB ist nicht möglich, da der Angeklagte Kaduk nicht zu einer zeitigen Zuchthausstrafe verurteilt worden ist.
II. Keine Verjährung der Straftaten der Angeklagten
Die Straftaten der Angeklagten sind nicht verjährt.
1.
Für alle abgeurteilten Straftaten galt von Anfang an die Verjährungsfrist von 20 Jahren. Soweit die Angeklagten des Mordes schuldig sind, bedarf dies keiner näheren Begründung, da Mord mit lebenslangem Zuchthaus bedroht ist - die zur Tatzeit geltende Androhung der Todesstrafe ist heute unbeachtlich (Art.102 GG) - so dass nach §67 Abs.1 StGB die Strafverfolgung erst in 20 Jahren verjährt.
Die 20jährige Verjährungsfrist gilt aber auch, soweit die Angeklagten nur der Beihilfe zum Mord schuldig sind. Die Strafverfolgungsverjährung richtet sich nicht nach der Höhe der verwirkten, sondern nach der Höhe der für den Einzelfall angedrohten Strafe, wobei die Möglichkeit einer Strafmilderung ausser Betracht zu bleiben hat. Beihilfe zum Mord ist mit lebenslangem Zuchthaus bedroht (§49 StGB in Verbindung mit §211 StGB). Sie war zur Tatzeit mit der Todesstrafe bedroht, so dass bereits damals gemäss §67 Abs.1 StGB die 20jährige Verjährungsfrist galt. Soweit die Beihilfehandlungen zum Mord nach Inkrafttreten der Verordnung vom 29.5.1943 (RGBl. I Seite 341) geleistet worden sind, ergibt sich das unmittelbar aus den durch diese VO geänderten Bestimmungen der §§44 und 49 StGB, wonach künftig wegen versuchter Taten oder wegen Beihilfe eine Strafmilderung nicht mehr zwingend vorgesehen war, die versuchte Straftat und die Beihilfe vielmehr grundsätzlich in derselben Weise zu ahnden waren wie das vollendete Verbrechen. Aber auch die vor Inkrafttreten dieser VO von den Angeklagten geleisteten Beihilfehandlungen zum Mord waren mit der Todesstrafe bedroht. Zwar schrieb §49 StGB in der vor Inkrafttreten der VO vom 29.5.1943 gültigen Fassung vor, dass die Strafe des Gehilfen nach dem Gesetz festzusetzen sei, welches auf die Haupttat Anwendung findet, jedoch nach den über die Bestrafung des Versuches aufgestellten Grundsätzen zu ermässigen sei. Zur Zeit der Begehung der abgeurteilten Straftaten galt jedoch bereits der §4 der VO gegen Gewaltverbrecher vom 5.12.1939 (RGBl. I Seite 2378), der bestimmte, dass für die Beihilfe zu einem Vergehen oder Verbrechen allgemein die Strafe zulässig sei, die für die vollendete Tat vorgesehen war. Die Einführung des §4 hatte zur Folge, dass er nunmehr bis zum Inkrafttreten der VO vom 29.5.1943 in Verbindung mit den §§44, 49 StGB alter Fassung (a.F.) den Strafrahmen für den Versuch und die Beihilfe absteckte. Damit war zur Zeit der von den Angeklagten begangenen Beihilfehandlungen zum Mord eine Strafermässigung im Falle der Beihilfe zu einem Verbrechen oder Vergehen nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Beihilfe zum Mord konnte vielmehr zur Zeit der von den Angeklagten begangenen Taten bereits mit der Todesstrafe geahndet werden. Für die Beihilfehandlungen der Angeklagten galt daher nicht mehr die 15jährige Verjährungsfrist (§67 Abs.1 in Verbindung mit §§44, 49 a.F.), vielmehr unterlagen auch diese Straftaten der Angeklagten einer 20jährigen Verjährungsfrist.
Bedenken gegen die Rechtswirksamkeit und damit gegen die Anwendbarkeit des §4 der VO gegen Gewaltverbrecher vom 5.12.1939 bestehen nicht. Der Bundesgerichtshof hat diese bereits in mehreren Entscheidungen (vgl. Urteil vom 2.10.1963 - 2 StR 269/63; Urteil vom 25.11.1964 - 2 StR 71/64 und die dort zitierten Entscheidungen) eingehend begründet. Das Schwurgericht hat keine Veranlassung, von dieser Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes abzuweichen.
2.
Die Verjährung einer Straftat beginnt mit dem Tage, an welchem sie begangen worden ist. Sie wird unterbrochen durch jede Handlung eines Richters, die wegen der begangenen Taten gegen den Täter gerichtet ist (§68 StGB). Sie ruht während der Zeit, in welcher auf Grund gesetzlicher Vorschrift die Strafverfolgung nicht begonnen oder fortgesetzt werden kann (§69 Abs.I Satz 1 StGB).
Für die in der nationalsozialistischen Zeit aus politischen, rasse- und religionsfeindlichen Gründen nicht verfolgten Delikte hat die Verjährung bis zum 8.5.1945 geruht. Das ergibt sich aus dem Grundgedanken des §69 StGB (vgl. Schwarz-Dreher Komm. zum StGB 25.Aufl. Anm.2 zu §69; Schönke-Schröder Komm. zum StGB 11.Aufl. Anm.4 zu §69). Denn die von der NS-Führung aus politischen, rasse- oder religionsfeindlichen Gründen befohlenen Verbrechen konnten in der nationalsozialistischen Zeit wegen des entgegenstehenden "Führerwillens" strafrechtlich nicht verfolgt werden. Das gilt für die Mehrzahl der von den Angeklagten begangenen Straftaten.
Die Strafverfolgungsverjährung begann daher zumindest bei folgenden Straftaten frühestens am 8.5.1945:
Bei den Straftaten des Angeklagten Mulka (3. Abschnitt A.II.).
Bei den Straftaten des Angeklagten Höcker (3. Abschnitt B.II.).
Bei den Straftaten des Angeklagten Boger, die im 3. Abschnitt unter C.II.1. und 2. aufgeführt sind.
Bei den Straftaten des Angeklagten St., die im 3. Abschnitt unter D.II.1. - 4. aufgeführt worden sind.
Bei den Straftaten des Angeklagten Dylewski, die im 3. Abschnitt unter E.II.1. aufgeführt worden sind.
Bei den Straftaten des Angeklagten Broad, die im 3. Abschnitt unter F.II.1. aufgeführt worden sind.
Bei den Straftaten des Angeklagten Hofmann, die im 3. Abschnitt unter H.II.1. aufgeführt worden sind.
Bei den Straftaten des Angeklagten Baretzki, die im 3. Abschnitt unter K.II.1., 2., 4. aufgeführt worden sind.
Bei den Straftaten der Angeklagten Dr. L., Dr. Frank und Dr. Capesius, die im 3. Abschnitt unter L.II., M.II. und N.II. aufgeführt worden sind.
Bei den Straftaten des Angeklagten Klehr, die im 3. Abschnitt unter O.II.1., 5., 6., 7. aufgeführt worden sind.
Bei den Straftaten der Angeklagten Scherpe und Hantl, die unter P.II.1. und 2. und Q.II.1. und 2. aufgeführt worden sind.
Alle diese Verbrechen waren von der NS-Führung befohlen und konnten daher bis zum 8.5.1945 nicht verfolgt werden. Ihre Strafverfolgung war daher bei Erlass des Eröffnungsbeschlusses (7.10.1963), durch den die Verjährungsfrist unterbrochen worden ist (§68 StGB) noch nicht verjährt.
Im übrigen war die Strafverfolgungsverjährung dieser Taten bereits vorher durch richterliche Handlungen wie folgt unterbrochen worden:
Bei den aufgezählten Taten der Angeklagten Mulka, Boger, St., Dylewski, Broad, Hofmann, Baretzki, Dr. Frank, Dr. Capesius, Klehr und Hantl durch den Beschluss über die Eröffnung der gerichtlichen Voruntersuchung vom 9.8.1961.
Bei den Straftaten der Angeklagten Höcker und Dr. L. durch den Beschluss über die Eröffnung der Voruntersuchung vom 29.1.1962 und bei den Taten des Angeklagten Scherpe durch den Beschluss über die Eröffnung der gerichtlichen Voruntersuchung vom 2.9.1961.
Die aufgezählten Straftaten sind daher nicht verjährt, ohne dass noch näher darauf eingegangen zu werden braucht, durch welche sonstigen früheren richterlichen Handlungen die Strafverfolgungsverjährung bereits vor dem 9.8.1961 bzw. 2.9.1961 bzw. 29.1.1962 unterbrochen worden ist.
Für die Strafverfolgungsverjährung der übrigen Straftaten gilt folgendes:
Die sog. Bunkerentleerungen und nachfolgenden Erschiessungen erfolgten nicht auf Befehl der NS-Führung. Sie geschahen vielmehr gegen die Weisungen und Richtlinien der NS-Führung, dass kein SS-Angehöriger im KL Auschwitz befugt sei, über Leben und Tod eines Häftlings zu entscheiden. Ihre strafrechtliche Verfolgung war daher auch unter nationalsozialistischer Herrschaft möglich. Dass eigenmächtige Tötungshandlungen im KL Auschwitz auch damals strafrechtlich verfolgt wurden, zeigt das Strafverfahren gegen den Leiter der Politischen Abteilung Grabner wegen der im Arrestblock durchgeführten Erschiessungen.
Die Verjährung der Straftaten der Angeklagten Boger, Dylewski, Broad, Schlage und Hofmann, die im 3. Abschnitt unter C.II.3., E.II.2., F.II.2., G.II., H.II.2. aufgeführt worden sind, begann daher bereits im Zeitpunkt ihrer Begehung. Gleichwohl sind diese Straftaten nicht verjährt. Denn die Verjährung wurde durch richterliche Handlungen rechtzeitig vor Ablauf der Verjährungsfrist unterbrochen. Das ergibt sich aus folgender Übersicht:
Beginn der Verjährung:
a. der unter C.II.3. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Boger:
3.3.1943
28.9.1943
b. der unter E.II.2. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Dylewski:
frühestens am 1.9.1941
c. der unter F.II.2. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Broad:
frühestens am 1.6.1942
d. der unter H.II.2. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Hofmann:
frühestens am 1.12.1942
Unterbrechung der Verjährung bei all diesen Straftaten: Durch Beschluss vom 9.8.1961 über die Eröffnung der gerichtlichen Voruntersuchung (a.a.O.).
Beginn der Verjährung:
der unter G.II. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Schlage:
frühestens am 21.9.1942 (denn der Angeklagte Schlage kam erst im Herbst 1942 als Arrestaufseher in den Block 11, er kann die festgestellten Taten daher erst nach diesem Zeitpunkt begangen haben).
Unterbrechung der Verjährung bei diesen Taten des Angeklagten Schlage:
Durch den Beschluss über die Eröffnung der Voruntersuchung gegen den Angeklagten Schlage vom 5.3.1962.
In allen aufgeführten weiteren Fällen ist also die Verjährung rechtzeitig unterbrochen worden.
Auch die noch verbleibenden Straftaten der Angeklagten sind nicht verjährt. Dies ergibt folgende Übersicht:
Beginn der Verjährung:
der unter C.II.4a - e. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Boger:
a. am 1.12.1942 (frühestens)
b. am 21.6.1943 (frühestens)
c. am 21.6.1943 (frühestens)
d. am 21.6.1943 (frühestens)
e. am 1.1.1943 (frühestens)
Unterbrechung der Verjährung:
durch Beschluss vom 9.8.1961.
Beginn der Verjährung:
der unter C.II.5. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Boger:
21.9.1944 (frühestens)
Unterbrechung der Verjährung:
spätestens durch Eröffnungsbeschluss vom 7.10.1963.
Beginn der Verjährung:
der unter H.II.3. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Hofmann:
1.3.1943 (frühestens)
Unterbrechung der Verjährung:
durch Beschluss vom 9.8.1961.
Beginn der Verjährung:
1. der unter J.II.1. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Kaduk:
a. 1.1.1943 (frühestens)
b. 21.9.1944 (frühestens)
2. der unter J.II.2. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Kaduk:
21.6.1944 (frühestens)
3. der unter J.II.3. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Kaduk:
15.9.1943 (frühestens)
4. der unter J.II.4. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Kaduk:
15.9.1943 (frühestens)
5. der unter J.II.5. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Kaduk:
21.6.1943 (frühestens)
6. der unter J.II.6. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Kaduk:
21.6.1944
Unterbrechung der Verjährung dieser Straftaten des Angeklagten Kaduk:
durch Beschluss vom 9.8.1961.
Beginn der Verjährung:
der unter J.II.7. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Kaduk:
18.1.1945 (frühestens)
Unterbrechung der Verjährung:
durch Eröffnungsbeschluss vom 7.10.1963 (spätestens).
Beginn der Verjährung:
der unter K.II.3. aufgeführten Straftat des Angeklagten Baretzki:
19.4.1944
Unterbrechung der Verjährung:
durch Beschluss vom 9.8.1961.
Beginn der Verjährung:
der unter K.II.5. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Baretzki:
21.6.1944 (frühestens)
Unterbrechung der Verjährung:
am 5.6.1964 durch den Hinweis des Vorsitzenden des Schwurgerichts in der Hauptverhandlung an den Angeklagten Baretzki - nach Erhebung der Nachtragsanklage -, dass der Angeklagte Baretzki nach §266 StPO das Recht habe, die Unterbrechung der Hauptverhandlung zu beantragen, soweit Nachtragsanklage erhoben sei.
Beginn der Verjährung:
1. der unter O.II.2a-d. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Klehr:
a. - c. 1.10.1941 (frühestens), denn der Angeklagte Klehr wurde erst im Oktober 1941 nach seiner Ankunft im KL Auschwitz als SDG im HKB des Stammlagers eingesetzt (vgl. 3. Abschnitt O.II.1. 1. Satz). Der Angeklagte Klehr kann die unter a. - c. aufgeführten Taten daher erst ab Oktober 1941 begangen haben.
d. 24.12.1942
2. der unter O.II.3. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Klehr:
a. 21.3.1943 (frühestens)
b. 15.4.1943 (frühestens)
3. der unter O.II.4. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Klehr:
1.4.1943 (frühestens)
4. der unter O.II.8a-e. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Klehr:
a. 21.6.1943 (frühestens)
b. 1.8.1943 (frühestens)
c. 21.6.1943
d. 1.1.1942 (frühestens)
e. 1.10.1941 (frühestens)
Unterbrechung der Verjährung in allen diesen Fällen:
durch Beschluss über die Eröffnung der gerichtlichen Voruntersuchung vom 9.8.1961.
Beginn der Verjährung:
1. der unter R.II.1a-b. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Bednarek:
a. 21.6.1941 (frühestens)
b. 24.12.1941
2. der unter R.II.2a-d. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Bednarek:
a. 1.6.1943 (frühestens, da der Angeklagte erst im Juni oder Juli 1943 Blockältester der SK geworden ist, die Straftaten in Block 11 des Lagerabschnittes B (B II d) in Birkenau also erst nach diesem Zeitpunkt begangen haben kann)
b. 1.6.1943 (s.o.)
c. 1.12.1943 (frühestens)
d. 21.3.1944 (frühestens)
3. der unter R.II.3a-d. aufgeführten Straftaten des Angeklagten Bednarek:
a. 1.2.1944 (frühestens)
b. 1.2.1944 (frühestens)
c. 21.9.1943 (da die Angehörigen des Siemens-Kommandos erst im Herbst 1943 in den Block 11 des Lagerabschnittes B II d in Birkenau gekommen sind, kann die Tat erst nach diesem Zeitpunkt begangen worden sein)
d. 28.9.1943 (s.o.)
Unterbrechung der Verjährung in allen aufgeführten Fällen:
durch Erlass des Haftbefehls vom 24.11.1960, der durch den Beschluss vom 1.12.1960 ergänzt worden ist.
Ausserdem ist die Verjährung der unter R.II.2., II.3. aufgeführten Straftaten rechtzeitig durch den Beschluss über die Eröffnung der gerichtlichen Voruntersuchung gegen den Angeklagten Bednarek vom 9.8.1961 unterbrochen worden.
Zusammenfassend ist also festzustellen, dass keine der abgeurteilten Straftaten der Angeklagten verjährt ist.
7. Abschnitt:
Nebenentscheidungen
I.
Den Angeklagten Boger, Hofmann, Kaduk, Klehr, Baretzki und Bednarek sind die bürgerlichen Ehrenrechte gemäss §32 StGB auf Lebenszeit aberkannt worden, da sie besonders verwerfliche Straftaten begangen und eine ehrlose Gesinnung unter Beweis gestellt haben.
Den Angeklagten Mulka, Schlage, Höcker, Dr. Frank, Dr. Capesius, Dylewski, Broad, Scherpe und Hantl sind gemäss §32 StGB die bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit, wie aus dem Urteilstenor ersichtlich, aberkannt worden.
Für diese Entscheidungen waren, bei Berücksichtigung der Persönlichkeit des jeweiligen Angeklagten und dem Umfang seiner Schuld, massgeblich der Unrechtsgehalt und die schwerwiegenden Folgen der von ihnen zu verantwortenden Taten. Bei dem Angeklagten St. kam nach §§105, 6 JGG eine Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte nicht in Betracht. Dem Angeklagten Dr. L. sind die bürgerlichen Ehrenrechte trotz des Unrechtsgehalts und der schweren Folgen seiner Taten nicht aberkannt worden aus Gründen, die in seiner Persönlichkeit und seinem sonstigen Verhalten in den KL Auschwitz, Ravensbrück und Sachsenhausen liegen. Er hat, wie bereits ausgeführt, an den Vernichtungsaktionen nur widerstrebend teilgenommen, das Los der Häftlinge nach Kräften zu erleichtern versucht und sich schliesslich - anders als die oben erwähnten Angeklagten - von den KL-Methoden nachdrücklich distanziert und schliesslich die Flucht ergriffen, um nicht in weitere Straftaten verstrickt zu werden.
II.
Die Anrechnung der Untersuchungshaft auf die erkannten zeitigen Freiheitsstrafen erfolgte nach §60 StGB, §§109, 105, 52 JGG.
III.
Die Entscheidung über die Kosten beruht auf §§465, 467 StPO, §§109, 105, 74 JGG.